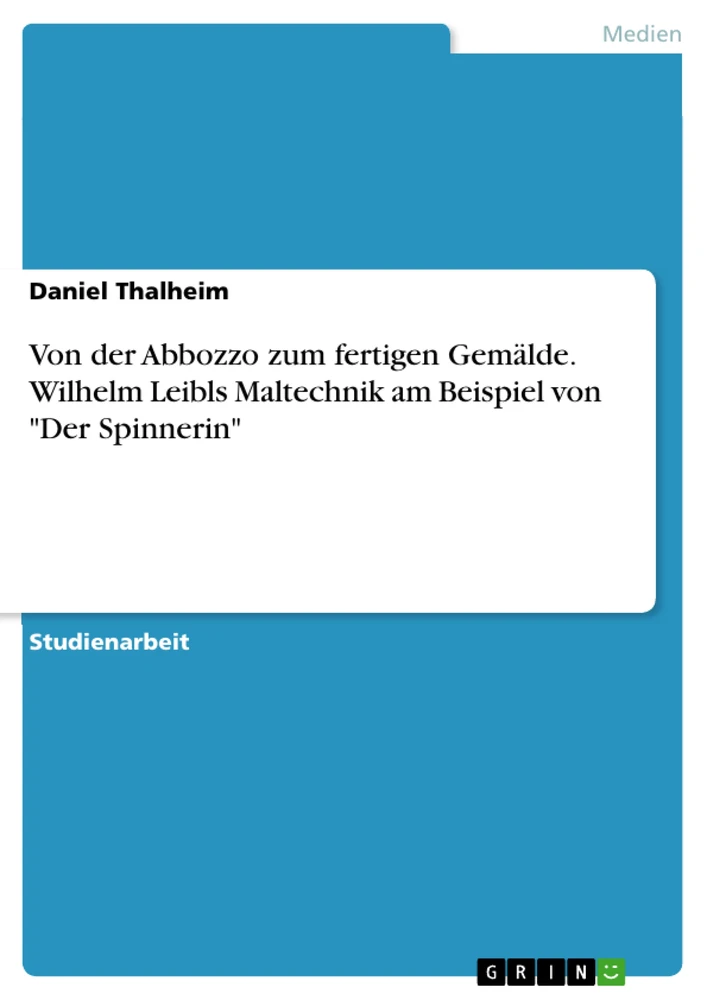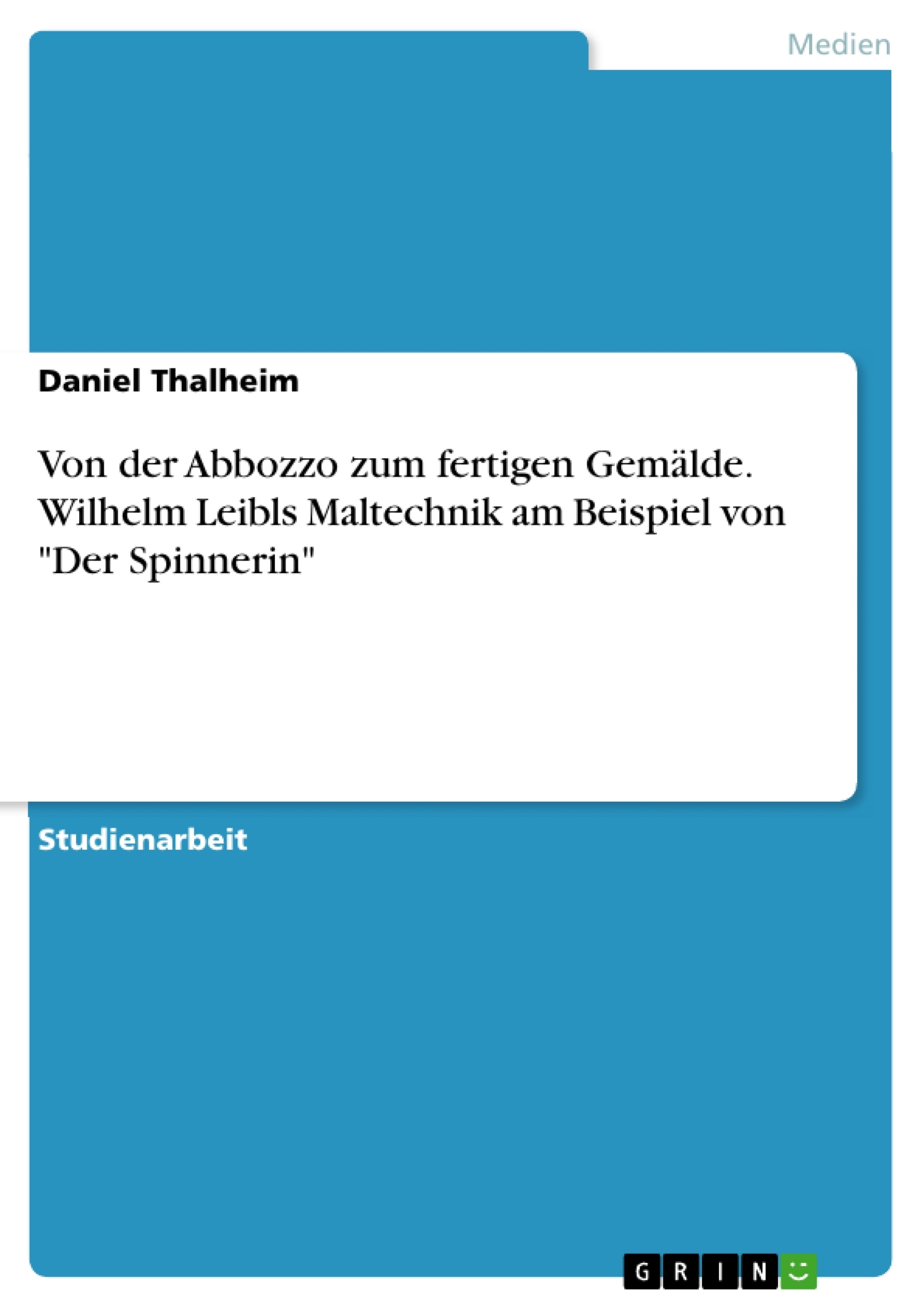Wilhelm Leibl ist ein ungewöhnlicher Maler. Bauernidyllen, die keine sind. Altmeisterliche Malerei, die mit zunehmenden Alter lockerer ausgeführt wurde. Eingebettet in den Entwicklungen im Fin-de-Siècle, fällt das Werk von Wilhelm Leibl etwas aus der Zeit. Während Max Liebermann und Lovis Corinth mit Rückgriffen auf die französischen Impressionisten und Fauves das Leben malten und sich neuen künstlerischen Techniken bedienten, Künstler wie Ferdinand Hodler, Max Klinger, Arnold Böcklin und Gustav Klimt allegorisch-symbolistische Szenen schufen und die neue Malergeneration des frühen 20. Jahrhunderts in den Startlöchern stand, bediente Wilhelm Leibl sich klassisch anmutender Szenen aus dem bäuerlichen Leben im Münchner Umland.
Man kann dem Maler vielleicht eine gewisse „Ältlichkeit“ vorwerfen. Weil sein Werk sich von den damals gängigen modernen Trends abhebt und in der Altmeisterlichkeit verharrt, kommt der Betrachter zu einer geschäftigen Ruhe. Die Schnelligkeit der Zeit, in der Wilhelm Leibl lebte, bleibt in seinen Bildern ausgeschlossen. Die modernen Erfindungen in der Fotografie, Film, Eisenbahn, Industrie, Tonträgern kommen in seinen Gemälden nicht zum Tragen. Das macht ihn und sein Werk zu etwas besonderem. Teile dieses Textes veröffentlichte ich auf dem Blog Artefakte - Das Journal für Baukultur und Kunst.
Als ich 2001 anfing, Kunstgeschichte und Geschichte an der Universität Leipzig zu studieren, stand ich allen Künsten offen gegenüber. So ist es auch noch heute, knapp 18 Jahre später. Die Beschäftigung mit Wilhelm Leibl begann mit einem Seminar, das Dr. Heike Lüddemann leitete. Es fand 2003 statt und wurde noch größtenteils am Museum der bildenden Künste (Interim Handelshof) durchgeführt.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Die Einordnung von Wilhelm Leibl in die europäischen Kunstströmungen des ausgehenden 19. Jahrhunderts
- Die politischen Verhältnisse in Deutschland von 1848 bis 1871
- „Die Spinnerin“ – Über die Entstehungsgeschichte und Bildbeschreibung, Provenienz und Einordnung des Gemäldes in Leibls Spätwerk
- Kompositionsmittel und Perspektive in „Die Spinnerin“
- Von der Skizze zum Gemälde - Die Frage nach der Lichtwertigkeit und Stofflichkeit der Bildgegenstände
- Was sich gleicht - „Die Spinnerin“ im Kontext von Leibls Gesamtwerk
- Urheberrechtsklausel
- Literatur- und Abbildungsverzeichnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit der Maltechnik Wilhelm Leibls am Beispiel seines Gemäldes „Die Spinnerin“. Sie zielt darauf ab, Leibls künstlerische Entwicklung und die Besonderheiten seiner Malweise aufzuzeigen, indem sie die Entstehungsgeschichte, die Komposition, die Lichtgebung und die Stofflichkeit der Bildgegenstände analysiert. Die Arbeit untersucht auch, wie „Die Spinnerin“ sich in Leibls Gesamtwerk einordnet.
- Die Einordnung von Wilhelm Leibls in die europäischen Kunstströmungen des ausgehenden 19. Jahrhunderts
- Die politische Situation in Deutschland zwischen 1848 und 1871
- Die Entstehungsgeschichte, Komposition und Bedeutung des Gemäldes „Die Spinnerin“
- Die Lichtwertigkeit und Stofflichkeit der Bildgegenstände in Leibls Malerei
- „Die Spinnerin“ im Kontext von Leibls Gesamtwerk
Zusammenfassung der Kapitel
- Vorwort: Dieses Kapitel bietet eine persönliche Einführung in die Arbeit und den Hintergrund der Forschungstätigkeit des Autors. Es beschreibt die Faszination des Autors für das Werk von Wilhelm Leibl und die Besonderheiten seiner Malweise.
- Die Einordnung von Wilhelm Leibl in die europäischen Kunstströmungen des ausgehenden 19. Jahrhunderts: Dieses Kapitel beleuchtet den Kontext von Leibls Schaffen, indem es die verschiedenen Strömungen der europäischen Kunst im ausgehenden 19. Jahrhundert, wie die Spätromantik, den Impressionismus, den Realismus und die Arts&Crafts-Bewegung, vorstellt. Es wird die Einordnung von Leibls Werk in diesen Kontext erörtert.
- Die politischen Verhältnisse in Deutschland von 1848 bis 1900: Dieses Kapitel beschreibt die politische Situation in Deutschland während der Lebenszeit von Wilhelm Leibl, indem es auf die Revolution von 1848, die Industrialisierung und die Entstehung des Deutschen Reiches eingeht. Der Fokus liegt auf dem Einfluss dieser Ereignisse auf die Kunst und Kultur der Zeit.
- „Die Spinnerin“ – Über die Entstehungsgeschichte und Bildbeschreibung, Provenienz und Einordnung des Gemäldes in Leibls Spätwerk: Dieses Kapitel widmet sich dem Gemälde „Die Spinnerin“ und beleuchtet seine Entstehungsgeschichte, seine Bildbeschreibung, seine Provenienz und seine Einordnung in Leibls Spätwerk. Es soll Einblicke in die Entstehung und Bedeutung des Gemäldes geben.
- Kompositionsmittel und Perspektive in „Die Spinnerin“: Dieses Kapitel analysiert die Komposition und Perspektive des Gemäldes „Die Spinnerin“. Es erklärt, wie Leibl die Kompositionsmittel und die Perspektive nutzt, um die Stimmung und die Aussage des Gemäldes zu verstärken.
- Von der Skizze zum Gemälde - Die Frage nach der Lichtwertigkeit und Stofflichkeit der Bildgegenstände: Dieses Kapitel befasst sich mit der Maltechnik von Wilhelm Leibl. Es analysiert, wie Leibl von der Skizze zum fertigen Gemälde arbeitet und wie er die Lichtwertigkeit und die Stofflichkeit der Bildgegenstände darzustellen weiß.
- Was sich gleicht - „Die Spinnerin“ im Kontext von Leibls Gesamtwerk: Dieses Kapitel untersucht, wie das Gemälde „Die Spinnerin“ in Leibls Gesamtwerk kontextualisiert werden kann. Es analysiert die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen „Die Spinnerin“ und anderen Werken von Leibl und zeigt, wie sich das Gemälde in sein Gesamtwerk einordnet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Maltechnik von Wilhelm Leibl, insbesondere mit der Analyse seines Gemäldes „Die Spinnerin“. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Wilhelm Leibl, Maltechnik, „Die Spinnerin“, Realismus, Spätromantik, Impressionismus, Arts&Crafts-Bewegung, Komposition, Lichtwertigkeit, Stofflichkeit, Gesamtwerk.
- Arbeit zitieren
- Daniel Thalheim (Autor:in), 2003, Von der Abbozzo zum fertigen Gemälde. Wilhelm Leibls Maltechnik am Beispiel von "Der Spinnerin", München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/460677