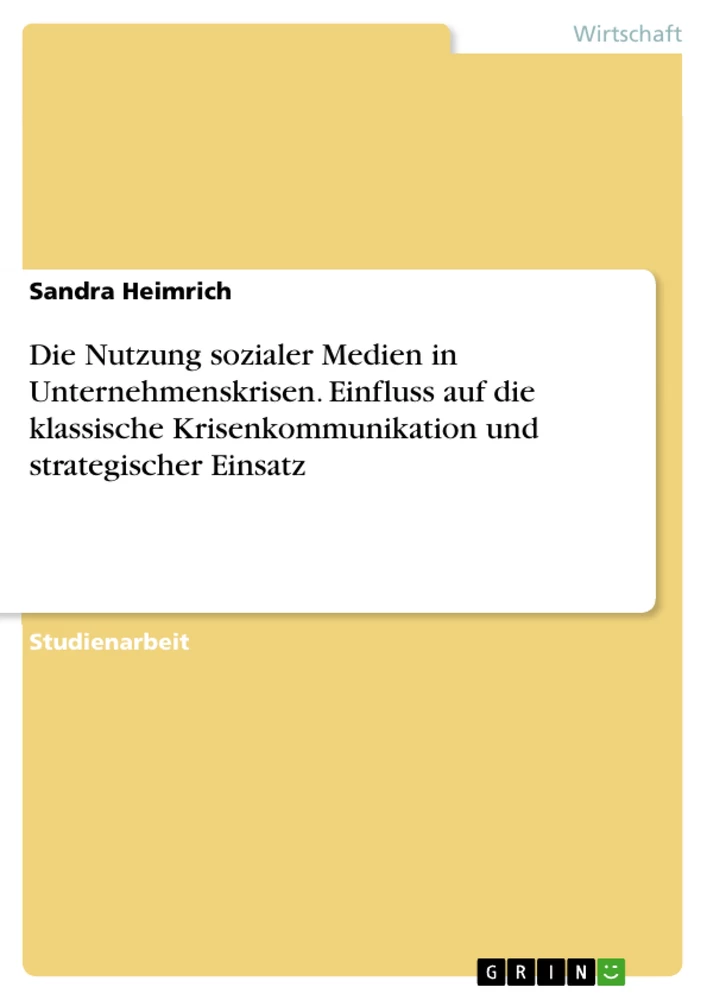Diese Arbeit thematisiert den strategischen Umgang mit Unternehmenskrisen im Hinblick auf den Einsatz sozialer Medien, um möglichst gestärkt aus einer Krisensituation hervorzugehen. Folgende Forschungsfragen liegen der Seminararbeit zugrunde: Wie beeinflusst der Einsatz von Social Media die klassische Krisenkommunikation in Unternehmenskrisen? Und davon ausgehend – wie können professionelle Kommunikatoren soziale Medien im Krisenfall strategisch nutzen?
Zur Beantwortung der beiden zugrundeliegenden Fragestellungen wurde ein deskriptives Vorgehen gewählt. Die nachfolgende Arbeit fokussiert sich anfangs auf die basalen Termini: Die Begriffe Krise, Krisenkommunikation und soziale Medien werden definiert sowie in Bezug auf das Erkenntnisinteresse charakterisiert. Das nachfol-gende Kapitel widmet sich dem Einsatz von Social Media im Krisenfall. Die strukturellen Rahmenbedingungen der sozialen Medien werden hierbei erörtert und in Verbindung mit den Anforderungen an eine effektive Krisenkommunikation gesetzt. Dazu zählen die Auflösung des klassischen Rollenverständnisses, der Aktualitätszwang, die veränderten Machtverhältnisse sowie die Krisenerzeugung in den sozialen Medien. Im Anschluss daran werden die Opportunitäten, die sich durch den Einsatz von Social Media im Rahmen der Krisenkommunikation ergeben, den vorangegangenen Anforderungen vergleichend gegenübergestellt. Ein weiteres Kapitel gibt Empfehlungen für strategische Krisenkommunikationsmaßnahmen in den sozialen Medien. Dabei wird zwischen Maßnahmen zur Krisenprävention, Krisenintervention und Krisenevaluation differenziert. Ein Fazit führt abschließend die wichtigsten Erkenntnisse zusammen.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 Krisenkommunikation in sozialen Medien
- 2 Wie beeinflusst der Einsatz von Social Media die klassische Krisenkommunikation in Unternehmenskrisen? Wie können professionelle Kommunikatoren soziale Medien im Krisenfall strategisch nutzen?
- 3 Definitionen und Charakteristika der grundlegenden Termini
- 3.1 Krise
- 3.1.1 Krisenursachen und Krisentypen
- 3.1.2 Krisenverlauf
- 3.2 Krisenkommunikation
- 3.2.1 Anspruchsgruppen im Krisenfall
- 3.2.2 Mediale Rahmenbedingungen der Krisenkommunikation
- 3.3 Soziale Medien
- 3.3.1 Nutzung sozialer Medien in der deutschen Bevölkerung
- 3.3.2 Einsatz von sozialen Medien in deutschen Unternehmen
- 4 Der Einsatz sozialer Medien in Unternehmenskrisen
- 4.1 Strukturelle Rahmenbedingungen sozialer Medien und deren Einfluss auf die Krisenkommunikation
- 4.1.1 Auflösung des klassischen Rollenverständnisses
- 4.1.2 Aktualitätszwang
- 4.1.3 Veränderte Machtverhältnisse im Social Web
- 4.1.4 Krisenerzeugung in den sozialen Medien
- 4.2 Opportunitäten der Krisenkommunikation im Social Web
- 5 Präventive, intervenierende und evaluierende Krisenkommunikationsmaßnahmen in den sozialen Medien
- 5.1 Krisenprävention mittels Social Media Monitoring
- 5.2 Erfolgsfaktoren der Krisenintervention in den sozialen Medien
- 5.2.1 Schnelligkeit
- 5.2.2 Vertrauensgenerierung und -stabilisierung
- 5.2.3 Social-Media-Gesamtstrategie
- 5.3 Krisenevaluation inklusive effektivem Reputationsmanagement
- 6 Strategisches Vorgehen als Determinante einer erfolgreichen Krisenkommunikation in sozialen Medien
- 7 Anhang
- 8 Literaturverzeichnis
- Der Einfluss von Social Media auf die klassische Krisenkommunikation.
- Die Relevanz der Nutzung von Social Media für Krisenmanagement.
- Strategische Ansätze zur Krisenkommunikation in sozialen Medien.
- Die Bedeutung von Schnelligkeit, Vertrauensgenerierung und einer Gesamtstrategie in der Krisenkommunikation.
- Die Herausforderungen und Chancen der Krisenevaluation in sozialen Medien.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die strategische Nutzung sozialer Medien in Unternehmenskrisen. Sie analysiert, wie der Einsatz von Social Media die klassische Krisenkommunikation beeinflusst und welche strategischen Möglichkeiten professionelle Kommunikatoren im Krisenfall nutzen können.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik der Krisenkommunikation in sozialen Medien. Hier werden die grundlegenden Begriffe definiert und die Rolle sozialer Medien in der deutschen Bevölkerung und in Unternehmen dargestellt.
Im Anschluss werden die strukturellen Rahmenbedingungen sozialer Medien und deren Einfluss auf die Krisenkommunikation untersucht. Dabei werden Themen wie die Auflösung des klassischen Rollenverständnisses, der Aktualitätszwang und die veränderten Machtverhältnisse im Social Web beleuchtet.
Das vierte Kapitel widmet sich den Opportunitäten der Krisenkommunikation im Social Web. Hier wird insbesondere auf die Präventive, Intervenierende und Evaluierende Maßnahmen eingegangen, die Unternehmen nutzen können.
Im fünften Kapitel werden die Erfolgsfaktoren der Krisenintervention in den sozialen Medien beleuchtet. Hier werden Themen wie Schnelligkeit, Vertrauensgenerierung und die Entwicklung einer Social-Media-Gesamtstrategie behandelt.
Das sechste Kapitel fokussiert auf das strategische Vorgehen als Determinante einer erfolgreichen Krisenkommunikation in sozialen Medien.
Schlüsselwörter
Krisenkommunikation, soziale Medien, Unternehmenskrisen, strategischer Einsatz, Social Media Monitoring, Krisenprävention, Krisenintervention, Krisenevaluation, Reputationsmanagement, Social Web.
- Quote paper
- Sandra Heimrich (Author), 2016, Die Nutzung sozialer Medien in Unternehmenskrisen. Einfluss auf die klassische Krisenkommunikation und strategischer Einsatz, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/459838