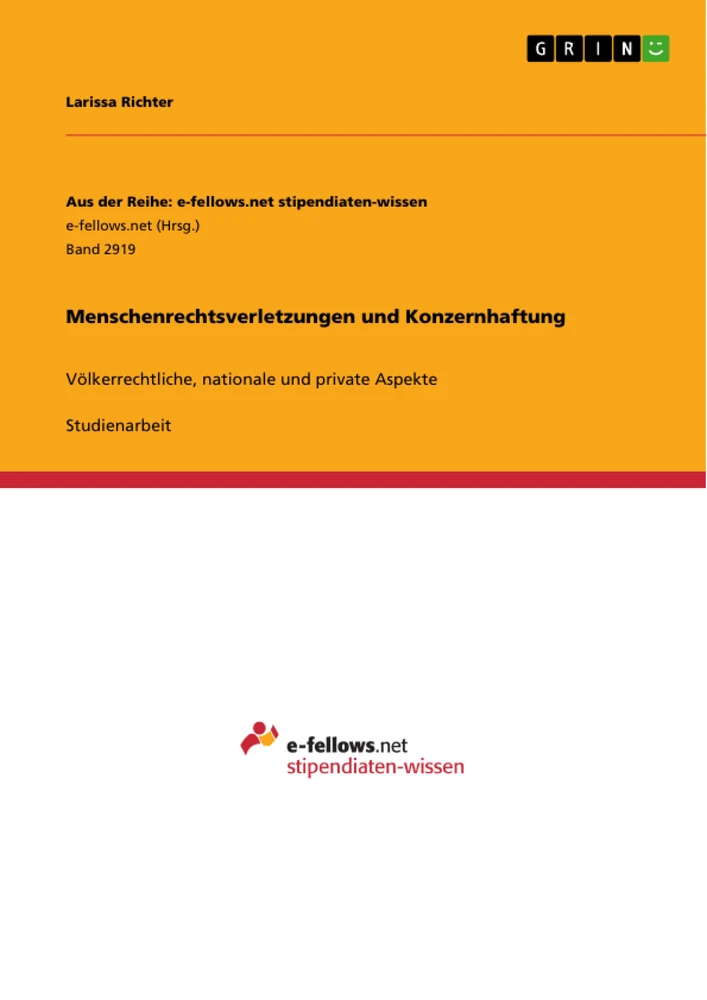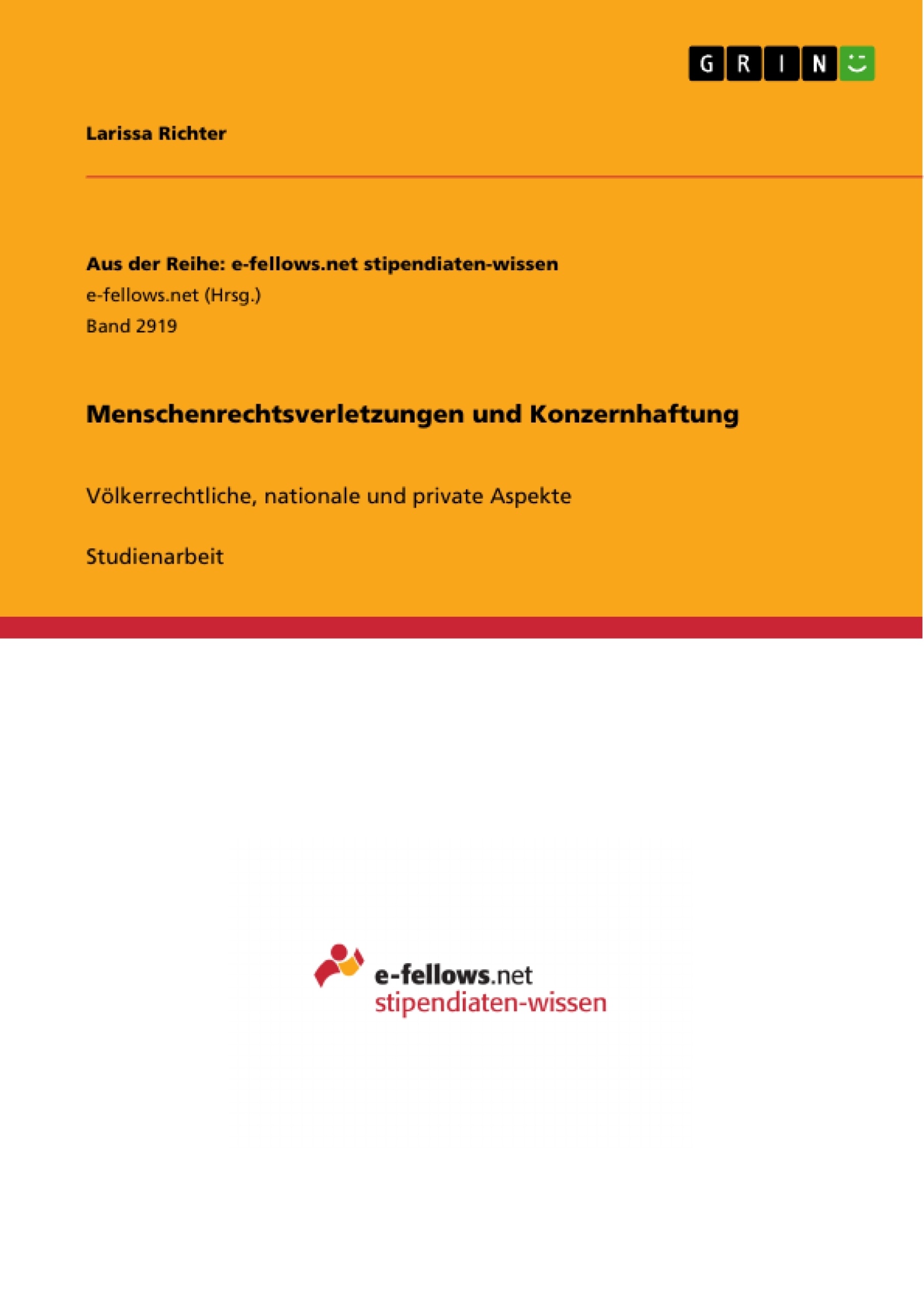Die Frage nach der Haftung deutscher Muttergesellschaften multinationaler Konzerne für Menschenrechtsverletzungen ausländischer Töchter wird hierzulande immer bedeutsamer. Denn obgleich es letztlich der Konzern als solcher ist, der von Menschenrechtsverletzungen profitiert, ist seine Inanspruchnahme –zumindest in der deutschen Rechtsordnung – bisher nicht vorgesehen. Unter den Schlagworten „Human Rights Litigation“, „Human Rights due Diligence“oder „Corporate Social Responsibility“ wird dennoch versucht, eine rechtliche Verantwortung von Konzernmüttern für Menschenrechtsverletzungen ihrer Töchter herzuleiten.
Erst vor kurzem wurden zu diesem Zweck mehrere denkbare zivilrechtliche Haftungsmodelle vorgestellt, welche sich darum bemühen, einen Außenhaftungsanspruch der Opfer zu begründen.Die vorliegende Abhandlung macht es sich zur Aufgabe, die Praktikabilität dieser Modelle und ihre Vereinbarkeit mit den Prinzipien des deutschen Konzernrechts zu überprüfen. Im Mittelpunkt steht dabei die Analyse der generellen zivilrechtlichen Außenhaftung von Konzernmüttern für ihre Tochtergesellschaften nach deutschem Recht und ihre Bedeutung für die Haftung wegen Menschenrechtsverletzungen. Ein weiteres Augenmerk liegt auf der Herausarbeitung möglicher weiterer Ansatzpunkten, die eine Haftung der Konzernmuttergesellschaften auch nach deutschem Recht rechtfertigen können.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einführung
- B. Aktueller Diskussionsstand der Konzernhaftung für Menschenrechtsverletzungen
- I. Völkerrechtliche, nationale und private Initiativen
- II. Deutsches Haftungssystem
- 1. Gerichtsstand und kollisionsrechtliche Einordnung
- 2. Sachrecht
- a. Universelle Menschenrechte?
- b. Haftungsmodelle
- III. Zwischenergebnis
- C. Inanspruchnahme der Konzernmutter für Menschenrechtsverletzungen einer ausländischen Tochtergesellschaft
- I. Haftung nach dem Recht verbundener Unternehmen
- 1. Grundsatz: Konzernrechtliches Trennungsprinzip
- a. Begriff
- b. Sinn und Zweck der Regelung
- 2. Außenhaftung im Vertragskonzern und im faktischen Konzern
- 3. Zwischenergebnis
- II. Grenzen der Selbstständigkeit und ihre Systematisierung
- 1. Besonderer Verpflichtungsgrund
- a. Schuld- und Gesellschaftsrecht
- b. Deliktsrecht
- aa. Täterschaft und Teilnahme
- bb. Haftung für Verrichtungsgehilfen
- cc. Konzernweite Unternehmensorganisationspflichten
- dd. Spezialgesetzlich angeordnete Haftung
- c. Zwischenergebnis
- 2. Durchgriffshaftung
- 3. Konzernvertrauens- oder Konzernlegalitätshaftung?
- III. Bedeutung für die Haftung wegen Menschenrechtsverletzungen
- 1. Praktikabilität der entwickelten Konzernhaftungsmodelle
- 2. Alternative Anknüpfungspunkte
- IV. Zwischenergebnis
- D. Rechtspolitische Perspektive
- E. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage der Konzernhaftung für Menschenrechtsverletzungen, die von Tochtergesellschaften im Ausland begangen werden. Die Arbeit untersucht den aktuellen Diskussionsstand, analysiert die verschiedenen Haftungsmodelle und die rechtlichen Grenzen der Selbstständigkeit von Tochtergesellschaften im Konzern und diskutiert die Bedeutung dieser Modelle für die Haftung wegen Menschenrechtsverletzungen. Schließlich wird ein Ausblick auf die rechtspolitische Perspektive gegeben.
- Konzernhaftung für Menschenrechtsverletzungen
- Haftungsmodelle und ihre Anwendung
- Grenzen der Selbstständigkeit von Tochtergesellschaften
- Praktikabilität der Haftungsmodelle
- Rechtspolitische Perspektive
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema der Konzernhaftung für Menschenrechtsverletzungen und stellt den aktuellen Diskussionsstand dar. Anschließend wird das deutsche Haftungssystem im Detail betrachtet, wobei insbesondere die rechtlichen Grundlagen für die Haftung von Konzernen für die Handlungen ihrer Tochtergesellschaften untersucht werden.
Kapitel C befasst sich mit der Inanspruchnahme der Konzernmutter für Menschenrechtsverletzungen einer ausländischen Tochtergesellschaft. Hierbei werden die Haftung nach dem Recht verbundener Unternehmen, die Grenzen der Selbstständigkeit von Tochtergesellschaften und die Bedeutung dieser Modelle für die Haftung wegen Menschenrechtsverletzungen analysiert.
Kapitel D bietet eine rechtspolitische Perspektive auf die Thematik der Konzernhaftung für Menschenrechtsverletzungen.
Schlüsselwörter
Konzernhaftung, Menschenrechtsverletzungen, Tochtergesellschaften, Haftung, Recht verbundener Unternehmen, Trennungsprinzip, Selbstständigkeit, Durchgriffshaftung, Rechtspolitische Perspektive.
- Quote paper
- Larissa Richter (Author), 2017, Menschenrechtsverletzungen und Konzernhaftung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/448673