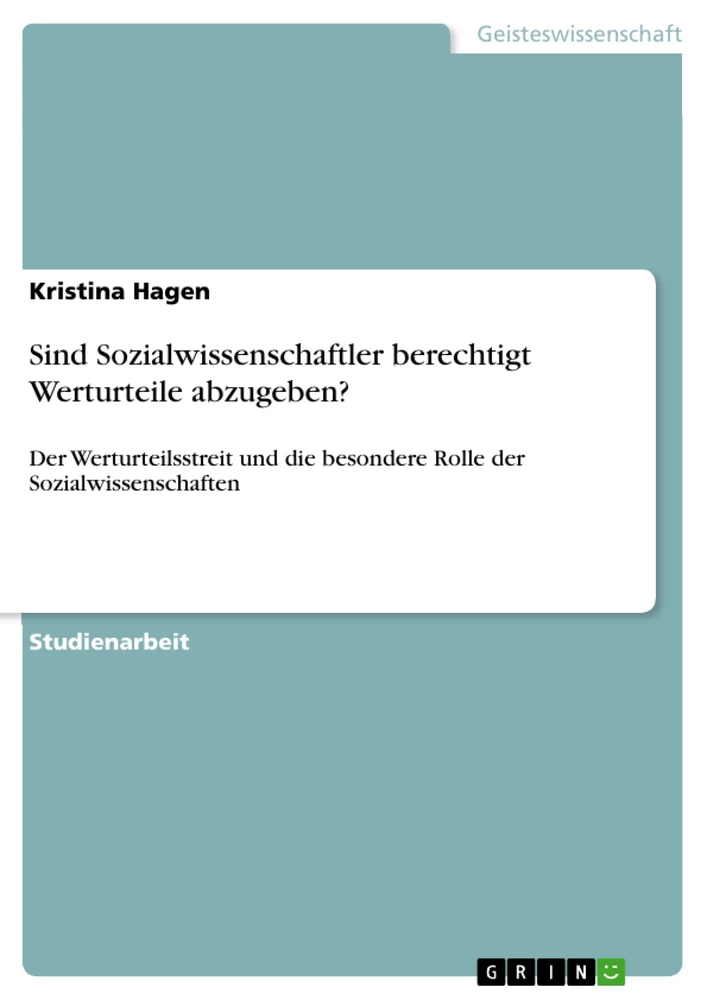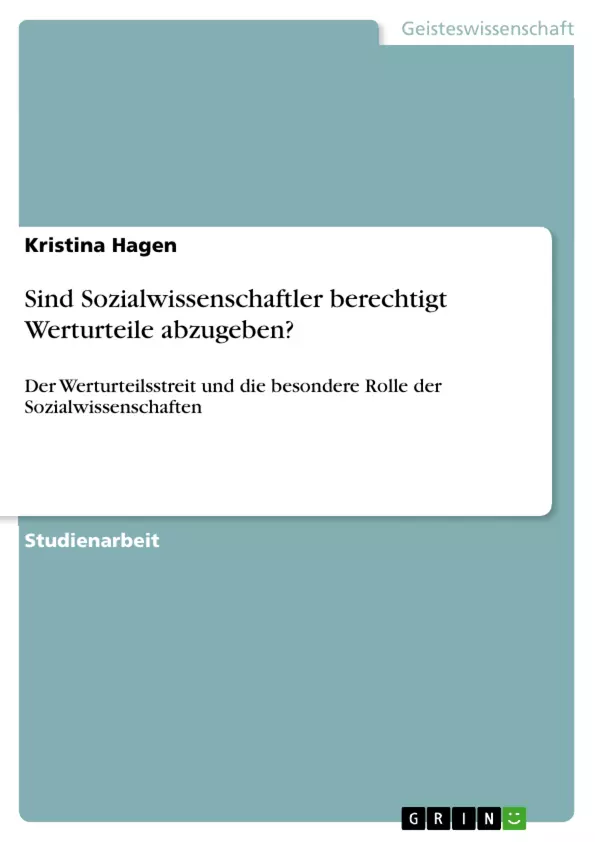Seit langem steht die Frage, ob Wissenschaftler berechtigt sind Werturteile abzugeben, im Raum der Wissenschaft. Als um die Jahrhundertwende die Diskussion um diese Frage – der Werturteilsstreit – zwischen Mitgliedern des Vereins für Sozialpolitik begann, wusste niemand, dass eine einstimmige Antwort auf diese Frage heute immer noch nicht gefunden wäre. In den sechziger Jahren wurde diese Diskussion wieder aufgegriffen. Der Positivismusstreit wurde durch die Beiträge Karl Poppers und Theodor Adorno ausgelöst. Es ging um die Klärung der Frage, ob Wissenschaftler befugt sind Werturteile zu treffen.
In dieser Arbeit wird nicht vorgestellt, wer wann welche Argumente nannte, mit dem Ziel die historische Entwicklung des Werturteilsstreites darzulegen. Es soll auf die wichtigsten Vertreter der gegensätzlichen Positionen eingegangen werden, um ihre Sichtweise zu der Befugnis der Äußerung von Werturteilen in der Wissenschaft nachvollziehen zu können. Der erste Teil dieser Arbeit soll einen Überblick über den Werturteilsstreit schaffen. Was ist der Werturteilsstreit? Was sind Werturteile? Warum spielen Werte überhaupt für die Wissenschaft eine Rolle? In dem zweiten Teil dieser Arbeit werden die Positionen von den zwei Vertretern der Werturteilsfreiheit – Max Weber und Werner Sombart – vorgestellt. Folglich wird dann auf die Positionen zweier Gegner der Werturteilsfreiheit – Eduard Spranger und Gustav von Schmoller – eingegangen. Nach der Vorstellung der beiden Positionen wird die Rolle der Sozialwissenschaften in Bezug auf Werturteile ausgearbeitet, um dann zusammen mit der Kritik an den beiden Positionen die Frage, ob Sozialwissenschaftler berechtigt sind Werturteile abzugeben, zu beantworten.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Der Werturteilsstreit
- 2.1 Definition: Werturteile
- 2.2 Warum spielen Werte für die Wissenschaft eine Rolle?
- 3 Argumente der werturteilsfreien Position
- 3.1 Position von Max Weber
- 3.2 Position von Werner Sombart
- 3.3 Zusammenfassende Position der Vertreter der Werturteilsfreiheit
- 4 Argumente der wertenden Position
- 4.1 Position von Eduard Spranger
- 4.2 Position von Gustav von Schmoller
- 4.3 Zusammenfassende Position der Gegner der Werturteilsfreiheit
- 5 Die besondere Stellung der Sozialwissenschaften in Bezug auf Werturteile
- 6 Sind Sozialwissenschaftler berechtigt Werturteile abzugeben?
- 7 Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Werturteilsstreit in den Sozialwissenschaften, beleuchtet die gegensätzlichen Positionen von Vertretern der werturteilsfreien und wertenden Wissenschaft und analysiert die besondere Rolle der Sozialwissenschaften in Bezug auf Werturteile. Ziel ist es, die Frage zu beantworten, ob Sozialwissenschaftler berechtigt sind, Werturteile abzugeben.
- Der Werturteilsstreit: Die gegensätzlichen Positionen von Vertretern der werturteilsfreien und wertenden Wissenschaft.
- Definition und Rolle von Werturteilen in der wissenschaftlichen Forschung.
- Die Positionen von Max Weber und Werner Sombart (werturteilsfrei).
- Die Positionen von Eduard Spranger und Gustav von Schmoller (wertend).
- Die spezifische Herausforderung von Werturteilen in den Sozialwissenschaften.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Werturteilsstreits ein und skizziert den historischen Kontext der Debatte, beginnend um die Jahrhundertwende und fortgeführt im Positivismusstreit der 1960er Jahre. Sie umreißt den Fokus der Arbeit, der auf der Analyse der wichtigsten Argumente der gegensätzlichen Positionen liegt, anstatt einer historischen Darstellung des Streits. Die Einleitung strukturiert den Aufbau der Arbeit und kündigt die einzelnen Kapitel an.
2 Der Werturteilsstreit: Dieses Kapitel beschreibt den Werturteilsstreit, der sich um die Jahrhundertwende innerhalb des Vereins für Sozialpolitik entfaltete. Es differenziert die beiden gegensätzlichen Lager – die Vertreter der werturteilsfreien und der wertenden Wissenschaft – und nennt einige ihrer wichtigsten Vertreter. Zentral ist die Klärung der Frage, ob Wissenschaftler berechtigt sind, Werturteile oder Sollensaussagen zu treffen, wobei die Bedeutung von Werten für die Sozialwissenschaften von beiden Seiten anerkannt wird. Die Definition von Werturteilen als Bewertungen sozialer Tatsachen basierend auf verinnerlichten Werten wird ebenfalls vorgestellt.
3 Argumente der werturteilsfreien Position: Dieses Kapitel präsentiert die Argumente der werturteilsfreien Position, insbesondere die von Max Weber und Werner Sombart. Webers Konzept der „Wertfreiheit“ wird erläutert, wobei betont wird, dass Werte für die Wissenschaft wichtig sind, aber Tatsachenbehauptungen und Werturteile klar getrennt werden müssen. Die Arbeit hebt Webers Argumentation hervor, dass wissenschaftliche Erkenntnis nicht objektiv sein kann, da das Forschungsinteresse von individuellen Werten geleitet wird, obwohl Werturteile selbst nicht wissenschaftlich beweisbar sind. Die Bedeutung von Webers Forderung nach einer Trennung von Tatsachen und Werturteilen in der Wissenschaft und Lehre wird ebenfalls betont.
4 Argumente der wertenden Position: Hier werden die Argumente der wertenden Position, insbesondere die von Eduard Spranger und Gustav von Schmoller, dargestellt. Das Kapitel beschreibt die gegensätzliche Sichtweise auf die Zulässigkeit von Werturteilen in der wissenschaftlichen Arbeit und den Einbezug von ethischen und normativen Überlegungen in die sozialwissenschaftliche Forschung. Die unterschiedlichen Perspektiven auf die Rolle von Werten in der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung werden detailliert analysiert.
5 Die besondere Stellung der Sozialwissenschaften in Bezug auf Werturteile: Dieses Kapitel befasst sich mit der spezifischen Herausforderung der Werturteilsfrage im Kontext der Sozialwissenschaften. Es analysiert, wie die Einzigartigkeit des Forschungsgegenstandes und die potenziellen Auswirkungen sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse auf die Gesellschaft die Debatte um Werturteile beeinflussen. Die Diskussion um Objektivität und Werturteilsfreiheit wird vor dem Hintergrund der sozialen Praxis und ihrer ethischen Implikationen beleuchtet.
6 Sind Sozialwissenschaftler berechtigt Werturteile abzugeben?: Dieses Kapitel stellt die zentrale Forschungsfrage der Arbeit dar und integriert die vorherigen Kapitel, um eine umfassende Antwort zu geben. Es berücksichtigt die verschiedenen Perspektiven, die Argumente für und gegen Werturteile in den Sozialwissenschaften, sowie die besondere Stellung der Sozialwissenschaften. Eine kritische Auseinandersetzung mit den verschiedenen Positionen ist hier relevant.
Schlüsselwörter
Werturteilsstreit, Werturteile, Wertfreiheit, Max Weber, Werner Sombart, Eduard Spranger, Gustav von Schmoller, Sozialwissenschaften, Objektivität, Sollen, Sein, Wissenschaftstheorie, empirische Forschung.
Häufig gestellte Fragen zum Werturteilsstreit in den Sozialwissenschaften
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Werturteilsstreit in den Sozialwissenschaften. Sie beleuchtet die gegensätzlichen Positionen der Vertreter werturteilsfreier und wertender Wissenschaft, insbesondere die von Max Weber, Werner Sombart, Eduard Spranger und Gustav von Schmoller. Der Fokus liegt auf der Frage, ob Sozialwissenschaftler berechtigt sind, Werturteile abzugeben, und wie die Besonderheit des sozialwissenschaftlichen Forschungsgegenstandes die Debatte beeinflusst.
Welche Positionen werden im Werturteilsstreit vertreten?
Der Werturteilsstreit umfasst zwei Hauptpositionen: Die werturteilsfreie Position, vertreten beispielsweise von Max Weber und Werner Sombart, betont die Trennung von Tatsachenbehauptungen und Werturteilen in der wissenschaftlichen Forschung. Die wertenden Positionen, vertreten zum Beispiel von Eduard Spranger und Gustav von Schmoller, argumentieren für die Einbeziehung ethischer und normativer Überlegungen in die sozialwissenschaftliche Forschung.
Welche Rolle spielen Max Weber und Werner Sombart im Werturteilsstreit?
Max Weber und Werner Sombart vertreten die werturteilsfreie Position. Weber betont die Bedeutung von Werten für die Auswahl des Forschungsthemas, insistiert aber auf der strikten Trennung von Tatsachen und Werturteilen in der wissenschaftlichen Darstellung. Sombart teilt diese Ansicht und unterstützt die Notwendigkeit der Objektivität in der wissenschaftlichen Forschung.
Welche Rolle spielen Eduard Spranger und Gustav von Schmoller im Werturteilsstreit?
Eduard Spranger und Gustav von Schmoller vertreten die wertenden Position. Sie argumentieren, dass Werturteile in den Sozialwissenschaften unvermeidlich und sogar wünschenswert sind, da sozialwissenschaftliche Erkenntnisse immer auch ethische und normative Implikationen haben. Sie betonen die Bedeutung von Werten für die Interpretation von Forschungsergebnissen.
Wie definiert die Arbeit "Werturteile"?
Die Arbeit definiert Werturteile als Bewertungen sozialer Tatsachen, die auf verinnerlichten Werten basieren. Es wird betont, dass diese Bewertungen nicht wissenschaftlich beweisbar sind, aber dennoch eine wichtige Rolle im sozialwissenschaftlichen Kontext spielen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Der Werturteilsstreit, Argumente der werturteilsfreien Position, Argumente der wertenden Position, Die besondere Stellung der Sozialwissenschaften in Bezug auf Werturteile, Sind Sozialwissenschaftler berechtigt Werturteile abzugeben?, und Zusammenfassung und Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen Aspekt des Werturteilsstreits und baut auf den vorherigen Kapiteln auf.
Was ist das zentrale Thema der Arbeit?
Das zentrale Thema ist die Frage, ob und inwieweit Sozialwissenschaftler berechtigt sind, Werturteile abzugeben. Die Arbeit untersucht die Argumente für und gegen Werturteile, analysiert die unterschiedlichen Positionen und kommt zu einem Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Werturteilsstreit, Werturteile, Wertfreiheit, Max Weber, Werner Sombart, Eduard Spranger, Gustav von Schmoller, Sozialwissenschaften, Objektivität, Sollen, Sein, Wissenschaftstheorie, empirische Forschung.
Wann entstand der Werturteilsstreit?
Der Werturteilsstreit entfaltete sich um die Jahrhundertwende innerhalb des Vereins für Sozialpolitik und wurde im Positivismusstreit der 1960er Jahre fortgeführt.
Welche besondere Stellung haben die Sozialwissenschaften im Bezug auf Werturteile?
Die Sozialwissenschaften haben eine besondere Stellung, da ihr Forschungsgegenstand die Gesellschaft ist und ihre Erkenntnisse direkte Auswirkungen auf die Gesellschaft haben können. Dies beeinflusst die Debatte um Objektivität und Werturteilsfreiheit in besonderer Weise.
- Quote paper
- Kristina Hagen (Author), 2017, Sind Sozialwissenschaftler berechtigt Werturteile abzugeben?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/446916