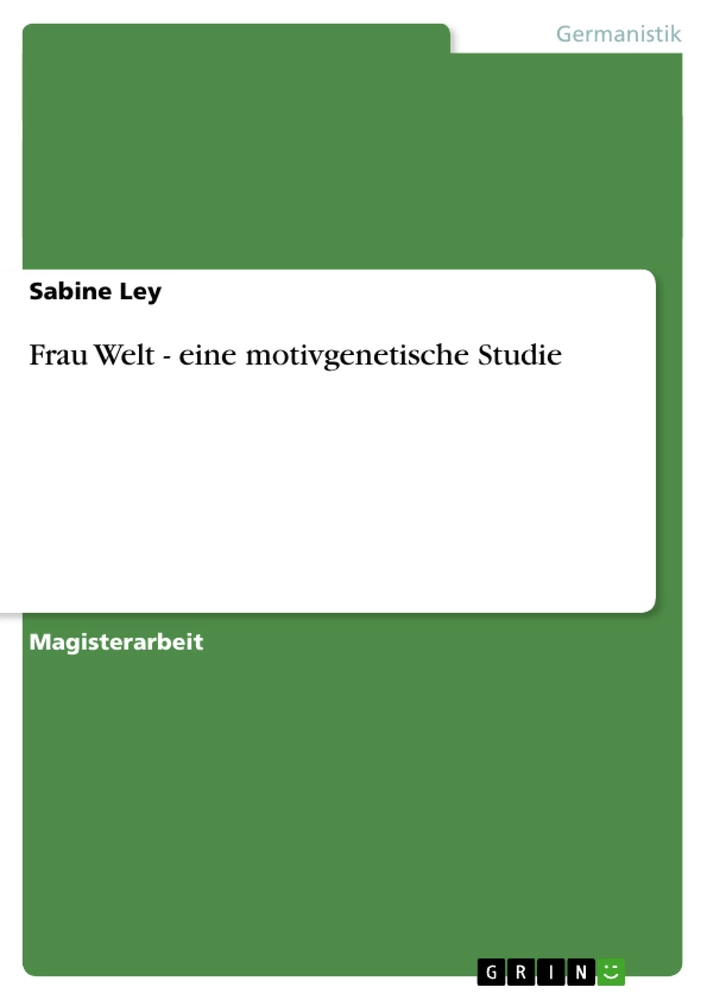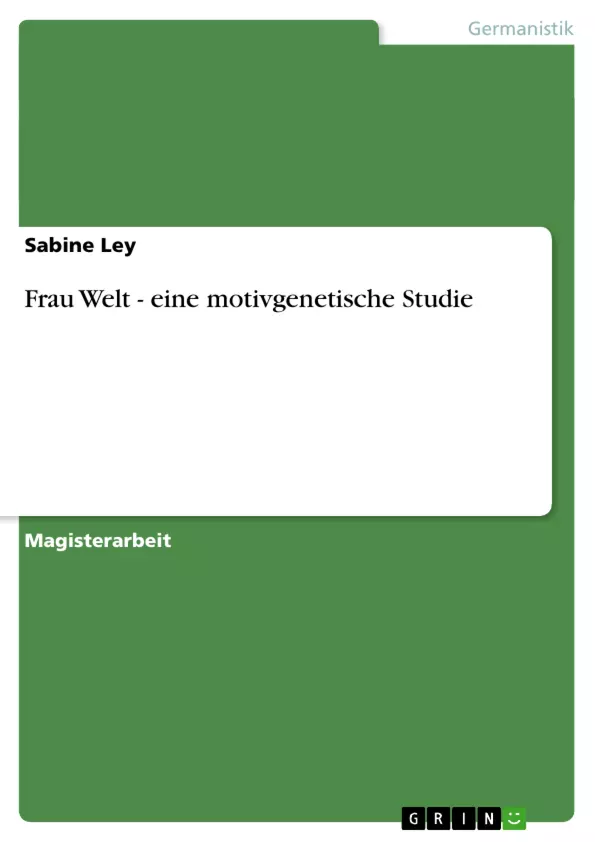”Frˆo Welt, ich hân ze vil gesogen, ich will entwonen, des ist zît. dîn zart hât mich vil nâch betrogen wand er viel süezer fröiden gît. Dô ich dich gesach reht under ougen, dô was dîn schouwen wunderlichn <....> al sunder lougen. doch was der schanden alse vil, dô ich dîn hinden wart gewar, daz ich dich iemer schelten wil.“
Diese Zeilen Walthers von der Vogelweide, entnommen aus dem sogenannten ”Abschied von der Welt“, wertet die Forschung als erstes Auftreten der doppelseitigen Frau Welt in der mittelhochdeutschen Literatur.
Mehr als diese andeutenden Verse brauchte es anscheinend nicht, um den Zeitgenossen Walthers von der Vogelweide diese allegorische Figur vor das innere Auge zu rufen, die wie keine andere vermochte, die Ambivalenz der irdischen Existenz zu verkörpern. Das wesentliche äußere Merkmal der Frau Welt ist ihre Aufspaltung in eine schöne, reich gewandete Vorderseite und eine entstellte, verwesende Rückseite. Die Botschaft bzw. der Gehalt der Allegorie war dem gläubigen Menschen des Mittelalters vollkommen klar: Wer den Schönheiten und Vergnügungen der diesseitigen Welt anhängt und somit sündigt, erhält dafür im jenseitigen Leben den gerechten Lohn; sein Los ist der ewige Tod. Die irdische Existenz bietet nichts als Vergänglichkeit und Trug, und all ihre Schönheiten sind Blendwerk, nur dazu angetan, den Menschen vom eigentlichen Ziel seines Daseins, dem ewigen, jenseitigen Leben bei Gott, abzulenken.
Die Frau Welt-Figur entstammt dem Bereich des contemptus mundi, einer christlichen Spiritualität, die vor dem Hintergrund des Glaubens an die körperliche Auferstehung und in der Erwartung eines ewigen Lebens in der künftigen Welt die Verachtung der diesseitigen predigt. Der Grund für die Ausbildung eines solchen Gegensatzes zwischen irdischer Existenz bzw. der Welt und den göttlichen, himmlischen Sphären ist in der tief im Christentum verwurzelten ontischen Dualismusvorstellung zu suchen: Die irdische Welt und ihre Bewohner sind zwar Gottes Schöpfung, aber durch die Erbsünde von ihm abgefallen und deswegen mit dem Makel der Sündenschuld behaftet. Die Folge der Sünde aber ist der leibliche Tod. Unter rein ethischen Gesichtspunkten betrachtet folgert daraus eine entsprechend negative Bewertung der Welt, der Menschen und ihrer gesamten diesseitigen Existenz: Irdische Unvollkommenheit, Sündhaftigkeit und Vergänglichkeit stehen in direkter Opposition zu göttlicher Vollkommenheit und ewigem Leben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Methodische Grundlagen
- Von Michail Bachtins „dialogicnost“ zu Julia Kristevas „intertextualité“
- Die Folgen
- Text und Intertext
- Autor und Rezipient
- Markierung intertextueller Bezüge
- Intertextualität verschiedensprachiger Texte
- Methodenauswahl nebst einiger Vorbehalte
- Die Personifizierung der fornicatio in den Vitae Patrum – ein mögliches Vorbild für die Frau Welt
- Überlieferung und Rezeption
- De fornicatione und mögliche Referenztexte
- saeculum und gloria mundi – zwei mittellateinische Frau Welt-Gestalten
- Überlieferung
- Ein Vergleich der beiden Exempla
- Die Exempla und das Apophthegma
- Zusammenfassung und Fazit
- „Der Welt Lohn“ Konrads von Würzburg
- Überlieferung
- Konrad von Würzburg und seine literarischen Vorbilder
- Gottfried von Straßburg
- Wirnt von Gravenberg
- Hartmann von Aue
- Walther von der Vogelweide
- Zusammenfassung
- „Der Welt Lohn“ und die mittellateinischen Exempla
- Die Strophen des Guters
- Überlieferung und Struktur
- Der Epigone und sein Vorbild? Der Guter und Konrad von Würzburg
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit „Frau Welt – eine motivgenetische Studie“ untersucht die Entwicklung der Frau Welt-Figur in der mittellateinischen und mittelhochdeutschen Literatur. Ziel ist es, die Entstehung und Entwicklung dieses Motivs zu erforschen, indem die Intertextualität der Werke und die Verwendung von allegorischen Figuren analysiert werden.
- Die Entstehung des Motivs der Frau Welt als Allegorie für die irdische Vergänglichkeit
- Die Rezeption des Motivs in verschiedenen literarischen Werken des Mittelalters
- Die Verwendung von Intertextualität und literarischen Vorbildern in der Gestaltung der Frau Welt-Figur
- Die Bedeutung des Motivs für die christliche Spiritualität des Mittelalters
- Die Rolle des ontischen Dualismus und des contemptus mundi für die Entwicklung des Motivs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Frau Welt-Figur und ihre Bedeutung in der mittelalterlichen Literatur ein. Kapitel 1 beleuchtet die methodischen Grundlagen der Studie, insbesondere die Relevanz von Intertextualität und literarischen Vorbildern für die Analyse des Motivs. Kapitel 2 untersucht die Personifizierung der fornicatio in den Vitae Patrum als ein mögliches Vorbild für die Frau Welt-Figur. Kapitel 3 beleuchtet zwei mittellateinische Frau Welt-Gestalten und analysiert deren Vergleichbarkeit und Bedeutung. Kapitel 4 fokussiert auf „Der Welt Lohn“ Konrads von Würzburg und dessen Bezug zu den mittellateinischen Exempla. Kapitel 5 behandelt die Strophen des Guters und deren Beziehung zu Konrad von Würzburgs Werk. Die Zusammenfassung und das Fazit, die in dieser Vorschau nicht berücksichtigt werden, sollen die Ergebnisse der Untersuchung zusammenfassen und abschließend bewerten.
Schlüsselwörter
Frau Welt, Motivgenetik, Intertextualität, mittellateinische Literatur, mittelhochdeutsche Literatur, Vitae Patrum, fornicatio, contemptus mundi, ontischer Dualismus, saeculum, gloria mundi, Konrad von Würzburg, „Der Welt Lohn“, Strophen des Guters, Epigone, literarische Vorbilder.
- Quote paper
- Sabine Ley (Author), 2004, Frau Welt - eine motivgenetische Studie, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/44665