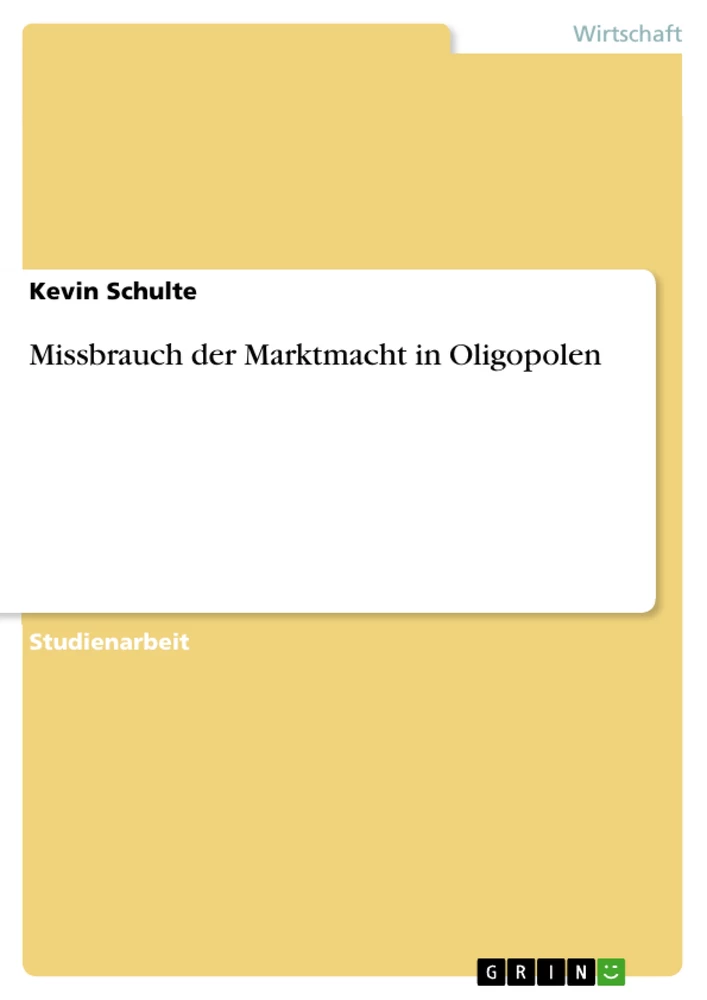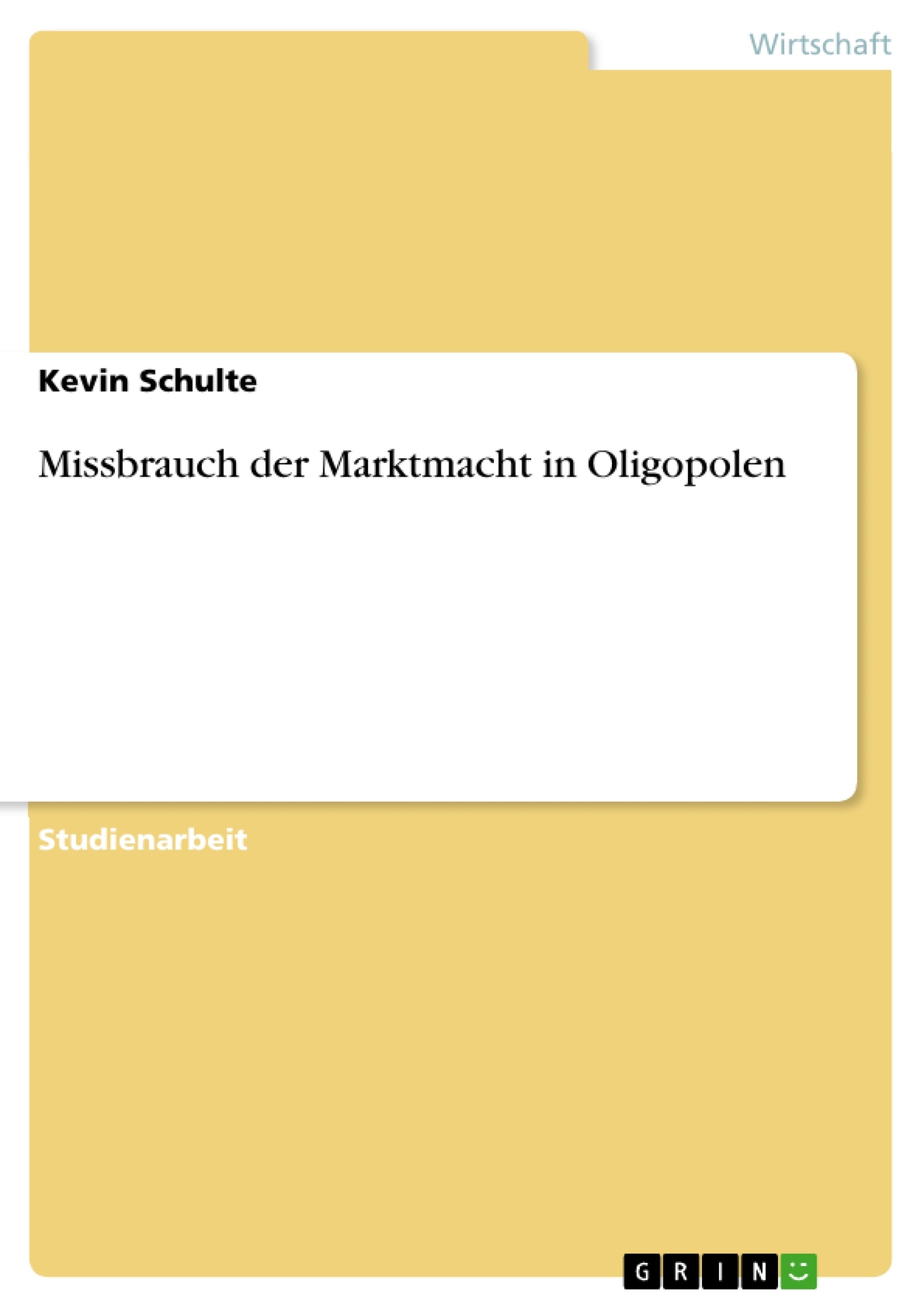Durch den aktuellen Fall von Edeka und Kaiser’s Tengelmann ist die Thematik von Oligopolen in den Medien und der Politik wieder stärker in den Fokus getreten. Tatsächlich sind verschiedene Arten von Oligopolen in weiten Teilen der Wirtschaft vertreten. Bekannte Beispiele hierfür wären Preisabsprachen bei Tankstellen oder bei Stromanbietern. Beides Bekannte Beispiele, die jedoch einen komplett anderen Ansatz verfolgen. Gerade deswegen steht diese Marktform vor allem bei Politikern und Verbraucherschützern häufig in der Kritik. Da es aufgrund von der Beschaffung der Marktform oftmals zu Preiserhöhungen kommt, die über dem Marktüblichen Niveau liegen und denen nur schwer entgegengewirkt werden kann. Bei sehr engen Oligopolen wird deswegen auch häufig von Kartellen geredet. Diese verhalten sich wie Monopolisten um so den Preis und das Angebot frei gestalten können und so den Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland massiv schadet.
Deswegen versucht die vorliegende Arbeit, die vorherrschenden Theorien und Vorgehensweisen von Oligopolen darzustellen und setzt sich mit den daraus resultierenden Problemen auseinander. Zur Veranschaulichung wird sich auch mit der aktuellen Thematik von Edeka und Kaiser’s Tengelmann auseinandergesetzt. Daher wird zu Beginn der Arbeit der Begriff Oligopol definiert und die Entstehungsgeschichte/-entwicklung dargestellt. Im nachfolgenden Kapitel wird diese Marktform von Polypolen und Monopolen abgegrenzt. Im vierten Abschnitt, werden die sechs vorherrschenden Theorien dargestellt und Stärken und Schwächen der jeweiligen Modelle aufgezeigt. Auf der Basis wird analysiert wie die Marktmacht Zustanden kommt, sie beeinflusst wird und wie man diese Veränderungen messbar macht. Danach wird auf die verschiedenen Arten von Oligopolen eingegangen und ihre Auswirkungen auf den Markt betrachtet. Dies wird am Beispiel von Edeka und Kaiser’s Tengelmann veranschaulicht. Abschließend wird auf die rechtliche Problematik von Oligopolen in Deutschland eingegangen und wie sehr sich die Regelungen im internationalen Vergleich unterscheiden. Zum Schluss wird sich im Fazit kritisch mit den Auswirkungen von Oligopolen auseinandergesetzt und erörtert, welche Gefahren wirklich von Oligopolen ausgehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definitionen
- 2.1 Oligopol
- 2.2 Abgrenzung zum Monopol und Polypol
- 3. Klassische Theorien zur Bildung von Oligopolen
- 3.1 Das Modell von Cournot
- 3.2 Das Modell von Bertrand
- 3.3 Das Modell von Stackelberg
- 3.4 Das Modell von Kreps-Scheinkman
- 3.5 Das Hotelling-Modell
- 4. Marktmacht
- 4.1 Definition und Messung von Marktmacht
- 4.2 Auswirkungen von Marktmacht
- 5. Funktionsweisen von Oligopolen
- 5.1 Arten der Strategiebildung in Oligopolen
- 5.2 Am Beispiel des Lebensmitteleinzelhandels in Deutschland
- 6. Rechtliche Regelungen in Deutschland
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Thematik des Oligopols, insbesondere den Missbrauch von Marktmacht in dieser Marktform. Sie analysiert die zugrundeliegenden Theorien, die Funktionsweisen von Oligopolen und die daraus resultierenden Probleme. Ein besonderer Fokus liegt auf den Auswirkungen auf den Markt und die rechtlichen Regelungen in Deutschland.
- Definition und Abgrenzung des Oligopols von Monopol und Polypol
- Darstellung klassischer Oligopoltheorien (Cournot, Bertrand, Stackelberg, Kreps-Scheinkman, Hotelling)
- Analyse der Marktmacht in Oligopolen: Entstehung, Messung und Auswirkungen
- Funktionsweisen von Oligopolen und Strategien der Anbieter
- Rechtliche Regulierung von Oligopolen in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Oligopols ein, motiviert durch den Fall Edeka/Kaiser's Tengelmann. Sie hebt die Relevanz des Themas für Politik und Verbraucherschutz hervor, da Oligopolstrukturen oft zu überhöhten Preisen führen. Die Arbeit skizziert ihren Aufbau und die angestrebte Auseinandersetzung mit den Theorien, Funktionsweisen und Problemen von Oligopolen, unter Einbezug des Fallbeispiels Edeka/Kaiser's Tengelmann.
2. Definitionen: Dieses Kapitel definiert den Begriff Oligopol im Kontext von Monopol und Polypol. Es erklärt die oligopolistische Interdependenz, die sich aus der gegenseitigen Abhängigkeit der wenigen Anbieter ergibt. Der Einfluss von Preisstrategien auf homogenen und heterogenen Märkten wird erläutert, und die Schwierigkeiten bei der klaren Abgrenzung zwischen "wenigen" und "vielen" Anbietern werden angesprochen.
3. Klassische Theorien zur Bildung von Oligopolen: Dieses Kapitel stellt verschiedene klassische Modelle zur Erklärung der Entstehung und des Verhaltens von Oligopolen vor (Cournot, Bertrand, Stackelberg, Kreps-Scheinkman, Hotelling). Es werden die Annahmen, die Vorhersagen und die Stärken und Schwächen der jeweiligen Modelle analysiert und verglichen. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der Entscheidungsfindungsprozesse unter Bedingungen der strategischen Interdependenz.
4. Marktmacht: Dieses Kapitel widmet sich der Definition und Messung von Marktmacht in Oligopolen. Es untersucht, wie Marktmacht entsteht, welche Faktoren sie beeinflussen und wie sich Veränderungen messbar machen lassen. Es wird auf die Auswirkungen von Marktmacht auf Preise, Konsumenten und den Wettbewerb eingegangen.
5. Funktionsweisen von Oligopolen: Hier werden verschiedene Arten der Strategiebildung in Oligopolen beleuchtet, darunter Preiswettbewerb, Produktdifferenzierung und strategische Allianzen. Die Anwendung dieser Strategien wird anhand des Beispiels des deutschen Lebensmitteleinzelhandels, insbesondere im Kontext von Edeka und Kaiser's Tengelmann, veranschaulicht und analysiert.
6. Rechtliche Regelungen in Deutschland: Dieses Kapitel befasst sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen für Oligopolstrukturen in Deutschland und betrachtet den internationalen Vergleich. Es untersucht, wie der Gesetzgeber versucht, den Missbrauch von Marktmacht zu verhindern und einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten.
Schlüsselwörter
Oligopol, Monopol, Polypol, Marktmacht, Preisbildung, strategische Interdependenz, Wettbewerbspolitik, Kartellrecht, Marktmodelle (Cournot, Bertrand, Stackelberg), Lebensmitteleinzelhandel, Edeka, Kaiser's Tengelmann, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Oligopolstrukturen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Oligopolstrukturen, insbesondere den Missbrauch von Marktmacht, im Fokus auf den deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Sie analysiert die zugrundeliegenden ökonomischen Theorien, die Funktionsweisen von Oligopolen und die daraus resultierenden Probleme für den Markt und die Konsumenten. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den rechtlichen Regelungen in Deutschland und dem internationalen Vergleich.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst eine umfassende Betrachtung des Oligopols, beginnend mit Definitionen und Abgrenzungen zu Monopol und Polypol. Sie präsentiert und analysiert klassische Oligopoltheorien (Cournot, Bertrand, Stackelberg, Kreps-Scheinkman, Hotelling), untersucht die Entstehung, Messung und Auswirkungen von Marktmacht und beleuchtet verschiedene Strategien der Anbieter (Preiswettbewerb, Produktdifferenzierung, strategische Allianzen). Ein wichtiger Aspekt ist die rechtliche Regulierung von Oligopolen in Deutschland, inklusive des Vergleichs mit internationalen Regelungen.
Welche Theorien werden vorgestellt und analysiert?
Die Arbeit stellt verschiedene klassische Oligopolmodelle vor, darunter das Cournot-Modell, das Bertrand-Modell, das Stackelberg-Modell, das Kreps-Scheinkman-Modell und das Hotelling-Modell. Für jedes Modell werden Annahmen, Vorhersagen, Stärken und Schwächen analysiert und verglichen. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der Entscheidungsfindungsprozesse unter Bedingungen der strategischen Interdependenz.
Wie wird Marktmacht definiert und gemessen?
Die Arbeit definiert Marktmacht im Kontext von Oligopolen und untersucht, wie sie entsteht und welche Faktoren sie beeinflussen. Methoden zur Messung von Marktmacht werden erläutert und die Auswirkungen von Marktmacht auf Preise, Konsumenten und den Wettbewerb werden analysiert.
Welche Strategien werden in Oligopolen eingesetzt?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Strategien der Anbieter in Oligopolmärkten, darunter Preiswettbewerb, Produktdifferenzierung und strategische Allianzen. Diese Strategien werden anhand des Beispiels des deutschen Lebensmitteleinzelhandels veranschaulicht und analysiert, insbesondere im Kontext von Edeka und Kaiser's Tengelmann.
Welche rechtlichen Regelungen werden in Deutschland betrachtet?
Die Arbeit befasst sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen für Oligopolstrukturen in Deutschland und im internationalen Vergleich. Sie untersucht, wie der Gesetzgeber versucht, den Missbrauch von Marktmacht zu verhindern und einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten.
Welches Beispiel wird im Detail betrachtet?
Die Arbeit verwendet den Fall Edeka/Kaiser's Tengelmann als Fallbeispiel, um die Funktionsweisen und Auswirkungen von Oligopolen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel zu illustrieren. Dieser Fall dient der Veranschaulichung der theoretischen Konzepte.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Oligopol, Monopol, Polypol, Marktmacht, Preisbildung, strategische Interdependenz, Wettbewerbspolitik, Kartellrecht, Marktmodelle (Cournot, Bertrand, Stackelberg), Lebensmitteleinzelhandel, Edeka, Kaiser's Tengelmann, Deutschland.
- Quote paper
- Kevin Schulte (Author), 2016, Missbrauch der Marktmacht in Oligopolen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/445661