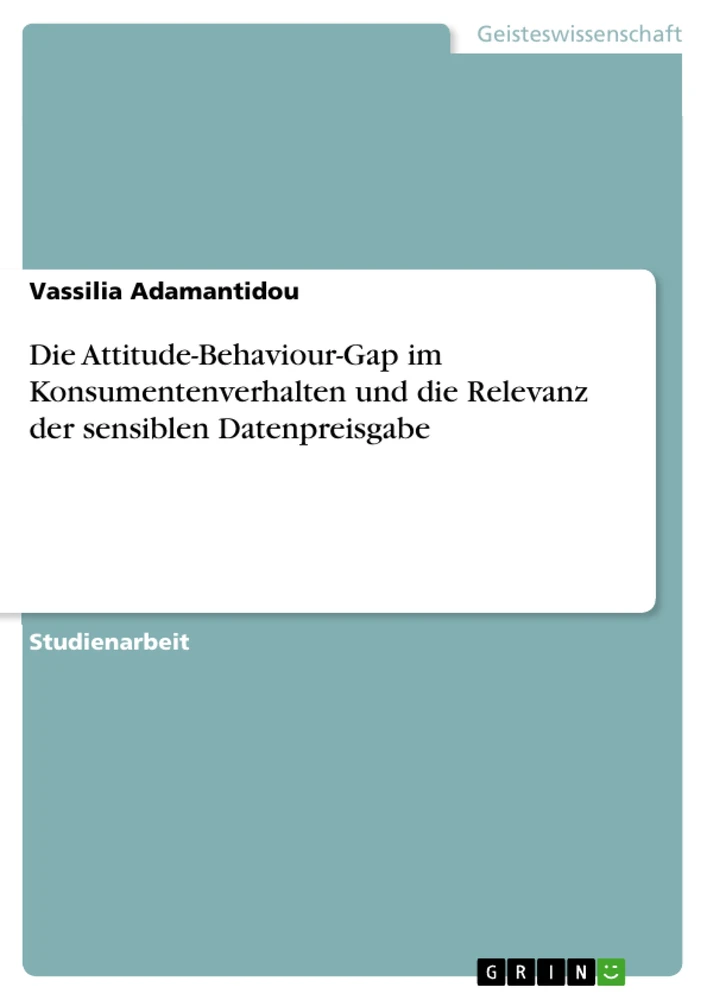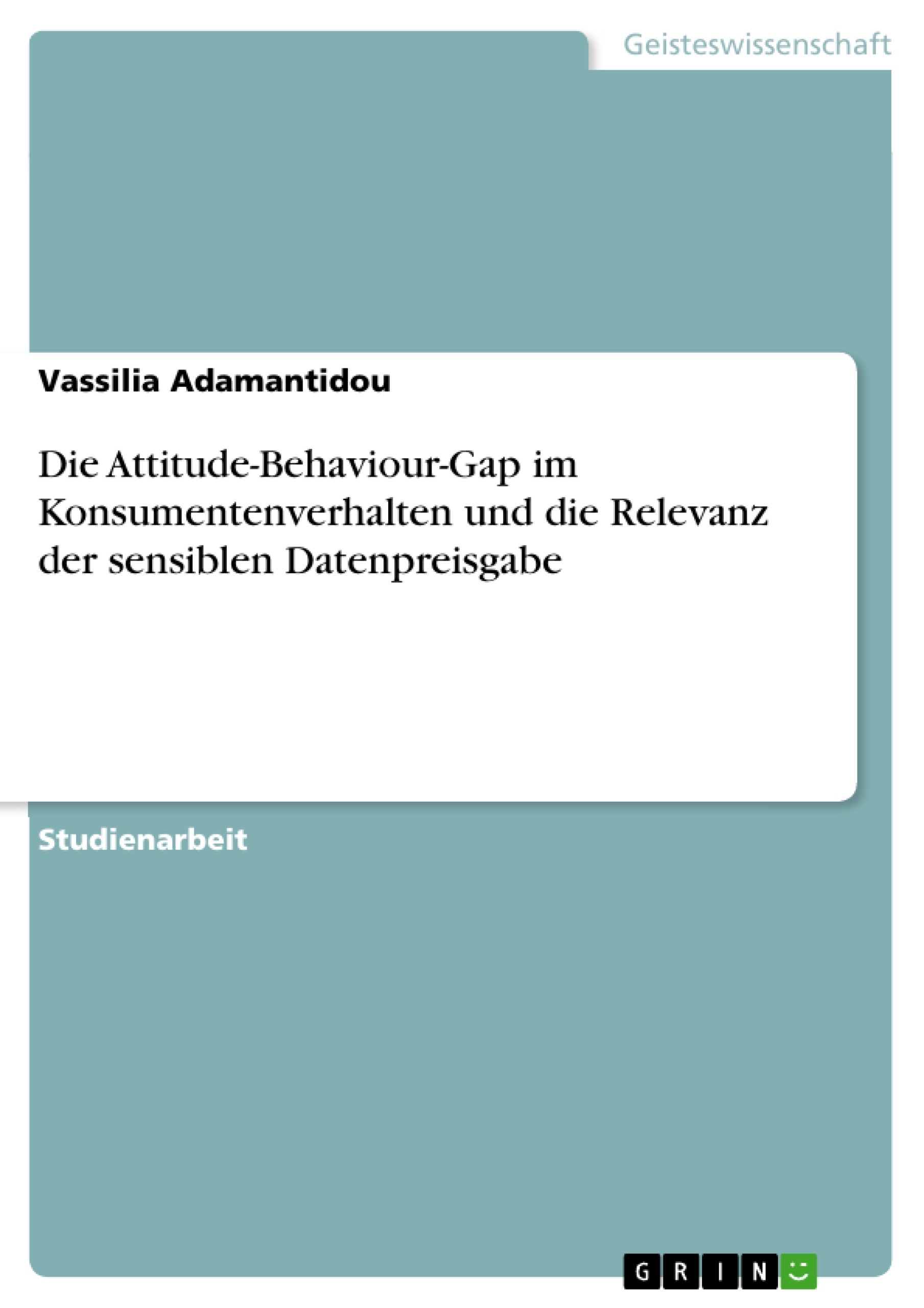Unternehmen sammeln und nutzen regelmäßig individuelle Konsumenteninformationen zur Erstellung von detaillierten Profilen. Diese werden dann beispielsweise zur Verbesserung oder Anpassung von Dienstleistungen und Produkten an die Bedürfnisse der Konsumenten herangezogen. Konsumenten sind dadurch einem ständigen Zielkonflikt ausgesetzt: Sollten sie ihre persönlichen Daten preisgeben, um verbesserte Leistungen zu erhalten oder vermeiden sie die Offenlegung der persönlichen Informationen, da diese mit Unsicherheiten über die Verwendung und der Angst vor einem möglichen Datenmissbrauch einhergeht. Diese Sorge um die eigene Privatsphäre betrifft die Mehrheit der Konsumenten. Weltweit sind 56% der Konsumenten besorgt oder extrem besorgt darüber, wie Unternehmen mit ihren persönlichen Daten umgehen. Beobachtungen zeigen allerdings, dass die Befürchtung des Datenmissbrauchs nicht durch ein entsprechendes Verhalten der Konsumenten widergespiegelt wird. Stattdessen werden unbekümmert persönliche Informationen preisgegeben und der Schutz der eigenen Daten vernachlässigt. Dieser Widerspruch zwischen dem geäußerten Vorhaben einerseits und dem konträrem tatsächlichem Verhalten andererseits wird als Attitude-Behavior-Gap bezeichnet. Wenn es sich um einen solchen Widerspruch in Bezug auf die Preisgabe von persönlichen Daten im Onlinekontext handelt, nennt man diese Inkonsistenz auch „Privacy-Paradox“. Der Fokus dieser Arbeit liegt darauf, die vorhandene Literatur zur Attitude-Behavior-Gap im Konsumentenverhalten bezüglich der sensiblen Datenpreisgabe darzustellen. Diese Arbeit differenziert nicht zwischen dem Verhalten von Konsumenten des stationären Handels und des Online-Shoppings, sondern fasst entsprechende Ergebnisse aus beiden Bereichen zusammen. Dazu wird in einem ersten Schritt die theoretische Grundlage geschaffen, um die zugrundeliegende Theorie und die in dieser Arbeit verwendete Begriffe zu verstehen. Als nächstes werden Studienergebnisse zur Existenz der Attitude-Behavior-Gap vorgestellt und anschließend mögliche Erklärungen für die Abweichung zwischen der Haltung und dem tatsächlichen Verhalten von Konsumenten geschildert. Abschließend wird aufgezeigt, welche Implikationen sich dadurch für das Marketing ableiten lassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Hintergrund: Theorie des geplanten Verhaltens
- Die Attitude-Behavior-Gap im Kontext der sensiblen Datenpreisgabe
- Empirische Belege für die Attitude-Behavior-Gap
- Erklärung der Attitude-Behavior-Gap
- Bedeutung für das Marketing
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Attitude-Behavior-Gap im Konsumentenverhalten hinsichtlich der Preisgabe sensibler Daten. Ziel ist die Darstellung relevanter Literatur und die Erläuterung der Diskrepanz zwischen geäußerten Bedenken zum Datenschutz und dem tatsächlichen Verhalten der Konsumenten. Die Arbeit berücksichtigt sowohl den stationären als auch den Online-Handel.
- Die Attitude-Behavior-Gap im Kontext sensibler Daten
- Empirische Belege für die Diskrepanz zwischen Einstellung und Verhalten
- Erklärungsansätze für die Attitude-Behavior-Gap
- Die Theorie des geplanten Verhaltens als theoretische Grundlage
- Marketingimplikationen der Attitude-Behavior-Gap
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Attitude-Behavior-Gap im Konsumentenverhalten bezüglich der Preisgabe sensibler Daten ein. Sie beschreibt den Zielkonflikt der Konsumenten zwischen dem Wunsch nach besseren Leistungen durch Datenpreisgabe und der Angst vor Datenmissbrauch. Die Einleitung hebt den Widerspruch zwischen geäußerten Bedenken und tatsächlichem Verhalten hervor und definiert den "Privacy-Paradox". Der Fokus der Arbeit wird auf die Darstellung bestehender Literatur und die Zusammenfassung von Ergebnissen aus stationärem und Online-Handel gelegt.
Theoretischer Hintergrund: Theorie des geplanten Verhaltens: Dieses Kapitel beschreibt die Theorie des geplanten Verhaltens als theoretische Grundlage der Arbeit. Es erläutert, wie Intentionen durch Einstellungen, soziale Normen und wahrgenommene Verhaltenskontrolle beeinflusst werden und wie die Intention als Prädiktor für das Verhalten dient. Der Unterschied zwischen Einstellung und Intention wird betont, und es wird erklärt, warum auch Literatur zur Intention-Behavior-Gap herangezogen wird, da diese die relevante Diskrepanz zwischen geäußerten Bedenken und tatsächlichem Verhalten untersucht.
Die Attitude-Behavior-Gap im Kontext der sensiblen Datenpreisgabe: Dieses Kapitel präsentiert empirische Belege für die Attitude-Behavior-Gap. Es zeigt, dass Konsumenten unterschiedlich mit verschiedenen Informationskategorien umgehen und Bedenken hinsichtlich sensibler Daten (Einkommen, Standort etc.) äußern, diese aber dennoch preisgeben. Studien belegen, dass Konsumenten mehr Informationen preisgeben als angegeben und oft wenig Aufwand betreiben, um Informationen über die Datenverwendung zu sammeln. Auch im stationären Handel wird die Diskrepanz zwischen Einstellung und Verhalten bestätigt.
Bedeutung für das Marketing: (Dieser Abschnitt fehlt im Ausgangstext und kann daher nicht zusammengefasst werden.)
Schlüsselwörter
Attitude-Behavior-Gap, Datenschutz, sensible Daten, Konsumentenverhalten, Theorie des geplanten Verhaltens, Privacy-Paradox, Online-Shopping, stationärer Handel, Datenpreisgabe, Informationsasymmetrie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Attitude-Behavior-Gap bei der Preisgabe sensibler Daten
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Diskrepanz zwischen der Einstellung von Konsumenten zum Datenschutz und ihrem tatsächlichen Verhalten bei der Preisgabe sensibler Daten im stationären und Online-Handel. Sie analysiert die sogenannte "Attitude-Behavior-Gap" im Kontext des Datenschutzes.
Welche theoretische Grundlage wird verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Theorie des geplanten Verhaltens (Theory of Planned Behavior), um die Intentionen und das Verhalten der Konsumenten hinsichtlich der Datenpreisgabe zu erklären. Der Fokus liegt auf dem Einfluss von Einstellungen, sozialen Normen und der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle auf die Intention und letztendlich das Verhalten.
Welche empirischen Belege werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert empirische Belege, die die Attitude-Behavior-Gap im Umgang mit sensiblen Daten belegen. Es wird gezeigt, dass Konsumenten trotz geäußerter Bedenken sensible Daten (wie Einkommen oder Standort) preisgeben und weniger Aufwand betreiben, als sie angeben, um Informationen über die Datenverwendung zu sammeln. Diese Diskrepanz wird sowohl im Online- als auch im stationären Handel beobachtet.
Was ist der "Privacy-Paradox"?
Der "Privacy-Paradox" beschreibt den Widerspruch zwischen den geäußerten Bedenken der Konsumenten zum Datenschutz und ihrem tatsächlichen Verhalten, welches oft mit einer Preisgabe sensibler Daten einhergeht, obwohl die Angst vor Datenmissbrauch besteht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zum theoretischen Hintergrund (Theorie des geplanten Verhaltens), ein Kapitel zur Attitude-Behavior-Gap im Kontext sensibler Daten, und ein Kapitel zur Bedeutung für das Marketing (welches im vorliegenden Auszug fehlt).
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Attitude-Behavior-Gap, Datenschutz, sensible Daten, Konsumentenverhalten, Theorie des geplanten Verhaltens, Privacy-Paradox, Online-Shopping, stationärer Handel, Datenpreisgabe, Informationsasymmetrie.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die relevante Literatur zum Thema Attitude-Behavior-Gap im Kontext der Preisgabe sensibler Daten darzustellen und die Diskrepanz zwischen geäußerten Bedenken und tatsächlichem Verhalten der Konsumenten zu erläutern.
Wie wird die Intention-Behavior-Gap berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht auch Literatur zur Intention-Behavior-Gap mit ein, da diese ebenfalls die Diskrepanz zwischen geäußerten Absichten und dem tatsächlichen Verhalten untersucht, was für das Verständnis der Attitude-Behavior-Gap relevant ist.
- Quote paper
- Vassilia Adamantidou (Author), 2018, Die Attitude-Behaviour-Gap im Konsumentenverhalten und die Relevanz der sensiblen Datenpreisgabe, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/439477