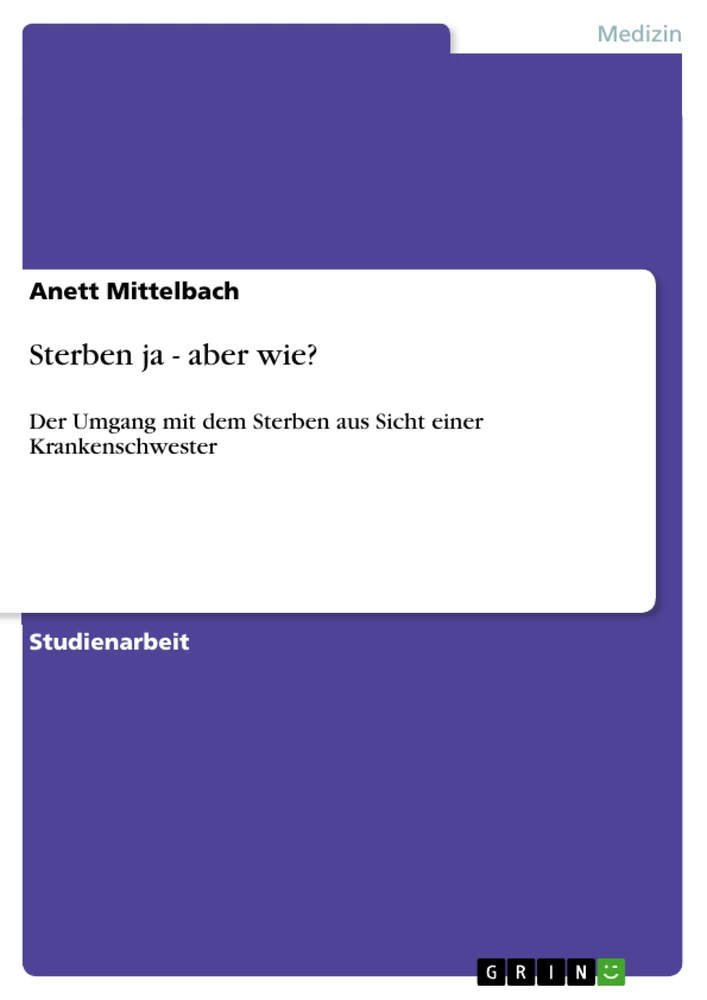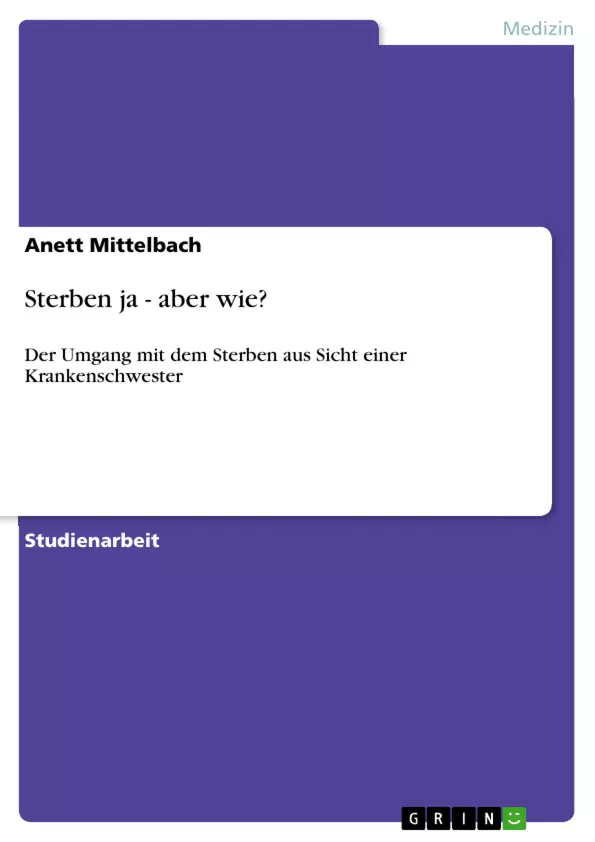Wie wird in Deutschland gestorben? Eine Krankenschwester berichtet über ihre mehr als dreißigjährigen Erfahrungen im Gesundheitswesen und bringt persönliche Fallbeispiele ein.
Beschrieben wird unter anderem die Tätigkeit im Krankenhaus und Pflegeheim, sowie im Hospiz. Sie möchte damit auf die schwere körperliche und emotionale Arbeit der Pflegenden aufmerksam machen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorstellung und Einführung
- Humor
- Meine Wünsche - ein Reim
- Der Tod, das Sterben – ein Streifzug durch die Geschichte
- Sterben in Würde als gemeinschaftliche Aufgabe
- Fallbeispiele
- Krankenhaus 1986
- Krankenhaus 1989
- Arztpraxis 2000
- Pflegeheim 2005
- Palliative Care 2008
- Sterben im Hospiz 2010 - 2015
- Mein Fazit
- Ausklang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschreibt die persönliche Sicht der Autorin Anett Mittelbach auf die Entwicklung der Sterbekultur, basierend auf ihren 32-jährigen Erfahrungen im Gesundheitswesen. Die Arbeit beleuchtet den Umgang mit Sterben und Tod, den Einfluss persönlicher Erlebnisse auf die berufliche Entwicklung und die Bedeutung von Würde im Sterbeprozess.
- Der persönliche Umgang mit Tod und Sterben
- Die Entwicklung der Sterbekultur in Deutschland
- Würdevolles Sterben als gemeinschaftliche Aufgabe
- Die Rolle von Humor im Umgang mit Trauer und Verlust
- Wünsche und Perspektiven für die Zukunft
Zusammenfassung der Kapitel
Vorstellung und Einführung: Die Autorin, Anett Mittelbach, eine Krankenschwester mit langjähriger Erfahrung im Hospiz, schildert ihre persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema Sterben und Tod. Frühkindliche Traumata und der Selbstmord ihrer Mutter prägten ihren Werdegang und führten sie zu einer intensiven Beschäftigung mit würdevollem Sterben. Sie beschreibt ihren beruflichen Weg, ihre Weiterbildungen im Bereich Palliative Care und Hospiz, und betont die Wichtigkeit einer wertschätzenden Begleitung Sterbender und ihrer Angehörigen. Der Text legt den Grundstein für die weiteren Kapitel, indem er den persönlichen Hintergrund der Autorin und ihre Motivation für die Arbeit erläutert.
Humor: Dieses Kapitel betont die Bedeutung von Humor als Bewältigungsstrategie im Umgang mit dem Thema Tod und Sterben. Die Autorin argumentiert, dass Humor, selbst der "schwarze" Humor, helfen kann, die oft überwältigenden Gefühle von Trauer, Schmerz und Hilflosigkeit zu verarbeiten und eine gesunde Distanz zum Thema zu gewinnen. Sie beschreibt die positiven körperlichen und seelischen Auswirkungen von Lachen und dessen Bedeutung für die Gemeinschaft und den Zusammenhalt im Team. Der Humor dient hier als Kontrastprogramm zur Schwere des Themas und unterstreicht die Notwendigkeit einer ausgewogenen Betrachtungsweise.
Meine Wünsche - ein Reim: In diesem lyrischen Abschnitt formuliert die Autorin ihre persönlichen Wünsche für ihren eigenen Tod. Sie wünscht sich ein sanftes Ableben ohne Schmerzen, inmitten von Geborgenheit und natürlichen Elementen. Ihre Wünsche sind geprägt von einer tiefen Sehnsucht nach Frieden und der Präsenz geliebter Menschen. Der Reim bietet einen intimen und emotionalen Einblick in die Gedanken und Gefühle der Autorin und kontrastiert den sachlichen Ton der anderen Kapitel.
Der Tod, das Sterben – ein Streifzug durch die Geschichte: (Leider fehlt der Textinhalt zu diesem Kapitel in der Vorlage. Eine Zusammenfassung ist daher nicht möglich.)
Sterben in Würde als gemeinschaftliche Aufgabe: (Leider fehlt der Textinhalt zu diesem Kapitel in der Vorlage. Eine Zusammenfassung ist daher nicht möglich.)
Fallbeispiele: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Fallbeispiele aus der beruflichen Praxis der Autorin, die den Umgang mit Sterben und Tod in unterschiedlichen Einrichtungen (Krankenhaus, Arztpraxis, Pflegeheim, Hospiz) beleuchten. Die Beispiele illustrieren die Unterschiede in der Sterbekultur und die Bedeutung einer individuellen, wertschätzenden Begleitung der Patienten und ihrer Angehörigen. Die einzelnen Fallbeispiele, obwohl nur kurz angedeutet, zeigen die Bandbreite der Erfahrungen der Autorin und unterstreichen die Notwendigkeit von Verbesserungen in der Versorgung Sterbender.
Schlüsselwörter
Sterben, Tod, Hospiz, Palliative Care, Sterbekultur, Würde, Trauer, Humor, persönliche Erfahrung, Angehörige, professionelle Begleitung, Selbstmord, Traumata.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Anett Mittelbach: Persönliche Erfahrungen mit Sterben und Tod"
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit von Anett Mittelbach, einer Krankenschwester mit langjähriger Erfahrung im Hospizbereich, bietet eine persönliche Perspektive auf die Entwicklung der Sterbekultur in Deutschland. Sie basiert auf ihren 32-jährigen Erfahrungen im Gesundheitswesen und beleuchtet den Umgang mit Sterben und Tod, den Einfluss persönlicher Erlebnisse auf ihre berufliche Entwicklung und die Bedeutung von Würde im Sterbeprozess. Die Arbeit umfasst eine Einführung, Kapitel zu Humor im Umgang mit dem Tod, persönliche Wünsche der Autorin, einen historischen Überblick über das Sterben (leider unvollständig in der vorliegenden Version), ein Kapitel zu würdevollem Sterben als gemeinschaftliche Aufgabe (ebenfalls unvollständig), Fallbeispiele aus verschiedenen Einrichtungen und ein Fazit.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf den persönlichen Umgang mit Tod und Sterben, die Entwicklung der Sterbekultur in Deutschland, würdevolles Sterben als gemeinschaftliche Aufgabe, die Rolle von Humor im Umgang mit Trauer und Verlust sowie die Wünsche und Perspektiven der Autorin für die Zukunft. Es werden frühkindliche Traumata und der Selbstmord der Mutter als prägende Erlebnisse genannt, die die Autorin zu ihrer intensiven Beschäftigung mit dem Thema führten.
Welche Kapitel sind enthalten und worum geht es darin?
Die Hausarbeit beinhaltet Kapitel zu Vorstellung und Einführung (persönliche Geschichte der Autorin und Motivation), Humor als Bewältigungsstrategie, einem lyrischen Abschnitt mit persönlichen Wünschen zum eigenen Tod, einem historischen Überblick über Sterben und Tod (unvollständig), einem Kapitel über würdevolles Sterben als gemeinschaftliche Aufgabe (unvollständig), Fallbeispielen aus der Praxis der Autorin (Krankenhaus, Arztpraxis, Pflegeheim, Hospiz) und einem Fazit.
Welche Fallbeispiele werden vorgestellt?
Die Fallbeispiele stammen aus der beruflichen Praxis der Autorin und illustrieren den Umgang mit Sterben und Tod in verschiedenen Einrichtungen (Krankenhaus 1986, Krankenhaus 1989, Arztpraxis 2000, Pflegeheim 2005, Palliative Care 2008, Sterben im Hospiz 2010-2015). Sie zeigen die Unterschiede in der Sterbekultur und die Bedeutung einer individuellen, wertschätzenden Begleitung.
Welche Rolle spielt Humor in der Arbeit?
Die Autorin betont die Bedeutung von Humor, auch "schwarzem" Humor, als Bewältigungsstrategie im Umgang mit Tod und Sterben. Sie argumentiert, dass Humor helfen kann, Trauer, Schmerz und Hilflosigkeit zu verarbeiten und eine gesunde Distanz zum Thema zu gewinnen. Er dient als Kontrastprogramm zur Schwere des Themas.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Sterben, Tod, Hospiz, Palliative Care, Sterbekultur, Würde, Trauer, Humor, persönliche Erfahrung, Angehörige, professionelle Begleitung, Selbstmord, Traumata.
Welche Informationen fehlen in der vorliegenden Version?
Die Zusammenfassung enthält leider unvollständige Kapitel zu "Der Tod, das Sterben – ein Streifzug durch die Geschichte" und "Sterben in Würde als gemeinschaftliche Aufgabe". Der Inhalt dieser Kapitel fehlt in der Vorlage.
Wer ist die Autorin?
Die Autorin ist Anett Mittelbach, eine Krankenschwester mit langjähriger Erfahrung im Hospizbereich und Palliative Care.
- Quote paper
- Anett Mittelbach (Author), 2015, Sterben ja - aber wie?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/438832