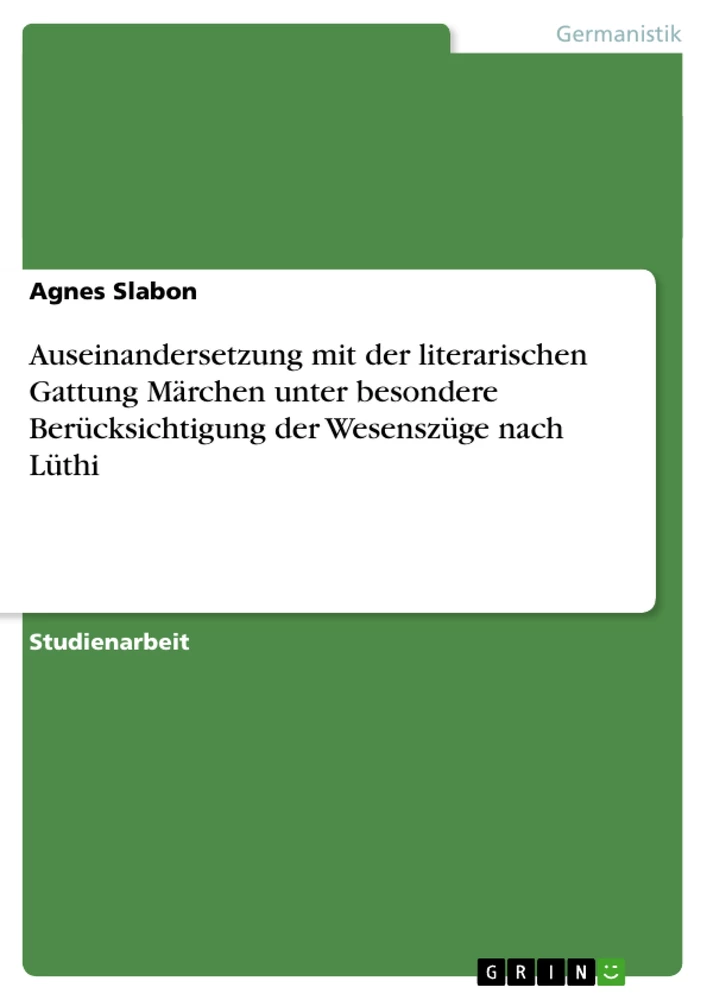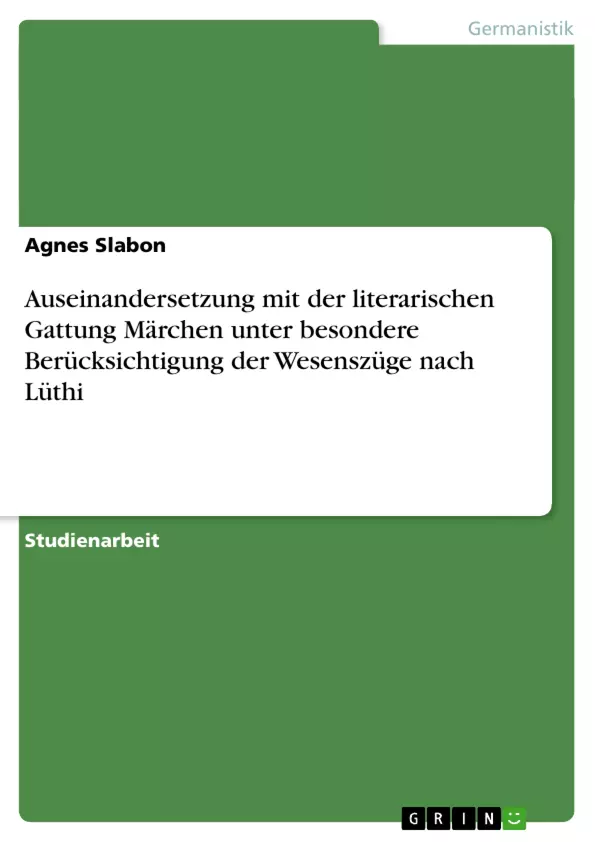Der Begriff „Märchen“ ist die Diminutivform zum mittelhochdeutschen Wort „maere“, das der Bedeutung der Wörter „Kunde, Bericht oder Erzählung“ entspricht. Er bezeichnete anfänglich einfach eine kurze Erzählung. Die Verkleinerungsform „Märchen“, zunächst als „merechyn“, wurde 1450 erstmals belegt, unterlag allerdings wie andere Diminutive früh einer Bedeutungsverschlechterung und wurde als Bezeichnung für unwahre und erdachte Geschichten gebraucht.
Eine Gegenbewegung gegen die Bedeutungsverschlechterung „setzte im 18. Jahrhundert ein, als unter französischem Einfluss Feenmärchen und Geschichten aus ’Tausendundeiner Nacht’ in Mode kamen“) Letztendlich konnten im 19. Jahrhundert einerseits die Märchensammlungen der Gebrüder Grimm und Bechsteins und andererseits die Dichtungen der Romantiker und Andersens dem Märchen die negative Assoziation nehmen, so dass heute die Lexeme Volksmärchen und Kunstmärchen wertungsfrei eine bestimmte Erzählgattung benennen. Allerdings erinnert der Märchenbegriff im Kontext einiger Redewendungen an die Bedeutungsveränderungen des Ausdrucks: „Erzähl mir doch keine Märchen“ an Zeiten der Bedeutungsverschlechterung und „So schön wie ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht “ an Zeiten der Bedeutungsverbesserung. Obwohl sich das mitteldeutsche Wort „Märchen“ in der Schriftsprache durchgesetzt hat, lassen sich im mündlichen Sprachgebrauch weitere Variationen der Bezeichnung finden. Da es in anderen Sprachen keine Begriffe gibt, die in dieser Form spezifisch diese Erzählgattung bezeichnen, sondern entweder zu allgemein gewählt, auch für andere Textgattungen vorgesehen sind oder gar nur einen Teil des Märchenrepertoirs berücksichtigen, wird der Ausdruck „Märchen“ aufgrund seiner spezifischen Anwendung auf eine besondere Art der Erzählung in anderen Ländern als Fremdwort genutzt.
Inhaltsverzeichnis
- TEIL 1: THEORETISCHE ASPEKTE ZUM MÄERCHEN
- 1. Zur Terminologie
- 2. Geschichte des Märchens
- 3. Typologie des Märchens
- 3.1 Die Wesenszüge nach Lüthi
- 3.1.1 Zum Handlungsablauf
- 3.1.2 Zum Personal und Requisiten
- 3.1.3 Zur Darstellungsart
- 3.1.3.1 Eindimensionalität
- 3.1.3.2 Flächenhaftigkeit
- 3.1.3.3 Abstrakter Stil
- 3.1.3.4 Isolation und Allverbundenheit
- 3.1.3.5 Sublimation und Welthaltigkeit
- 3.1.4 Kritik an den Wesenszügen Lüthis
- 4. Funktion des Märchens
- TEIL 2: BEZUG ZUM STUDIENGANG PRIMARSTUFE
- 5. Funktion des Märchens für den Grundschulunterricht
- 5.1 Hinweise für den Einsatz von Märchen im Grundschulunterricht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die literarische Gattung Märchen, insbesondere unter Berücksichtigung der Wesenszüge nach Lüthi. Ziel ist es, einen theoretischen Überblick über die Märchenforschung zu geben und die Bedeutung des Märchens für den Grundschulunterricht aufzuzeigen.
- Terminologie und Definition des Märchens
- Historische Entwicklung der Märchengattung
- Typologie des Märchens nach Max Lüthi
- Funktion des Märchens in der Gesellschaft
- Didaktische Aspekte des Märchens im Grundschulunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Zur Terminologie: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Begriffs „Märchen“ von seiner ursprünglichen Bedeutung als einfache Erzählung bis hin zur heutigen Verwendung als Bezeichnung für eine spezifische Erzählgattung. Es wird auf die Bedeutungsverschiebungen eingegangen und die Problematik der Übersetzung in andere Sprachen thematisiert, da es keine direkten Äquivalente gibt. Die Diskussion verdeutlicht die Komplexität der Begriffsbestimmung und die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtungsweise.
2. Geschichte des Märchens: Die Geschichte des Märchens wird von seinen frühen Ursprüngen um 2000 v. Chr. bis zur Sammlung der Gebrüder Grimm verfolgt. Das Kapitel erörtert die Verbreitung von Märchenmotiven über verschiedene Kulturen hinweg und beleuchtet die Entwicklung der Gattung von der mündlichen Überlieferung über verschiedene literarische Epochen bis zur schriftlichen Fixierung. Es wird auf die Rolle von Autoren wie Straparola, Basile und Perrault eingegangen und die Bedeutung der Grimmschen Sammlung für die Etablierung des Märchens als eigenständige literarische Gattung hervorgehoben. Die Frage nach der tatsächlichen Existenz von Märchen im Altertum wird kritisch diskutiert, wobei die Möglichkeit der Übernahme von Motiven aus anderen Erzählformen berücksichtigt wird.
5. Funktion des Märchens für den Grundschulunterricht: Dieses Kapitel widmet sich der Bedeutung von Märchen im Kontext des Grundschulunterrichts. Es geht nicht nur um den reinen Unterhaltungswert, sondern auch um den didaktischen Nutzen dieser Erzählform für die Entwicklung von Kindern. Die Arbeit legt vermutlich Wert auf den Einsatz von Märchen als Werkzeug zur Förderung verschiedener Kompetenzen im Unterricht. Die Erläuterungen zur konkreten Anwendung im Unterricht werden im darauffolgenden Unterkapitel (5.1) behandelt.
Schlüsselwörter
Märchen, Volksmärchen, Kunstmärchen, Max Lüthi, Typologie, Erzählgattung, mündliche Überlieferung, Grimms Märchen, Grundschulunterricht, Didaktik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Theoretische Aspekte zum Märchen und dessen Bedeutung im Grundschulunterricht
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Märchenforschung, insbesondere im Hinblick auf die Wesenszüge des Märchens nach Max Lüthi. Es umfasst eine Einleitung mit Inhaltsverzeichnis, Zielsetzung und Themenschwerpunkten, detaillierte Kapitelzusammenfassungen und ein Stichwortverzeichnis. Der Fokus liegt auf der theoretischen Erläuterung der Märchengattung und deren didaktischen Anwendung im Grundschulunterricht.
Welche Themen werden im ersten Teil ("Theoretische Aspekte zum Märchen") behandelt?
Teil 1 befasst sich mit der Terminologie und Definition des Märchens, seiner Geschichte von den frühen Ursprüngen bis zur Grimmschen Sammlung, der Typologie des Märchens nach Max Lüthi (inklusive detaillierter Analyse seiner Wesenszüge – Handlungsablauf, Personal, Requisiten, Darstellungsart – und Kritik daran) und der Funktion des Märchens in der Gesellschaft.
Wie werden die Wesenszüge des Märchens nach Max Lüthi behandelt?
Die Wesenszüge nach Lüthi werden ausführlich dargestellt und in verschiedene Aspekte unterteilt: Handlungsablauf, Personal und Requisiten sowie die Darstellungsart (Eindimensionalität, Flächenhaftigkeit, abstrakter Stil, Isolation und Allverbundenheit, Sublimation und Welthaltigkeit). Die Kapitel umfassen sowohl die Beschreibung der einzelnen Merkmale als auch eine kritische Auseinandersetzung mit Lüthis Ansatz.
Worauf konzentriert sich der zweite Teil ("Bezug zum Studiengang Primarstufe")?
Teil 2 konzentriert sich auf die Bedeutung und Funktion des Märchens im Grundschulunterricht. Es beleuchtet den didaktischen Nutzen von Märchen für die kindliche Entwicklung und gibt Hinweise für den Einsatz von Märchen im Unterricht.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden angeboten?
Es werden Zusammenfassungen der Kapitel "Zur Terminologie", "Geschichte des Märchens" und "Funktion des Märchens für den Grundschulunterricht" bereitgestellt. Diese Zusammenfassungen bieten einen Überblick über die wichtigsten Inhalte und Erkenntnisse der jeweiligen Kapitel.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für dieses Dokument?
Die Schlüsselwörter umfassen Märchen, Volksmärchen, Kunstmärchen, Max Lüthi, Typologie, Erzählgattung, mündliche Überlieferung, Grimms Märchen, Grundschulunterricht und Didaktik.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Dieses Dokument richtet sich an Personen, die sich im Rahmen eines Studiums (insbesondere im Bereich der Primarstufe) oder aus beruflichem Interesse mit der Gattung Märchen und deren didaktischer Verwendung auseinandersetzen möchten. Es eignet sich auch für alle, die ein tiefergehendes Verständnis der theoretischen Aspekte des Märchens erlangen wollen.
Gibt es eine detaillierte Gliederung des Inhalts?
Ja, ein ausführliches Inhaltsverzeichnis bietet eine detaillierte Gliederung des Dokuments mit Unterkapiteln und Unter-Unterkapiteln, die den strukturierten Aufbau des Inhalts verdeutlichen.
- Quote paper
- Agnes Slabon (Author), 2004, Auseinandersetzung mit der literarischen Gattung Märchen unter besondere Berücksichtigung der Wesenszüge nach Lüthi, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/43613