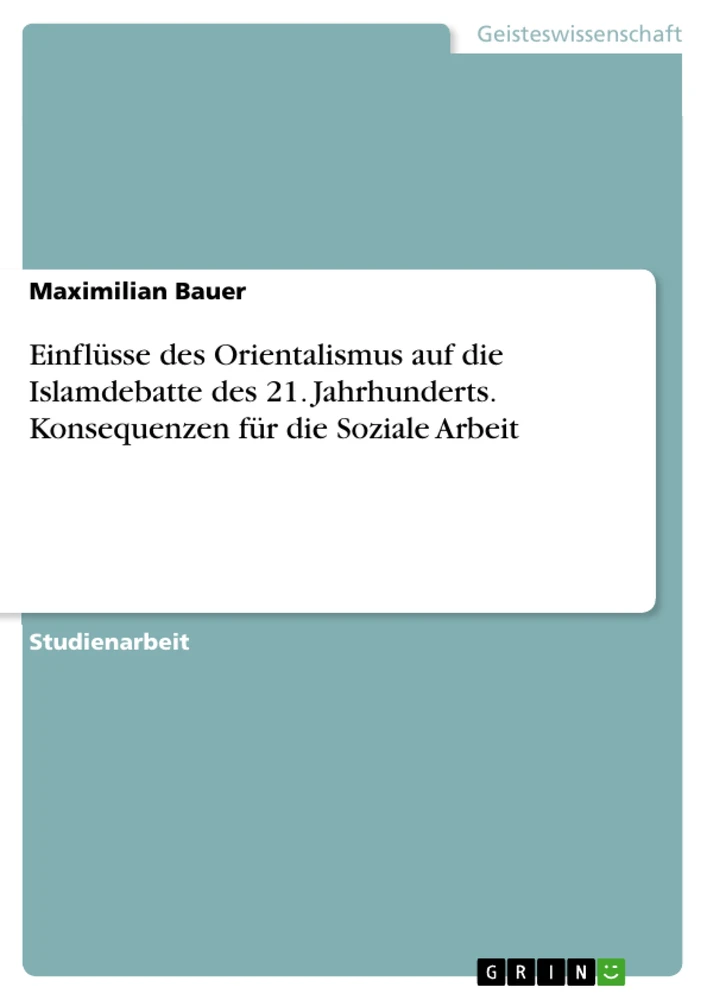In vielen Bereichen der deutschen Gesellschaft wird momentan über die Integration von Migrant*innen muslimischen Glaubens diskutiert. Dabei spielen über lange Zeit geprägte und teilweise konstruierte Menschenbilder eine große Rolle. Diese Arbeit soll die Herkunft dieser Menschenbilder erkunden, einen Einfluss auf die Diskurse im 21. Jahrhundert nachweisen und erläutern, welche Bedeutung diese Einflüsse auf die Soziale Arbeit haben.
Durch die große Zahl an Zuwanderern in Deutschland haben sich neue gesellschaftlich Diskurse und Herausforderungen ergeben. Einen zentralen Punkt dieser Diskurse stellt die Religionszugehörigkeit der Flüchtenden dar. Pronationale Parteien und Anhänger, respektive Sympathisanten dieser, legten den Schwerpunkt ihrer öffentlichen Meinung auf die sogenannte Islamdebatte, die bis dato geführt wird. Im Folgenden wird diese Debatte auf politischer Ebene untersucht, Einflüsse und Stereotype des Orientalismus beleuchtet und Konsequenzen, die sich daraus für Sozialarbeiter*innen in ihrer Tätigkeit ergeben, umrissen. Dabei ist auch der historische Einfluss auf die allgemeine Sichtweise von Nahostländern von besonderem Interesse.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen des Orientalismus
- Wortherkunft und Geographie
- Orientalismus 1978 bis heute
- Der Orient in Kunst und Kultur des 19. und 20. Jahrhunderts
- „Islam“ und „Orient“ im 21. Jahrhundert
- Islamdebatten in Deutschland im 21. Jahrhundert
- Auslöser der Debatten in Deutschland seit 1999
- Verschärfung durch die „Sarrazin- Debatte“
- Intensivierung ab 2015
- Elemente des Orientalismus in der Debatte
- Bedeutung für die Praxis der Sozialen Arbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Einflüsse des Orientalismus auf die Islamdebatte im 21. Jahrhundert und analysiert die daraus resultierenden Konsequenzen für die Soziale Arbeit. Ziel ist es, die Ursprünge und die nachhaltige Wirkung von stereotypen Menschenbildern im Kontext der Integrationsdebatte aufzuzeigen und die Bedeutung dieser Einflüsse für die praktische Arbeit von Sozialarbeiter*innen zu beleuchten.
- Herkunft und Entwicklung des Orientalismus
- Analyse der Islamdebatte in Deutschland im 21. Jahrhundert
- Identifikation von Orientalismus-Elementen in der Debatte
- Relevanz dieser Einflüsse für die Soziale Arbeit
- Historische und kulturelle Aspekte der Sichtweise auf Nahostländer
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt den Kontext der „Flüchtlingskrise 2015“ und die daraus resultierenden gesellschaftlichen Diskurse, insbesondere die Islamdebatte, vor. Die Bedeutung von stereotypen Menschenbildern und die Relevanz des Orientalismus für dieses Thema werden hervorgehoben.
- Grundlagen des Orientalismus: Dieses Kapitel definiert wichtige Begriffe und beleuchtet die historische Entwicklung des Begriffs „Orient“. Die Bedeutung des Orientalismus für die Konstruktion von Wissen über den Nahen Osten wird erläutert.
- Islamdebatten in Deutschland im 21. Jahrhundert: Dieser Abschnitt analysiert die Islamdebatte in Deutschland seit 1999 und untersucht die Ursachen für ihre Verschärfung in den letzten Jahren. Die Rolle des Orientalismus in diesen Debatten wird untersucht.
Schlüsselwörter
Orientalismus, Islamdebatte, Integration, Stereotype, Menschenbilder, Soziale Arbeit, Interkulturelle Kompetenz, Kulturgeographie, Geschichte, Nahostländer, Flüchtlingskrise, Deutschland, 21. Jahrhundert
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Orientalismus?
Ein Begriff (geprägt durch Edward Said), der die westliche Sicht auf den „Orient“ als Konstruktion von Stereotypen und Machtverhältnissen beschreibt.
Wie beeinflusst Orientalismus die heutige Islamdebatte?
Alte Stereotype und konstruierte Menschenbilder werden in modernen politischen Diskursen genutzt, um Ängste zu schüren und Ausgrenzung zu rechtfertigen.
Welche Konsequenzen ergeben sich für die Soziale Arbeit?
Sozialarbeiter müssen interkulturelle Kompetenz entwickeln und ihre eigenen Vorurteile reflektieren, um Migranten vorurteilsfrei unterstützen zu können.
Was war die „Sarrazin-Debatte“?
Eine kontroverse Debatte in Deutschland, die durch Thilo Sarrazins Thesen zur Integration und Religion ausgelöst wurde und die Islamdebatte verschärfte.
Wie wird der Orient in Kunst und Kultur dargestellt?
Oft als exotisch, rückständig oder geheimnisvoll, was zur Verfestigung von Klischees beigetragen hat, die bis heute nachwirken.
- Quote paper
- Maximilian Bauer (Author), 2017, Einflüsse des Orientalismus auf die Islamdebatte des 21. Jahrhunderts. Konsequenzen für die Soziale Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/433209