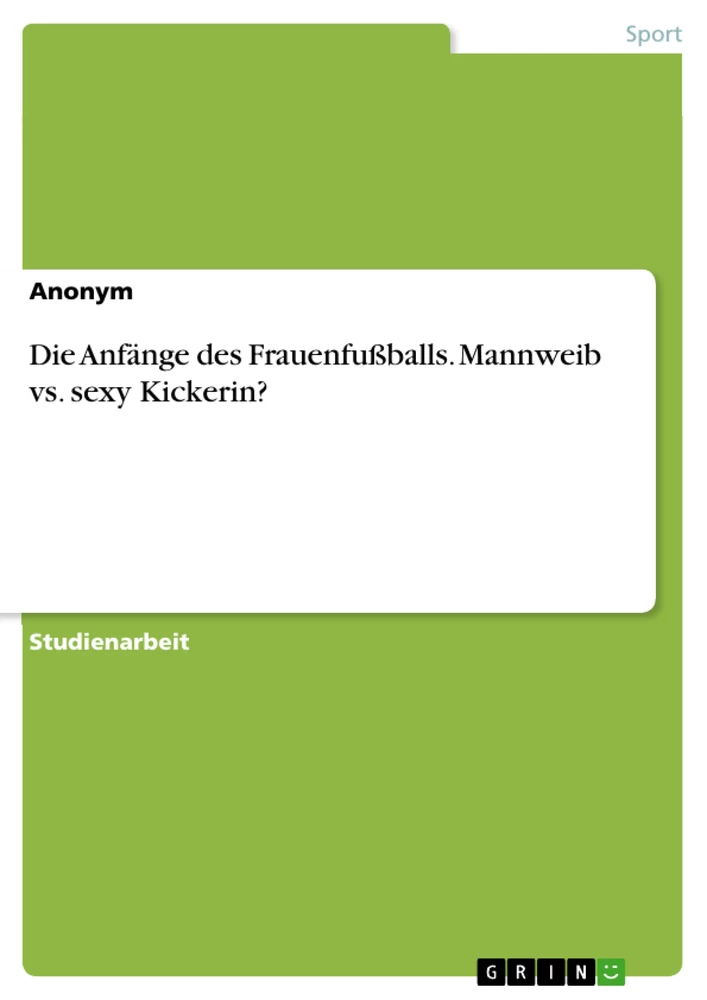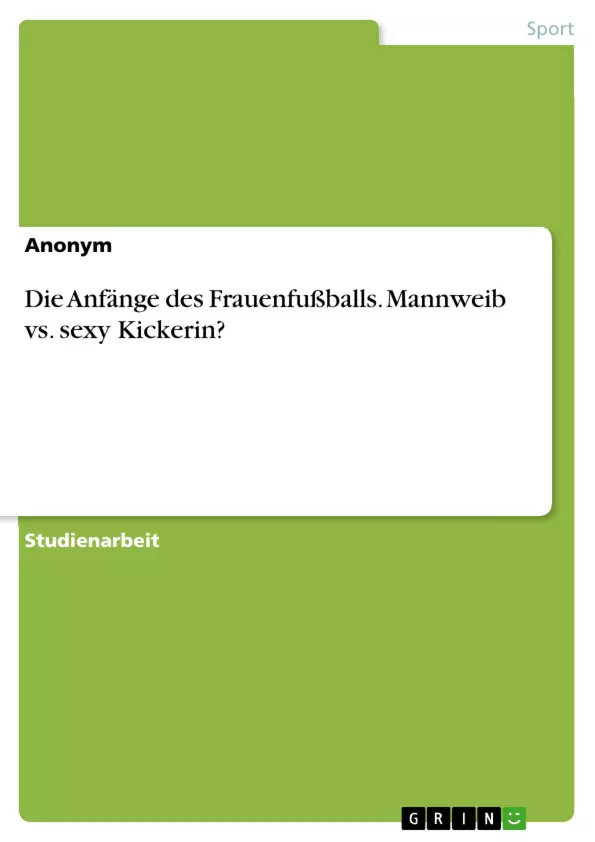Der Frauenfußball hat in Deutschland einen geringeren Stellenwert als der Männerfußball. Dementsprechend ist die mediale Repräsentanz deutlich geringer. Für einen Artikel im Fußball-Magazin mussten die Frauen in den 1990er Jahren sogar Geld bezahlen. Zudem wurde den Frauen neben der geringen Berichterstattung fehlende Feminität vorgeworfen und schließlich Homosexualität unterstellt. Folglich entstand das Klischee der „Mannweiber“.
Die Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2011 ermöglichte einen Imagewechsel, wodurch das Lesbenklischee ersetzt wurde durch das Sexy-Girl-Klischee. Folglich waren die Nationalspielerinnen bereits im Vorfeld medial gefragt.
Daher werden in der vorliegenden Ausarbeitung folgende Fragen im Rückblick auf die WM 2011 genauer unter die Lupe genommen: Gab es in Bezug auf den Frauenfußball tatsächlich einen Wandel in der Wahrnehmung? Und war der Imagewechsel zur „sexy Kickerin“ bloß ein Produkt des Zufalls oder doch das einer medialen Vermarktungsstrategie? Was sind die Ursachen und die Hintergründe der gegenwärtigen Sexualisierung im Sport?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Innerhalb kürzester Zeit zum Medienhype
- 3. Theoretischer Zugang durch die Kommunikationsforschung
- 3.1 Nachrichtenwerttheorie
- 3.2 Gatekeepertheorie
- 4. Mediale Rahmenbedingungen
- 4.1 Sexualisierung des Frauenfußballs
- 5. Ein journalistischer Rückblick
- 6. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Wandel der medialen Darstellung des Frauenfußballs in Deutschland, insbesondere im Kontext der Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2011. Sie analysiert den Übergang vom Klischee der „Mannweiber“ zum Bild der „sexy Kickerin“ und hinterfragt die Ursachen und Hintergründe dieses Imagewechsels.
- Mediale Repräsentation des Frauenfußballs
- Klischeebildung und Imagewandel im Frauenfußball
- Einfluss der Medien auf die Wahrnehmung des Frauenfußballs
- Nachrichtenwerttheorie und Gatekeepertheorie im Kontext des Frauenfußballs
- Sexualisierung des Frauenfußballs in den Medien
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet den im Vergleich zum Männerfußball geringeren Stellenwert des Frauenfußballs in Deutschland und die daraus resultierende reduzierte mediale Berichterstattung. Sie skizziert die negativen Klischees, denen Frauenfußballerinnen in der Vergangenheit ausgesetzt waren, wie etwa das „Mannweib“-Klischee, und führt in die zentrale Forschungsfrage ein: den Wandel des Images des Frauenfußballs im Kontext der WM 2011.
2. Innerhalb kürzester Zeit zum Medienhype: Dieses Kapitel hinterfragt die These eines tatsächlichen Imagewandels durch die WM 2011. Es argumentiert, dass der plötzliche Anstieg der medialen Aufmerksamkeit auch durch Faktoren wie die erstmalig stattfindende WM in Deutschland, die Einzigartigkeit des Events im Jahr 2011 und die Notwendigkeit einer erhöhten Berichterstattung zur Finanzierung des Turniers bedingt war. Der Aspekt der Selbstermächtigung von Frauen im Sport und die damit verbundene politische Relevanz im Kontext des Gender-Mainstreamings wird als weitere Erklärung herangezogen.
3. Theoretischer Zugang durch die Kommunikationsforschung: Dieses Kapitel beschreibt die Relevanz der Kommunikationsforschung für die Analyse der medialen Berichterstattung über den Frauenfußball. Es konzentriert sich auf die Nachrichtenwerttheorie (nach Lippmann) und die Gatekeepertheorie. Die Nachrichtenwerttheorie erläutert die Kriterien für die Auswahl von Ereignissen als berichtenswert, während die Gatekeepertheorie die Rolle der Journalisten als „Torhüter“ der Information hervorhebt.
Schlüsselwörter
Frauenfußball, Medienrepräsentation, Imagewandel, Klischees, Nachrichtenwerttheorie, Gatekeepertheorie, Sexualisierung, Medienhype, WM 2011, Gender-Mainstreaming.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Mediale Darstellung des Frauenfußballs in Deutschland (WM 2011)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Wandel der medialen Darstellung des Frauenfußballs in Deutschland, insbesondere im Kontext der Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2011. Sie untersucht den Übergang vom Klischee der „Mannweiber“ zum Bild der „sexy Kickerin“ und hinterfragt die Ursachen und Hintergründe dieses Imagewechsels.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die mediale Repräsentation des Frauenfußballs, die Klischeebildung und den Imagewandel im Frauenfußball, den Einfluss der Medien auf die Wahrnehmung des Frauenfußballs, die Nachrichtenwerttheorie und Gatekeepertheorie im Kontext des Frauenfußballs sowie die Sexualisierung des Frauenfußballs in den Medien.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Innerhalb kürzester Zeit zum Medienhype, Theoretischer Zugang durch die Kommunikationsforschung (inkl. Nachrichtenwerttheorie und Gatekeepertheorie), Mediale Rahmenbedingungen (inkl. Sexualisierung des Frauenfußballs), Ein journalistischer Rückblick und Fazit und Ausblick.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung beleuchtet den im Vergleich zum Männerfußball geringeren Stellenwert des Frauenfußballs in Deutschland und die daraus resultierende reduzierte mediale Berichterstattung. Sie skizziert die negativen Klischees der Vergangenheit und führt in die zentrale Forschungsfrage ein: den Wandel des Images des Frauenfußballs im Kontext der WM 2011.
Wie wird der plötzliche Medienhype um die WM 2011 erklärt?
Kapitel 2 hinterfragt, ob der Anstieg der medialen Aufmerksamkeit tatsächlich einen Imagewandel widerspiegelt. Es werden alternative Erklärungen angeführt, wie die erstmalig in Deutschland stattfindende WM, die Einzigartigkeit des Events und die Notwendigkeit erhöhter Berichterstattung zur Finanzierung. Auch die Selbstermächtigung von Frauen im Sport und die politische Relevanz im Kontext des Gender-Mainstreamings werden als Erklärung herangezogen.
Welche kommunikationswissenschaftlichen Theorien werden angewendet?
Kapitel 3 beschreibt die Relevanz der Kommunikationsforschung und konzentriert sich auf die Nachrichtenwerttheorie (nach Lippmann) und die Gatekeepertheorie. Die Nachrichtenwerttheorie erklärt die Kriterien für berichtenswerte Ereignisse, während die Gatekeepertheorie die Rolle der Journalisten als „Torhüter“ der Information hervorhebt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Frauenfußball, Medienrepräsentation, Imagewandel, Klischees, Nachrichtenwerttheorie, Gatekeepertheorie, Sexualisierung, Medienhype, WM 2011, Gender-Mainstreaming.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage ist der Wandel des Images des Frauenfußballs im Kontext der Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2011.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2015, Die Anfänge des Frauenfußballs. Mannweib vs. sexy Kickerin?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/432915