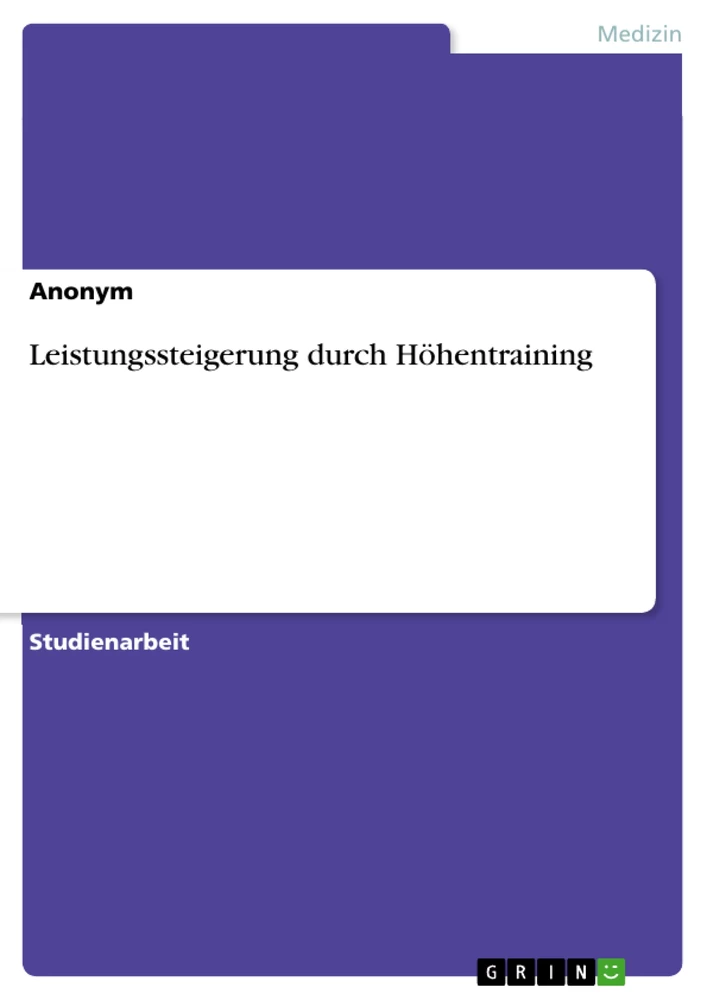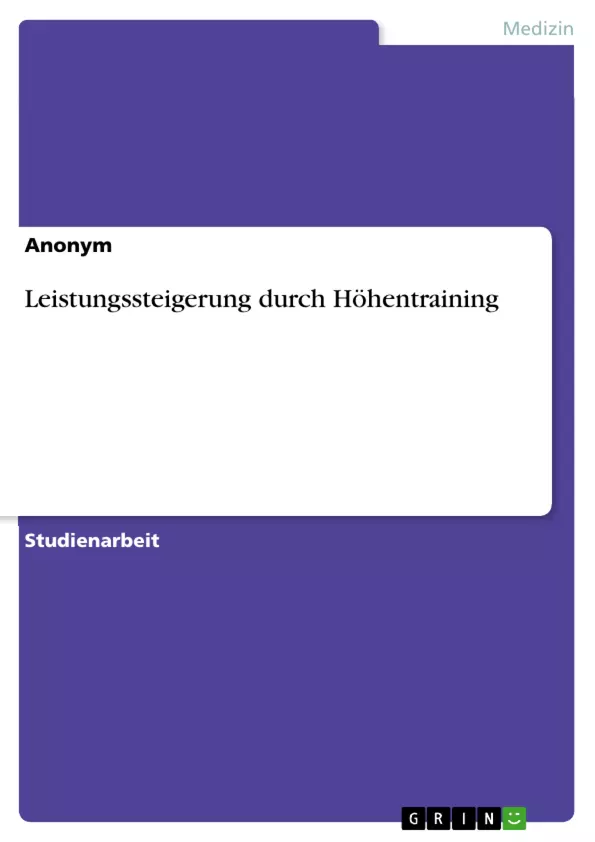Anlass zum Höhentraining waren die Olympischen Spiele 1968 in Mexico City in 2.240m Höhe, denn bei Ausdauersportarten über zwei Minuten wurde ein Leistungsrückgang von zwei bis acht Prozent festgestellt. Daher erkannte man, dass ein präventives Höhentraining eingesetzt werden muss um die Leistungsabnahme bei einem Wettkampf in der Höhe zu verhindern. Des Weiteren hat man festgestellt, dass solch ein Training aufgrund der Steigerung der sportlichen Ausdauerleistungsfähigkeit auch als Vorbereitung auf Leistungen im Flachland eingesetzt werden kann.
Aufgrund des in der Höhe herrschenden Sauerstoffmangels und der damit verbundenen Verringerung der Sauerstoffaufnahmekapazität des Blutes erzwingt das Höhentraining physiologische Anpassungserscheinungen des gesamten Organismus. Da das Blut somit einen niedrigeren Sauerstoffgehalt hat, kann folglich nicht mehr so viel Sauerstoff zu den Muskeln transportieren werden. Der Körper versucht dies zu kompensieren, indem er beispielsweise ein Hormon (Erythropoetin) ausschüttet das dazu führt, dass vermehrt rote Blutkörperchen gebildet werden, welche für den Transport von Sauerstoff zuständig sind. Ein Höhentraining hat allerdings nicht nur positive Auswirkungen auf den Organismus, wodurch der Sportler bzw. sein Körper ständig versuchen muss die negativen Effekte auszugleichen. Ein Beispiel dafür ist die Abnahme des Wassergehaltes in der Höhe, denn dadurch steigt der Hämatokrit, weswegen die Vermehrung der roten Blutkörperchen dem Körper wiederum zum Verhängnis wird. Durch den erhöhten Hämatokrit wird das Blut nämlich dickflüssig, was Thrombosen oder sogar Herzinfarkte zur Folge haben kann. Um sich die erhöhte Anzahl der roten Blutkörperchen trotzdem vorteilhaft zu machen, muss der Sportler viel trinken.
Das Höhentraining bringt noch viele weitere Trainingseffekte, wie die Steigerung des Atemminutenvolumens oder des Herzminutenvolumens mit sich. Solche physiologischen Wirksamkeiten können allerdings nur mit einem Training ab drei Wochen Dauer eintreten. Dabei ist es wichtig, dass man bestimmte trainingsmethodische Voraussetzungen beachtet, da diese die größte Bedeutung für den späteren sportlichen Erfolg haben. So muss man beispielsweise wissen, dass man in der Höhe zunächst die Belastungsintensität herunterschrauben muss, da es ansonsten zu einer erhöhten Laktatanhäufung kommt, die den Sportler folglich stark ermüden lässt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Physikalische Veränderungen in der Höhe
- 2.1. Luftdruck
- 2.2. Luftdichte
- 2.3. Sauerstoffpartialdruck
- 3. Anpassungsreaktionen des Körpers an die Höhe
- 3.1. Zunahme des Atemminutenvolumens
- 3.2. Säure-Basen-Haushalt
- 3.3. Zunahme des Herzminutenvolumens
- 3.3.1. Hämatokrit
- 3.3.2. Ist Höhentraining eine Form des Dopings?
- 3.4. Veränderungen innerhalb der Muskelzelle
- 4. Formen des Höhentrainings
- 5. Trainingsgestaltung
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen von Höhentraining auf die sportliche Leistungsfähigkeit. Ziel ist es, die physiologischen Anpassungsreaktionen des Körpers auf den Sauerstoffmangel in der Höhe zu beschreiben und die Bedeutung des Höhentrainings für die Leistungssteigerung im Flachland zu beleuchten. Dabei werden sowohl die positiven als auch die potenziellen negativen Effekte des Höhentrainings berücksichtigt.
- Physiologische Anpassungen des Körpers an die Höhe
- Einfluss des Luftdrucks, der Luftdichte und des Sauerstoffpartialdrucks auf die Leistungsfähigkeit
- Methodische Aspekte der Trainingsgestaltung im Höhentraining
- Positive und negative Auswirkungen des Höhentrainings
- Höhentraining im Vergleich zu anderen Trainingsmethoden
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet den historischen Kontext des Höhentrainings, beginnend mit den Olympischen Spielen 1968 in Mexico City, wo Leistungsrückgänge bei Ausdauersportlern festgestellt wurden. Sie führt die Notwendigkeit eines präventiven Höhentrainings zur Vermeidung von Leistungsverlusten in der Höhe und dessen Anwendung zur Verbesserung der sportlichen Ausdauerleistungsfähigkeit im Flachland aus. Der Text beschreibt den durch den Sauerstoffmangel ausgelösten physiologischen Anpassungsprozess des Körpers, einschließlich der Ausschüttung von Erythropoetin zur vermehrten Bildung roter Blutkörperchen. Gleichzeitig werden die potenziellen negativen Folgen wie die Erhöhung des Hämatokrits und die damit verbundenen Risiken von Thrombosen und Herzinfarkten angesprochen. Schließlich wird die Bedeutung der trainingsmethodischen Voraussetzungen für den Erfolg des Höhentrainings hervorgehoben, insbesondere die Notwendigkeit der Anpassung der Belastungsintensität in der Höhe.
2. Physikalische Veränderungen in der Höhe: Dieses Kapitel beschreibt die physikalischen Veränderungen in der Höhe, die sich auf die sportliche Leistung auswirken. Es konzentriert sich auf den mit zunehmender Höhe abnehmenden Luftdruck, die damit verbundene Abnahme der Luftdichte und den daraus resultierenden geringeren Strömungswiderstand bei Sportarten wie Sprint, Radfahren oder Skifahren. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Abnahme des Sauerstoffpartialdrucks, die zu einer Verringerung der Sauerstoffaufnahmekapazität des Blutes führt. Das Kapitel verdeutlicht den Zusammenhang zwischen Luftdruck, Luftdichte, Sauerstoffpartialdruck und deren Einfluss auf die Atemarbeit und die Sauerstoffversorgung der Muskulatur mithilfe von Abbildungen und Tabellen.
3. Anpassungsreaktionen des Körpers an die Höhe: Dieses Kapitel befasst sich mit den physiologischen Anpassungsreaktionen des Körpers auf den Sauerstoffmangel in der Höhe. Es beschreibt die Zunahme des Atemminutenvolumens und des Herzminutenvolumens als Kompensationsmechanismen. Ein detaillierter Einblick in die Veränderungen im Blut, insbesondere die Erhöhung des Hämatokrits und die damit verbundenen Risiken und Vorteile, wird gegeben. Die Veränderungen innerhalb der Muskelzelle und die Regulation des Säure-Basen-Haushaltes werden ebenfalls thematisiert. Der Abschnitt diskutiert kritisch, ob Höhentraining als Doping betrachtet werden kann.
4. Formen des Höhentrainings: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über verschiedene Formen des Höhentrainings. (Anmerkung: Da der Text keine konkreten Formen nennt, kann hier nur eine allgemeine Zusammenfassung gegeben werden. Eine detailliertere Ausarbeitung wäre mit den Informationen des Originals möglich). Dieses Kapitel wird sich voraussichtlich mit verschiedenen Trainingsmethoden, Höhenlagen und Trainingsintensitäten beschäftigen, welche für ein effektives Höhentraining relevant sind.
5. Trainingsgestaltung: Dieses Kapitel behandelt die methodischen Aspekte der Trainingsgestaltung im Höhentraining. (Anmerkung: Da der Text keine konkreten Details zur Trainingsgestaltung bietet, kann hier nur eine allgemeine Zusammenfassung gegeben werden. Eine detailliertere Ausarbeitung wäre mit den Informationen des Originals möglich). Dieses Kapitel wird wahrscheinlich Aspekte wie die richtige Dosierung der Trainingsbelastung in der Höhe, die Berücksichtigung der individuellen körperlichen Voraussetzungen und die Vermeidung von Überlastung thematisieren.
Schlüsselwörter
Höhentraining, Sauerstoffpartialdruck, Luftdruck, Luftdichte, Atemminutenvolumen, Herzminutenvolumen, Hämatokrit, Erythropoetin, physiologische Anpassung, Leistungssteigerung, Ausdauerleistung, Trainingsgestaltung, Trainingsmethoden.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Auswirkungen des Höhentrainings auf die sportliche Leistungsfähigkeit
Was ist der allgemeine Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über das Höhentraining. Er behandelt die physikalischen Veränderungen in der Höhe (Luftdruck, Luftdichte, Sauerstoffpartialdruck), die physiologischen Anpassungsreaktionen des Körpers (Zunahme des Atem- und Herzminutenvolumens, Veränderungen im Hämatokrit, Säure-Basen-Haushalt), verschiedene Formen des Höhentrainings und die methodischen Aspekte der Trainingsgestaltung. Der Text beleuchtet sowohl die positiven als auch die potenziellen negativen Effekte des Höhentrainings und diskutiert die Frage, ob Höhentraining als Doping betrachtet werden kann.
Welche physikalischen Veränderungen in der Höhe werden beschrieben?
Der Text beschreibt den mit zunehmender Höhe abnehmenden Luftdruck, die damit verbundene Abnahme der Luftdichte und den daraus resultierenden geringeren Strömungswiderstand (vorteilhaft für Sportarten wie Sprint, Radfahren oder Skifahren). Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Abnahme des Sauerstoffpartialdrucks, welche die Sauerstoffaufnahmekapazität des Blutes reduziert.
Welche physiologischen Anpassungsreaktionen des Körpers werden erläutert?
Der Text beschreibt die Zunahme des Atemminutenvolumens und des Herzminutenvolumens als Kompensationsmechanismen für den Sauerstoffmangel. Detailliert wird die Veränderung im Blut, insbesondere die Erhöhung des Hämatokrits mit den damit verbundenen Risiken (Thrombosen, Herzinfarkte) und Vorteilen, behandelt. Zusätzlich werden Veränderungen innerhalb der Muskelzelle und die Regulation des Säure-Basen-Haushaltes thematisiert.
Welche Formen des Höhentrainings werden behandelt?
Der Originaltext enthält leider keine konkreten Beispiele für verschiedene Formen des Höhentrainings. Der Text erwähnt nur, dass dieses Kapitel verschiedene Trainingsmethoden, Höhenlagen und Trainingsintensitäten behandeln würde.
Wie wird die Trainingsgestaltung im Höhentraining beschrieben?
Ähnlich wie bei den Formen des Höhentrainings, bietet der Originaltext keine konkreten Details zur Trainingsgestaltung. Es wird lediglich angedeutet, dass Aspekte wie die richtige Dosierung der Trainingsbelastung, die Berücksichtigung individueller Voraussetzungen und die Vermeidung von Überlastung thematisiert werden würden.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Der Text untersucht die Auswirkungen von Höhentraining auf die sportliche Leistungsfähigkeit. Ziel ist es, die physiologischen Anpassungsreaktionen des Körpers auf den Sauerstoffmangel in der Höhe zu beschreiben und die Bedeutung des Höhentrainings für die Leistungssteigerung im Flachland zu beleuchten. Dabei werden sowohl positive als auch potenzielle negative Effekte berücksichtigt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für den Text?
Schlüsselwörter sind: Höhentraining, Sauerstoffpartialdruck, Luftdruck, Luftdichte, Atemminutenvolumen, Herzminutenvolumen, Hämatokrit, Erythropoetin, physiologische Anpassung, Leistungssteigerung, Ausdauerleistung, Trainingsgestaltung, Trainingsmethoden.
Wird die Frage nach Doping im Zusammenhang mit Höhentraining behandelt?
Ja, der Text diskutiert kritisch, ob Höhentraining als Doping betrachtet werden kann.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text ist in folgende Kapitel gegliedert: Einleitung, Physikalische Veränderungen in der Höhe, Anpassungsreaktionen des Körpers an die Höhe, Formen des Höhentrainings, Trainingsgestaltung und Fazit.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2013, Leistungssteigerung durch Höhentraining, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/432914