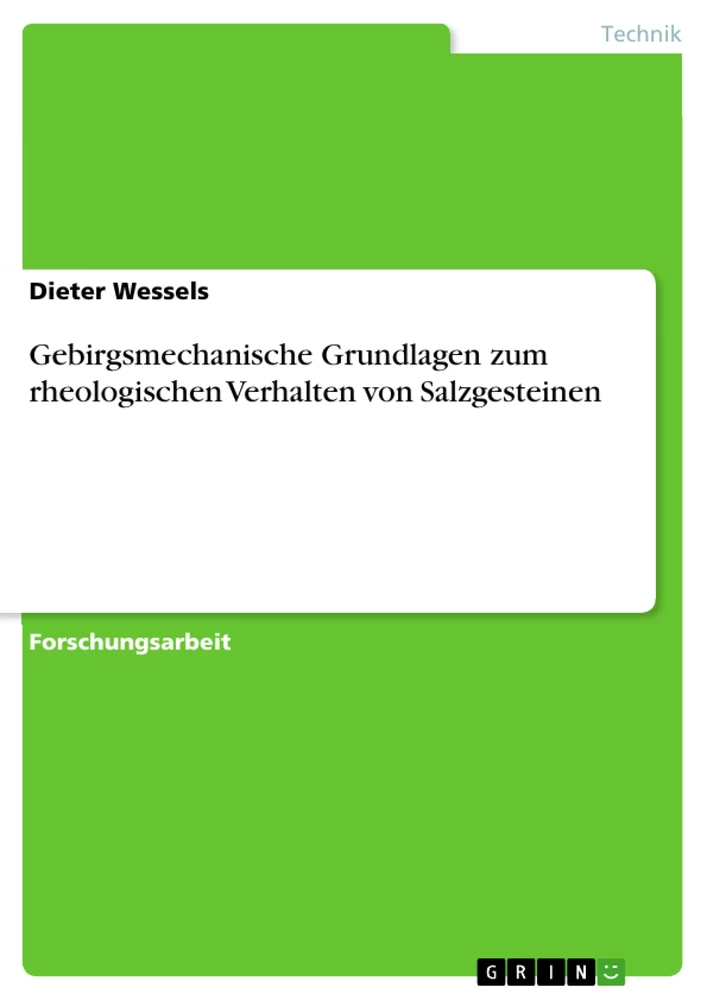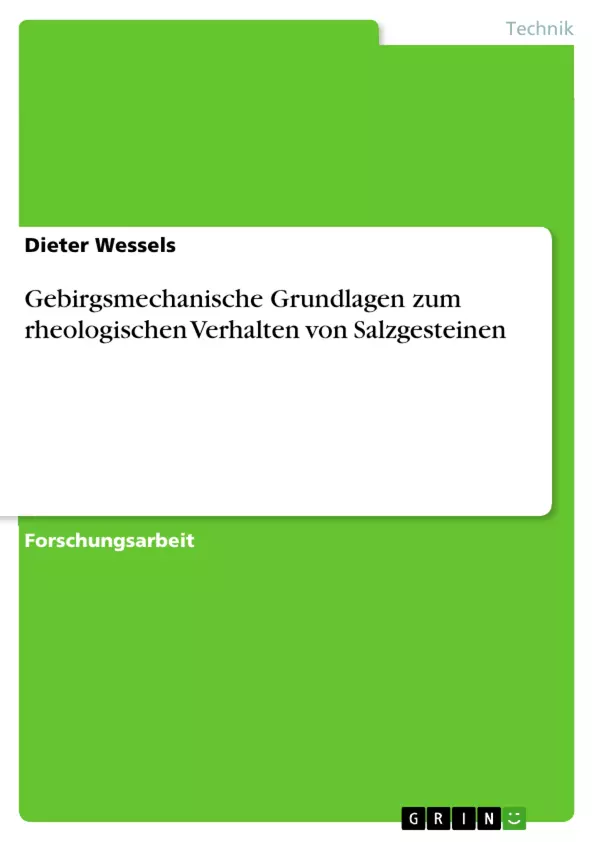Rheologie als Lehre der Deformierbarkeit der Stoffe findet in der Gebirgsmechanik und insbesondere in der Salzmechanik seit den 50er Jahren Anwendung. Mittels idealer rheologischer Grundkörper lässt sich das Verhalten von Salzgestein darstellen, was sich beispielsweise durch Relaxation äussert. Zu unterscheiden ist das Verhalten im elastischen, plastischen-, zeitabhängigen- und Bruch-Bereich.
Untersuchungen rheologischer Parameter werden im Labor und in-situ durchgeführt, wobei auffällig ist, dass sehr unterschiedliche Ansätze und Messmethoden angewendet werden. Eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse ist kaum gegeben. Viele rheologische Modelle werden lediglich modifiziert, anstatt sich auf eine Vereinheitlichung der Methodik zu konzentrieren.
Bei der Betrachtung des Zeit-Deformationsverhaltens unter Belastung, dem sog. Kriechen, lassen sich vier Phasen unterscheiden:
primäres Kriechen,
sekundäres Kriechen,
tertiäres Kriechen,
Bruch.
Durch eine festkörperphysikalischen Betrachtungsweise lässt sich das besondere Deformationsverhalten von Haliten erläutern. Einflussparameter des Kriechens sind u.a. Temperatur, Belastung und petrographischer Aufbau.
Aus unterschiedlichen Ansätzen heraus lassen sich rheologische Stoffgesetze für Salzgesteine ableiten. Diese Ansätze sind:
mathematisch-empirisch,
modellrheologisch,
strukturell.
Für den Hohlraumbau ergibt sich durch die rheologische Betrachtungsweise, die über die Elastizitätstheorie hinausgeht, eine bessere Erfassung realer Spannung-Deformations-Verhältnisse. Konvergenzvorausberechnungen und numerische Bestimmung von Spannungen und Verformungen sind Errungenschaften in der Salzmechanik, die durch Anwendung der Rheologie in Verbindung mit der Finiten-Elemente-Methode erst möglich wurden.
In den bisher deutschsprachigen Veröffentlichungen zeigt sich ein durchgehend unterschiedlicher Ansatz der Wissenschaftler bei der Grundlagenermittlung Rheologie in die Gebirgsmechanik einzubeziehen. Hier zeigt sich eine „junge“ Wissenschaft. Eine Standardisierung, wie sie in älteren Wissenschaftsgebieten selbstverständlich sind, werden vermisst.
Trotz der Schwäche, die sich in dieser Auswertung der vorliegenden deutschsprachigen Literatur zeigt, ist das vorliegende Ergebnis dennoch eine Arbeit, die es ermöglicht ein gutes Verständnis für ein Teilaspekt der Gebirgsmechanik, insbesondere für Salzgesteine mit dem rheologischen Ansatz, zu entwickeln.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundlage der Rheologie
- 2.1 Ideale rheologische Körper
- 2.2 Rheologisches Verhalten
- 2.3 Stoffverhalten
- 2.3.1 Elastisches Verhalten
- 2.3.2 Plastisches und zeitabhängiges Verhalten
- 2.3.3 Bruchverhalten
- 3 Rheologische Untersuchungsmethoden
- 3.1 Messungen an Laborproben
- 3.2 In-situ-Messungen
- 3.3 Dynamische Messmethoden
- 4 Kriechen
- 4.1 Kriechmechanismen
- 4.1.1 Primäres Kriechen
- 4.1.2 Sekundäres Kriechen
- 4.1.3 Tertiäres Kriechen
- 4.2 Deformationseinflüsse
- 4.3 Einflussparameter des Kriechens
- 4.3.1 Temperatur
- 4.3.2 Belastung
- 4.3.3 Petrographischer Aufbau
- 4.1 Kriechmechanismen
- 5 Stoffgesetze für Steinsalze
- 5.1 Mathematisch-empirische Stoffgesetze
- 5.2 Modellrheologische Stoffgesetze
- 5.3 Strukturelle Stoffgesetze
- 6 Aspekte für den Hohlraumbau
- 7 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit dient als gebirgsmechanische Grundlage zum Verständnis des rheologischen Verhaltens von Steinsalzen. Sie präsentiert verschiedene Modelle und Ansätze aus der deutschsprachigen Literatur, zeigt Widersprüche auf und formuliert Thesen für eine koordinierte Zielsetzung zukünftiger Forschung.
- Einführung in die Rheologie und deren Anwendung in der Gebirgsmechanik
- Darstellung verschiedener Modelle des rheologischen Verhaltens von Steinsalzen
- Analyse verschiedener Untersuchungsmethoden zur Bestimmung rheologischer Parameter
- Beschreibung von Kriechmechanismen und deren Einflussparameter
- Vorstellung unterschiedlicher Stoffgesetze für Steinsalze
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Klassifizierung realer Materialien nach mechanischen Eigenschaften und das Ziel der Rheologie – die Entwicklung von Stoffgesetzen zur Beschreibung des Deformationsverhaltens. Sie betont die unterschiedlichen Standpunkte in der Literatur bezüglich rheologischer Ansätze und formuliert das Ziel dieser Arbeit: eine Einführung in die Modelle des rheologischen Verhaltens von Steinsalzen und die Vorstellung verschiedener Ansätze, sowie ein Resümee zu Widersprüchen und Thesen zu einer koordinierten Zielsetzung.
2 Grundlage der Rheologie: Dieses Kapitel definiert Rheologie als die Lehre der Deformierbarkeit von Stoffen und ordnet sie in die technische Mechanik ein. Es präsentiert die Axiome von Jaburek zur Anwendung der Rheologie in der Gebirgsmechanik und beschreibt das Spannungs-Verformungs-Verhalten als Superposition elastischer, reversibler Verzerrungen und irreversibler zähflüssiger bzw. plastischer Versetzungen. Ideale rheologische Körper (Hooke'scher Körper, Newton-Flüssigkeit, St. Venant-Körper) und ihre Kombination zu komplexeren Modellen werden erläutert.
3 Rheologische Untersuchungsmethoden: Dieses Kapitel diskutiert verschiedene Methoden zur Bestimmung rheologischer Zustandsgleichungen oder Parameter, darunter statistische Labormessungen, statische In-situ-Messungen und dynamische Messmethoden. Es betont die unterschiedlichen Ansätze in der Literatur und die Notwendigkeit zukünftiger Vergleichsstandards.
4 Kriechen: Dieses Kapitel erläutert das Kriechen von Salzgesteinen, beschreibt die Kriechrate mittels einer Arrhenius-Gleichung und diskutiert den Einfluss von Gitterfehlern. Es unterscheidet primäres, sekundäres und tertiäres Kriechen, präsentiert verschiedene Modelle zur Beschreibung des Kriechverhaltens und analysiert den Einfluss von Temperatur, Belastung und petrographischem Aufbau.
5 Stoffgesetze für Steinsalze: Das Kapitel klassifiziert Stoffgesetze für Steinsalze in drei Gruppen: mathematisch-empirische, modellrheologische und strukturelle. Es beschreibt die Ableitung eines Kriechgesetzes nach Knoll und stellt verschiedene mathematisch-empirische Stoffgesetze gegenüber. Es zeigt modellrheologische Ansätze durch verschiedene Modelle und diskutiert die Anwendung von Deformationsdiagrammen zur Bestimmung struktureller Stoffgesetze.
6 Aspekte für den Hohlraumbau: Dieses Kapitel behandelt die Auswirkungen des rheologischen Verhaltens von Salzgestein auf den Hohlraumbau, betont die Bedeutung der entwickelten Stoffgesetze für numerische Berechnungen mit der Finite-Elemente-Methode (FEM) und diskutiert die Rolle der Rheologie für die Sicherheit im Bergbau.
Schlüsselwörter
Rheologie, Gebirgsmechanik, Steinsalz, Kriechverhalten, Stoffgesetze, Deformation, Spannung, Temperatur, Laborversuche, In-situ-Messungen, Hohlraumbau, Finite-Elemente-Methode (FEM), Elastizität, Plastizität, Viskosität, Kriechphasen (primär, sekundär, tertiär), Petrographischer Aufbau.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Rheologisches Verhalten von Steinsalzen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das rheologische Verhalten von Steinsalzen. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Stichwortverzeichnis. Der Fokus liegt auf der Anwendung rheologischer Prinzipien in der Gebirgsmechanik, insbesondere im Kontext des Hohlraumbaus.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die Grundlagen der Rheologie, verschiedene rheologische Untersuchungsmethoden (Labor- und In-situ-Messungen, dynamische Methoden), das Kriechen von Steinsalzen (inkl. Primär-, Sekundär- und Tertiärkriechen und deren Einflussfaktoren wie Temperatur, Belastung und petrographischer Aufbau), verschiedene Stoffgesetze für Steinsalze (mathematisch-empirische, modellrheologische und strukturelle Ansätze) und die Bedeutung des rheologischen Verhaltens für den Hohlraumbau.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Das Dokument zielt darauf ab, eine gebirgsmechanische Grundlage zum Verständnis des rheologischen Verhaltens von Steinsalzen zu liefern. Es präsentiert verschiedene Modelle und Ansätze aus der deutschsprachigen Literatur, zeigt Widersprüche auf und formuliert Thesen für eine koordinierte Zielsetzung zukünftiger Forschung.
Welche Arten von Stoffgesetzen werden für Steinsalze diskutiert?
Das Dokument unterscheidet zwischen mathematisch-empirischen, modellrheologischen und strukturellen Stoffgesetzen für Steinsalze. Es beschreibt die Ableitung eines Kriechgesetzes nach Knoll und stellt verschiedene Ansätze gegenüber.
Welche Rolle spielt das Kriechen im Kontext von Steinsalzen?
Das Kriechen von Steinsalzen wird detailliert behandelt. Das Dokument unterscheidet zwischen primärem, sekundärem und tertiärem Kriechen und analysiert den Einfluss von Temperatur, Belastung und petrographischem Aufbau auf das Kriechverhalten. Es präsentiert verschiedene Modelle zur Beschreibung des Kriechverhaltens.
Welche Untersuchungsmethoden zur Bestimmung rheologischer Parameter werden beschrieben?
Das Dokument beschreibt verschiedene Methoden zur Bestimmung rheologischer Zustandsgleichungen oder Parameter, darunter statistische Labormessungen, statische In-situ-Messungen und dynamische Messmethoden. Es betont die unterschiedlichen Ansätze in der Literatur und die Notwendigkeit zukünftiger Vergleichsstandards.
Welche Bedeutung hat die Rheologie für den Hohlraumbau?
Das Dokument behandelt die Auswirkungen des rheologischen Verhaltens von Salzgestein auf den Hohlraumbau. Es betont die Bedeutung der entwickelten Stoffgesetze für numerische Berechnungen mit der Finite-Elemente-Methode (FEM) und diskutiert die Rolle der Rheologie für die Sicherheit im Bergbau.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Dokuments?
Schlüsselwörter sind: Rheologie, Gebirgsmechanik, Steinsalz, Kriechverhalten, Stoffgesetze, Deformation, Spannung, Temperatur, Laborversuche, In-situ-Messungen, Hohlraumbau, Finite-Elemente-Methode (FEM), Elastizität, Plastizität, Viskosität, Kriechphasen (primär, sekundär, tertiär), Petrographischer Aufbau.
- Quote paper
- Dipl.-Ing. Dieter Wessels (Author), 1988, Gebirgsmechanische Grundlagen zum rheologischen Verhalten von Salzgesteinen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/432234