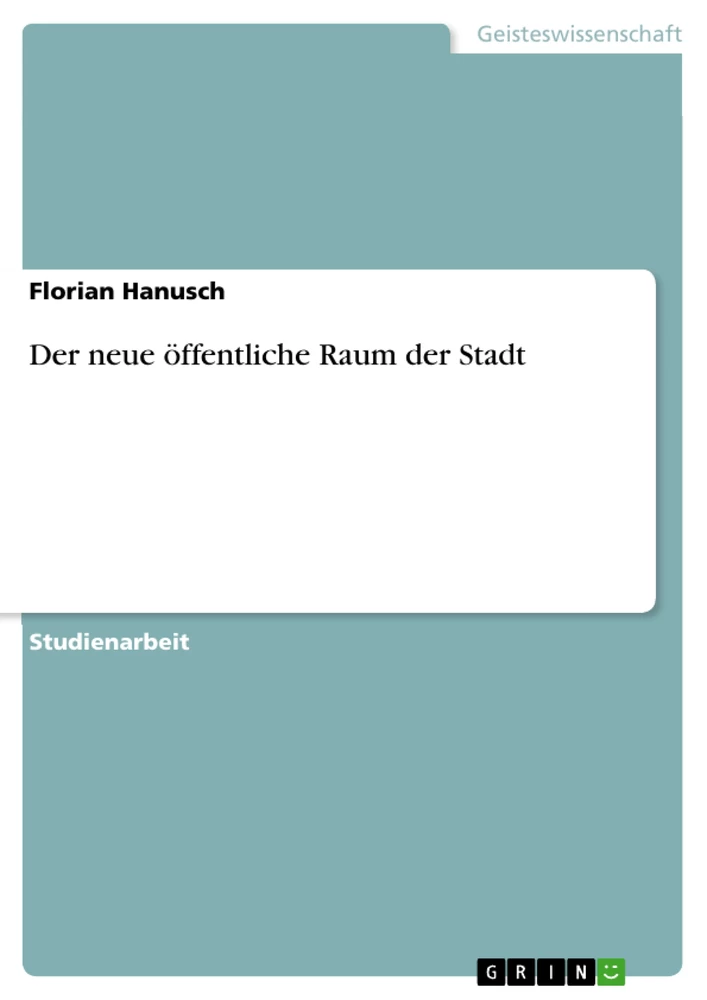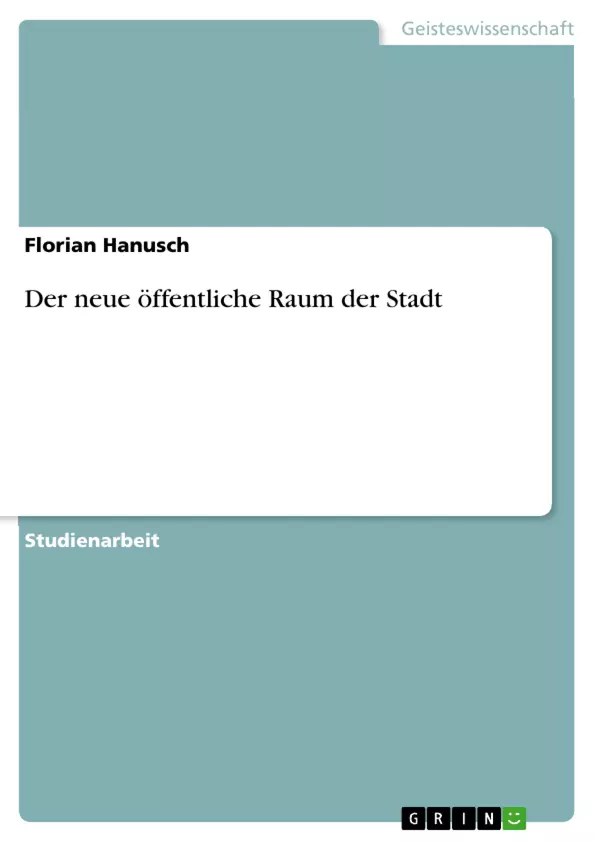Wie Markus Schroer und Dieter Läpple in ihren Texten „ Stadt als Prozess“ und „Phönix aus der Asche“ bemerken wird die Stadt als sozilogischer Gegenstand fast immer von einer negativen Sichtweise aus betrachtet. Die Rede ist vom Untergang oder Zerfall der Stadt und das Scheitern des urbanen Modells. Dabei ist diese Auffassung kein Konstrukt des 21. Jahrhunderts. Schon Johann Wolfgang von Goethe schrieb in einem seiner Romane: „Die Stadt ist selbst unangenehm, dagegen ringsumher eine unaussprechliche Schönheit der Natur.“ Auch Albrecht Göschel wirft in seinem Dossier „Stadtschrumpfung, Bedingung punktuellen Wachstums“ die Frage auf, ob die Städte unserer Zeit durch Suburbanisierung, regionale Abwanderung und dem demographisch bedingten Bevölkerungsrückgang bedroht sind, negative Konsequenzen für die Stadt, in Form von sinkender Lebensqualität, nach sich ziehen, und ob der Name „Stadt“ angesichts solcher Entwicklungen überhaupt noch gerechtfertigt sei.
Doch wie sieht es mit der Stadt im Jahre 2008 aus? Ist sie weiterhin Sorgenkind soziologischer Betrachtungsweisen oder gar auf dem besten Weg einer vollkommenden Gesundung? Bei meinen Recherchen fiel es anfangs nicht leicht, in den Kanon negativer Kritik einzustimmen, beschreiben doch Schlagwörter wie Ghettobildung, überschuldete Städte, Abwanderung oder öffentliche Überwachung alles andere als ein attraktives Bild der Stadt.
Bei genauerem Hinsehen fällt jedoch auf, dass die Stadt des 21. Jahrhunderts sehr wohl in der Lage ist, sich aus den Fesseln überholter, negativer Kritik zu befreien und ein neues, selbstbewusstes Auftreten an den Tag zu legen. Denn hinter der brüchigen Fassade der Stadt, in der sie so viele Experten sehen, tut sich etwas. Es entstehen neue Impulse, kreative Ideen, optische und funktionale Verbesserungen. Stichworte dazu sind: Wiederbelebung alter Industriestandorte der Stadt, Installation temporärer Räume, neue Wohnformen, Stadtverschönerung, Bürgerbeteiligungen, semi-public spaces, oder Private Public Partnership.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die überwachte Stadt
- Videokameras
- Gesichtserkennung
- Verhaltenserkennung
- Anti social behaviour
- Die exklusive Stadt
- Zugangsberichtungen
- Gated communities
- Die wiederbelebte Stadt
- Bürgerbeteiligungen
- Inszenierung und Festivalisierung
- Verkehrspolitik
- Öffentlicher Personennahverkehr
- Private public Partnership
- Temporäre Aktionen
- Zwischennutzungen
- Revitalisierung von Industrieanlagen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Entwicklung des öffentlichen Raums in Städten im 21. Jahrhundert und untersucht die sozialen Auswirkungen dieser Veränderungen. Sie fokussiert dabei auf die Themen der Überwachung, Exklusion und Revitalisierung städtischer Räume.
- Die wachsende Überwachung im öffentlichen Raum durch Videokameras, Gesichtserkennung und Verhaltenserkennung
- Die zunehmende Exklusion von bestimmten Bevölkerungsgruppen durch Zugangsschranken und Gated Communities
- Die Revitalisierung städtischer Räume durch Bürgerbeteiligung, Inszenierung und Festivalisierung, Verkehrspolitik, Private Public Partnerships und die Wiederbelebung alter Industriestandorte
- Die Bedeutung des öffentlichen Raums als Innovationsfeld für Wissen, Kultur und neue Lebensformen
- Die Debatte um das Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Privatsphäre im öffentlichen Raum
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die These auf, dass die Stadt des 21. Jahrhunderts im Wandel ist und sich von negativen soziologischen Betrachtungsweisen löst. Sie beleuchtet die Entstehung neuer Impulse und Entwicklungen in städtischen Räumen.
- Die überwachte Stadt: Dieses Kapitel analysiert den Trend zur Überwachung im öffentlichen Raum durch Videokameras, Gesichtserkennung und Verhaltenserkennung. Es beleuchtet die Auswirkungen dieser Entwicklung auf die Privatsphäre und die Sicherheit der Bürger.
- Die exklusive Stadt: Das Kapitel behandelt die Entstehung von Exklusionsformen im öffentlichen Raum, wie zum Beispiel Zugangsschranken und Gated Communities. Es diskutiert die sozialen Folgen dieser Entwicklungen.
- Die wiederbelebte Stadt: Dieses Kapitel untersucht die Revitalisierung städtischer Räume durch verschiedene Maßnahmen, wie Bürgerbeteiligung, Inszenierung und Festivalisierung, Verkehrspolitik, Private Public Partnerships und die Wiederbelebung alter Industriestandorte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Überwachung, Exklusion und Revitalisierung im öffentlichen Raum der Stadt. Sie beleuchtet die sozialen Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die Stadtgesellschaft und untersucht die Bedeutung des öffentlichen Raums als Innovationsfeld für Wissen, Kultur und neue Lebensformen. Weitere wichtige Themen sind die Sicherheit und die Privatsphäre der Bürger, die Debatte um städtische Leitbilder und die Entwicklung von alternativen Stadtmodellen.
- Arbeit zitieren
- Florian Hanusch (Autor:in), 2008, Der neue öffentliche Raum der Stadt, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/432106