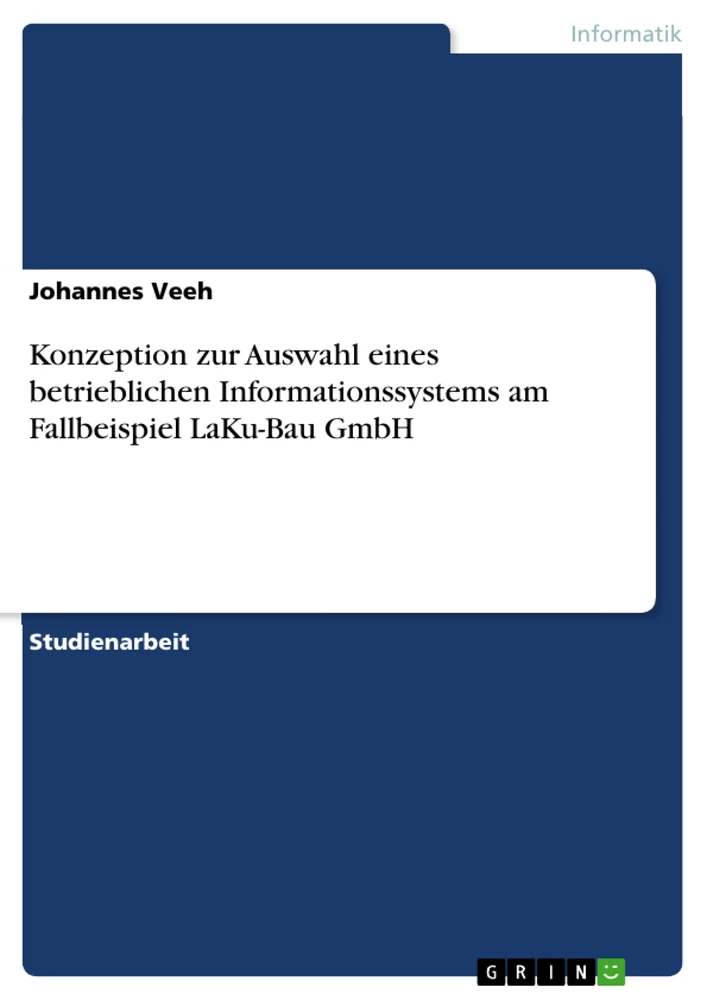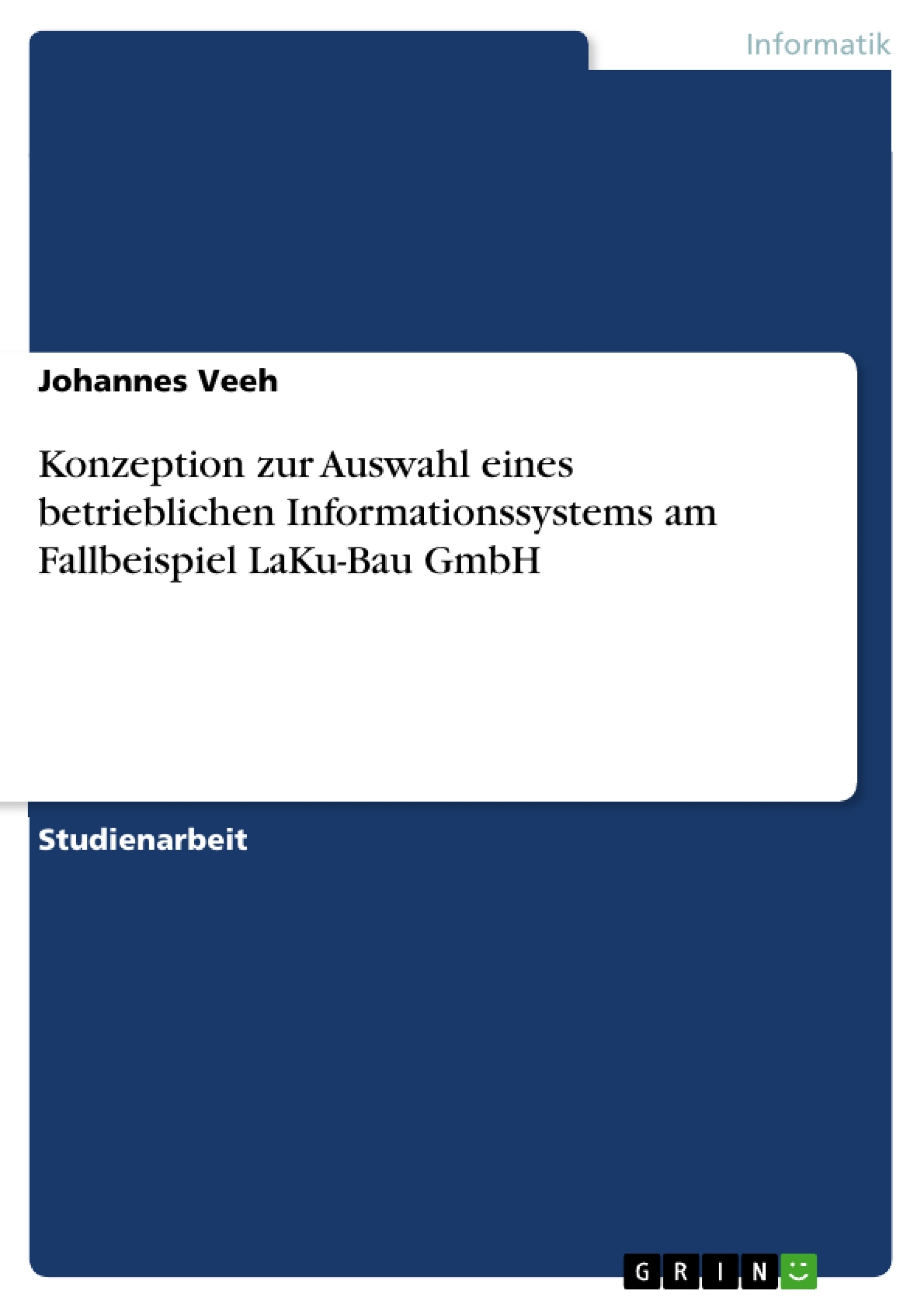Der Autor setzt sich in dieser Arbeit das Ziel, anhand eines Fallbeispiels aus dem Mittelstand, die strukturierte Vorgehensweise bei der Auswahl eines betrieblichen IS aufzuzeigen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Ausgestaltung der einzelnen Phasen der Methodik, wobei einige Elemente aus dem Projektmanagement Einzug finden werden. Die Einführung einer solchen Software stellt für ein Unternehmen ein nicht unerhebliches Risiko für den wirtschaftlichen Erfolg dar, eine sorgfältige Planung und Durchführung des Projekts ist daher unumgänglich.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Allgemeiner Teil
- 2.1 Ziele bei der Einführung eines betrieblichen Informationssystems
- 2.2 Notwendigkeit einer integrierten Lösung
- 2.3 Möglichkeiten der Integration von Informationssystemen
- 3 Projekt „IT im Kühlaggregatbau“
- 3.1 Phase 1: Bildung des Projektteams
- 3.2 Phase 2: Projektinitialisierung
- 3.3 Phase 3: Fachliche und IT-technische Anforderungsanalyse
- 3.4 Phase 4: Pflichtenhefterstellung
- 3.5 Phase 5: Softwareauswahl
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Auswahl eines betrieblichen Informationssystems (IS) für ein mittelständisches Unternehmen (KMU). Am Beispiel der fiktiven Kühlbaulat GmbH wird eine strukturierte Vorgehensweise zur Auswahl eines geeigneten Systems demonstriert. Im Fokus steht die detaillierte Beschreibung der einzelnen Phasen des Auswahlprozesses, wobei Elemente aus dem Projektmanagement integriert werden.
- Zielsetzung des Projekts „IT im Kühlaggregatbau“
- Bewertung der Notwendigkeit einer integrierten Lösung für das Unternehmen
- Analyse der verschiedenen Möglichkeiten der Integration von Informationssystemen
- Phase-by-Phase-Beschreibung der Softwareauswahl unter Berücksichtigung der relevanten Anforderungen und Kriterien
- Einbeziehung von Projektmanagement-Elementen zur Steigerung der Effizienz und Erfolgswahrscheinlichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Informationssysteme im Kontext des Mittelstands ein und erläutert die Relevanz von betrieblichen IS für die Wettbewerbsfähigkeit. Es wird der Fokus der Arbeit auf die Auswahl eines geeigneten IS unter Verwendung eines Fallbeispiels aus dem KMU-Sektor hervorgehoben.
Der allgemeine Teil beleuchtet die Ziele, die ein Unternehmen mit der Einführung eines IS verfolgen kann, insbesondere im Hinblick auf die Verbesserung der internen Kommunikation und die Optimierung von Prozessen. Des Weiteren wird die Notwendigkeit einer integrierten Lösung, wie z.B. eines ERP-Systems, im Vergleich zu funktionsorientierten Insellösungen betrachtet.
Im Kapitel „Projekt „IT im Kühlaggregatbau““ werden die einzelnen Phasen des Softwareauswahlprozesses unter Verwendung eines Phasenmodells dargestellt. Dabei werden die Schritte der Projektteam-Bildung, der Projektinitialisierung, der fachlichen und IT-technischen Anforderungsanalyse, der Pflichtenhefterstellung und der Softwareauswahl beschrieben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Auswahl eines betrieblichen Informationssystems, dem Einsatz von ERP-Systemen, der Integration von Anwendungssystemen, Projektmanagement, der Anforderungsanalyse, der Pflichtenhefterstellung und der Softwareauswahl im Kontext eines mittelständischen Unternehmens.
- Quote paper
- Johannes Veeh (Author), 2013, Konzeption zur Auswahl eines betrieblichen Informationssystems am Fallbeispiel LaKu-Bau GmbH, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/431124