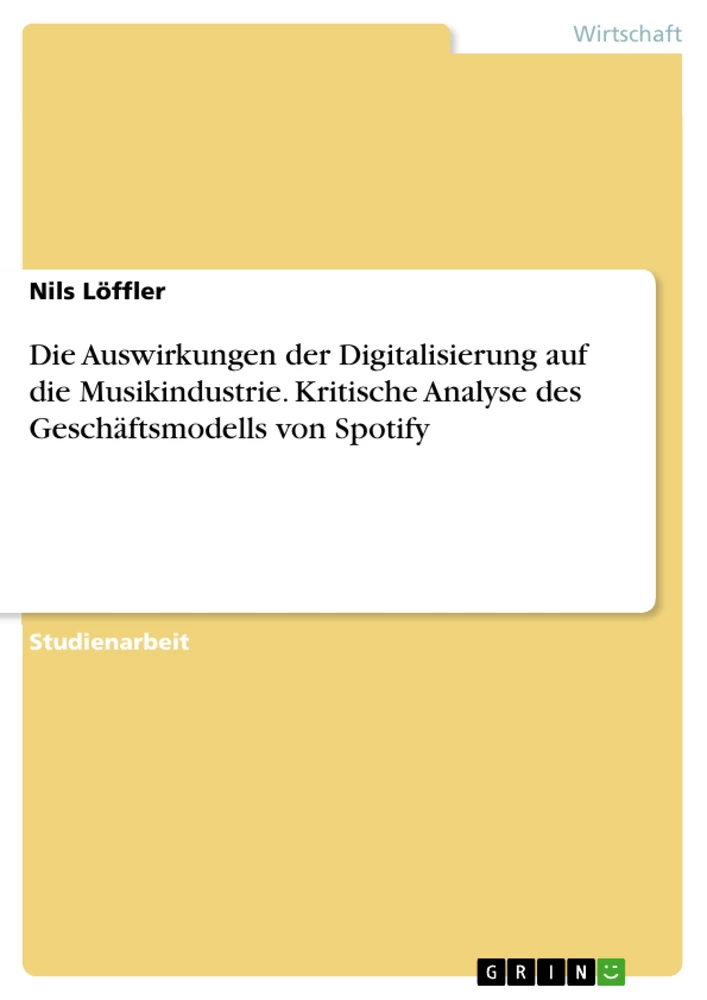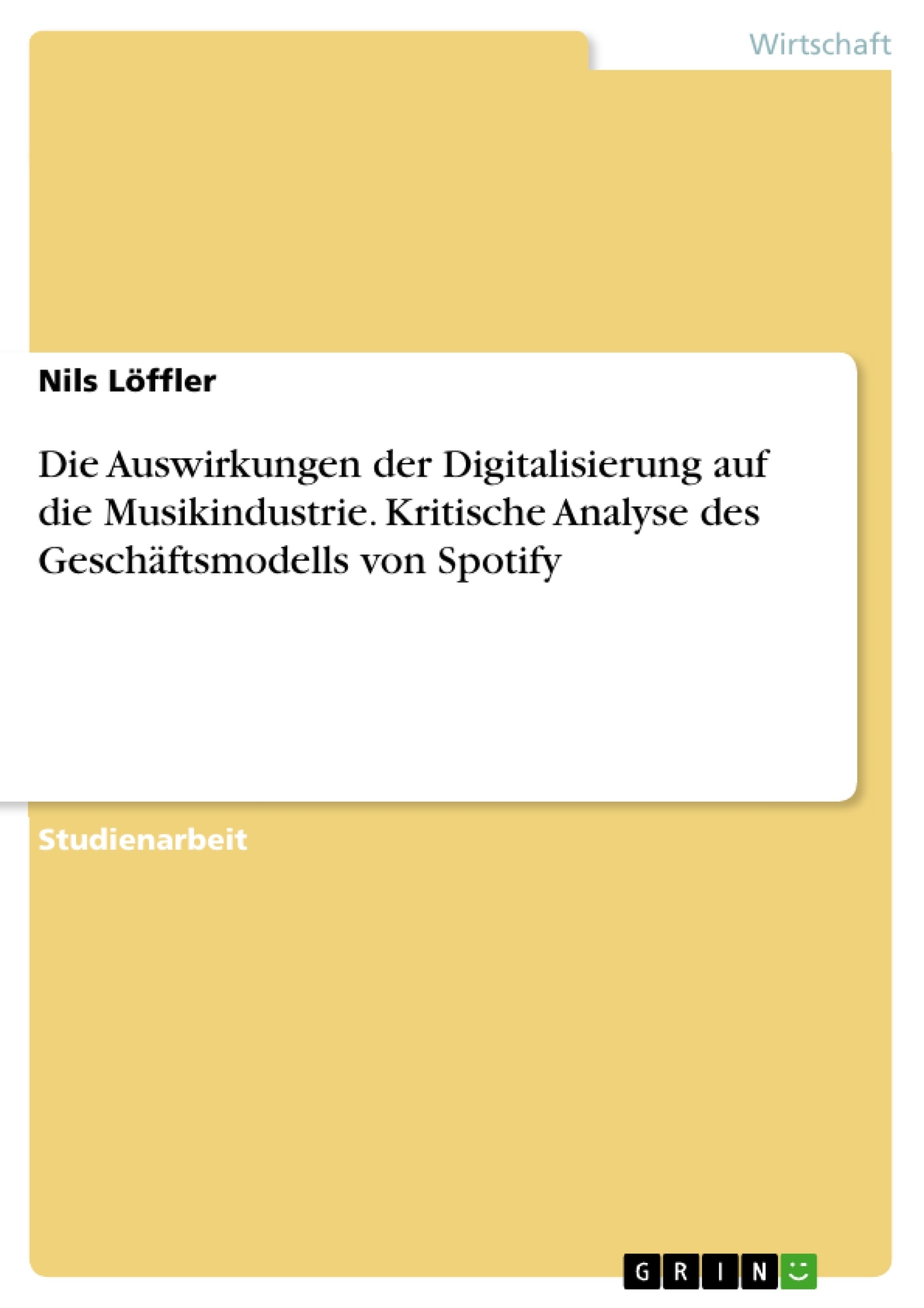Der Markt für Musik-Streaming boomt. Anbieter wie Spotify verzeichnen ein rasantes Wachstum an Kunden und Umsatz. Von dieser Entwicklung profitiert die gesamte Musikindustrie.
Doch profitieren wirklich alle Beteiligten von diesem Boom? Gerade die Streaming-Dienste, denen man den Aufschwung zu einem großen Teil zu verdanken hat, scheinen noch nicht das Geschäftsmodell gefunden zu haben, um dauerhaft profitabel zu wirtschaften. Zwar steigen mit den Nutzerzahlen auch die Umsätze, jedoch hat Spotify als größter Anbieter seit seiner Gründung noch kein positives Jahresergebnis erzielen können.
Um die Nachhaltigkeit dieser Anbieter zu betrachten, wird das Geschäftsmodell von Spotify analysiert und auf Chancen und Risiken für die Zukunft untersucht. Zunächst wird der Musikmarkt mit seinen wesentlichen Beteiligten vorgestellt und die Wertschöpfungskette in der Musikindustrie kurz erläutert. Im darauffolgenden Kapitel werden anhand des Beispiels Musik-Streaming die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Musikindustrie thematisiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Überblick über den Musikmarkt
- Die Marktstruktur und Akteure
- Die Wertschöpfungskette der Musikwirtschaft
- Die Digitalisierung der Musikindustrie
- Streaming als Beispiel für die Digitalisierung
- Der Aufschwung als Folge der Digitalisierung
- Der Streaming-Dienst Spotify
- Die Entwicklung
- Das Geschäftsmodell
- Die Analyse der Chancen und Risiken
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Seminararbeit analysiert das Geschäftsmodell von Spotify und untersucht dessen Chancen und Risiken für die Zukunft. Der Fokus liegt dabei auf den Auswirkungen der Digitalisierung auf die Musikindustrie und den damit einhergehenden Veränderungen der Wertschöpfungskette.
- Digitalisierung der Musikindustrie
- Streaming als Geschäftsmodell
- Wertschöpfungskette der Musikwirtschaft
- Chancen und Risiken von Spotify
- Nachhaltigkeit des Spotify-Geschäftsmodells
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Thematik der Digitalisierung in der Musikbranche vor, beleuchtet den Boom von Streaming-Diensten wie Spotify und die damit verbundenen Fragen der Nachhaltigkeit und Profitabilität.
- Überblick über den Musikmarkt: Dieses Kapitel präsentiert die wesentlichen Akteure und die Struktur des Musikmarktes. Darüber hinaus wird die Wertschöpfungskette in der Musikindustrie kurz erläutert.
- Die Digitalisierung der Musikindustrie: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung des Musik-Streamings als Beispiel für die digitale Revolution in der Musikbranche. Es wird der Aufschwung der Musikindustrie als Folge der Digitalisierung untersucht.
- Der Streaming-Dienst Spotify: Dieser Teil der Arbeit behandelt die Entwicklung von Spotify, analysiert dessen Geschäftsmodell und befasst sich mit den Chancen und Risiken für die Zukunft des Unternehmens.
Schlüsselwörter
Musikmarkt, Streaming, Digitalisierung, Geschäftsmodell, Spotify, Chancen, Risiken, Wertschöpfungskette, Musikindustrie.
- Arbeit zitieren
- Nils Löffler (Autor:in), 2018, Die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Musikindustrie. Kritische Analyse des Geschäftsmodells von Spotify, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/430888