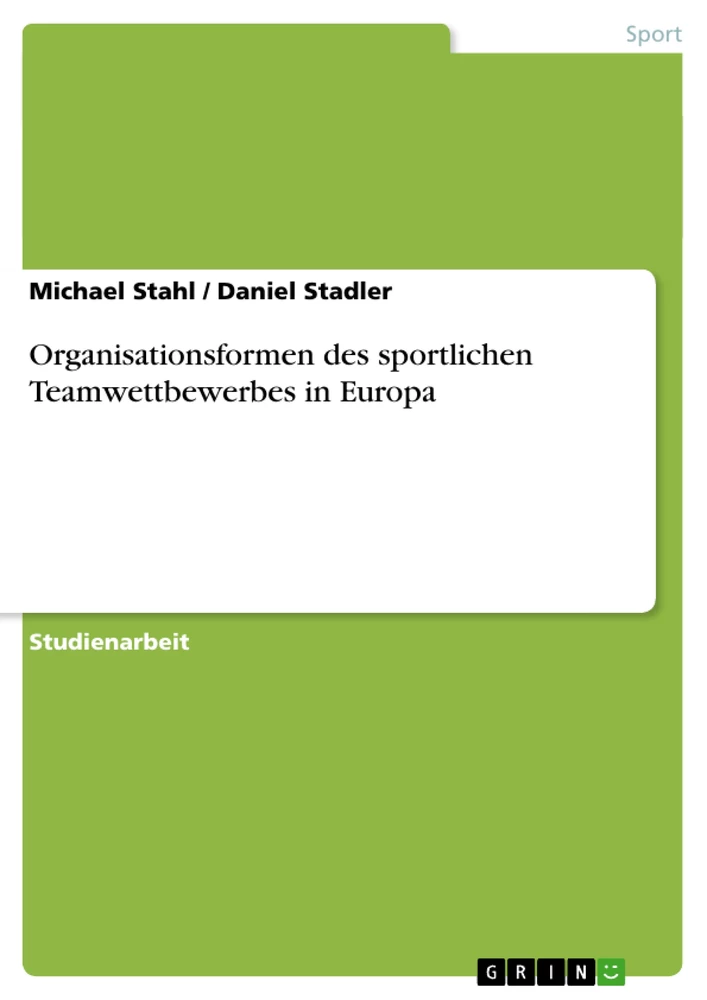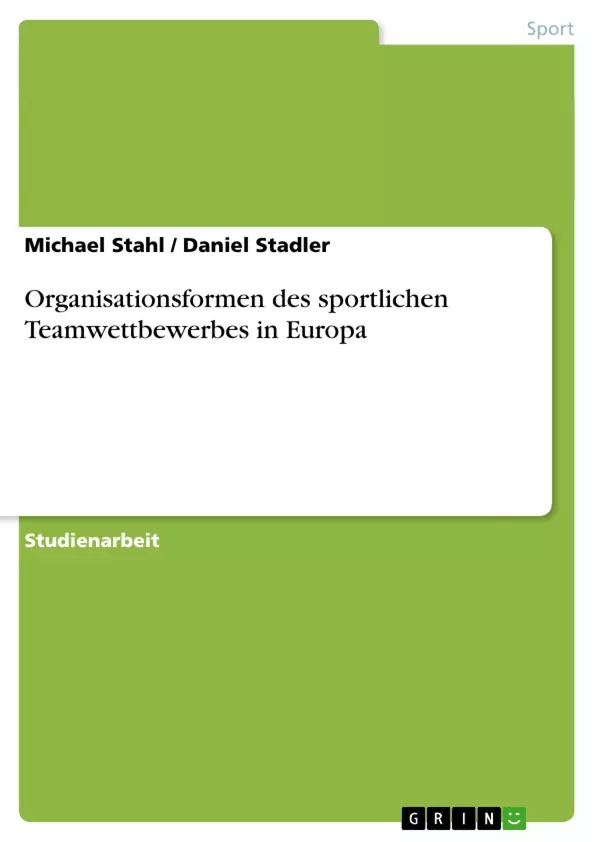Der noch recht junge Forschungsbereich der Sportökonomie weist einige Besonderheiten gegenüber der ‚herkömmlichen’ ökonomischen Theorie auf.
Während für Unternehmen gewinnmaximierendes Verhalten unterstellt werden darf, kann dies für Sportvereine nicht grundsätzlich so angenommen werden. Diskutiert wird daher in der Theorie, welche Variablen denn nun der Maximierung unterliegen. Im Gegenteil sogar dürfen Vereine gem. §21 BGB in ihrem Zweck „nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb“ ausgerichtet sein. Diskutiert wird daher in der Theorie welche Variablen denn nun der Maximierung unterliegen. Dies könnte sowohl eine Siegmaximierung oder Maximierung der sportlichen Leistungen unter der Nebenbedingung der Einhaltung des Budgets sein. Jedoch wäre auch die Nutzenmaximierung für den Verein oder die handelnden Organe möglich. Eine Umfrage unter 21 Bundesligavereinen ergab, dass zwei Drittel der Vereine versuchen, den Erfolg unter der Nebenbedingung der Einhaltung des Budgets zu maximieren.
Im Sport gibt es kein klassisches „Produkt“ als Output, denn der Produktionsprozess der Leistung ist schon das Ziel. Gerne diskutiert ist dieses Phänomen im Rahmen des Louis-Schmeling Paradox als Spezialfall, wonach die Schwergewichts-Boxkämpfe des Weltmeisters Joe Louis nur aufgrund des Gegners Max Schmeling als härtester Konkurrent für die Zuschauer interessant waren.
Während für Einzelsportarten „nur“ die Notwendigkeit besteht, einen Gegner zu finden, gibt es für Teamsportarten das Phänomen der Mannschaftsproduktion, welche in zwei Stufen abläuft. Auf einer ersten Stufe muss ein Team durch verschiedene einzelne Spieler zusammengesetzt werden, auf einer zweiten Stufe findet dann die „gemeinsame Produktion“ des Wettkampfes zusammen mit einer anderen Mannschaft statt. Hierbei kann schon die Notwendigkeit der Schaffung einer Institution in Form einer Liga erkannt werden, die durch ihre Organisation bspw. Koordinationsproblemen und Motivationsproblemen entgegenwirkt.
Die Organisation des Wettbewerbes ist jedoch ebenfalls von erheblicher Relevanz für die Attraktivität einer Sportveranstaltung. Der Grund liegt in der fehlenden Einbettung in ein sog. Metaspiel, wie es bspw. die Bundesliga mit der Möglichkeit der Erlangung eines Meistertitels bietet. Daher ist sie existenziell für die Aufrechterhaltung des professionellen Sports und seiner Attraktivität in der Öffentlichkeit und soll im Folgenden den Kern dieser Arbeit darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Besonderheiten der Sportökonomie
- Überblick über Organisationsformen des sportlichen Wettbewerbe
- Wettbewerbsform
- Aufgaben
- Ausgeglichenheit des Wettbewerbes
- Organisation professioneller europäischer Sportligen
- Fußball
- Ligaaufbau
- Finanzmittelallokation
- Eishockey
- Ligaaufbau
- Finanzmittelallokation (ökonomisch)
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit den Organisationsformen des sportlichen Teamwettbewerbs in Europa. Sie untersucht die Besonderheiten der Sportökonomie im Vergleich zur herkömmlichen ökonomischen Theorie und analysiert die Organisation professioneller Sportligen, insbesondere im Fußball und Eishockey. Die Arbeit befasst sich mit den unterschiedlichen Ligaaufbauten, den Finanzierungsmechanismen und der Ausgeglichenheit des Wettbewerbes.
- Besonderheiten der Sportökonomie
- Organisation professioneller Sportligen
- Finanzierung von Sportvereinen
- Ausgeglichenheit des Wettbewerbes
- Ligaaufbau und Wettbewerbsform
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Dieses Kapitel beleuchtet die Besonderheiten der Sportökonomie im Vergleich zur traditionellen ökonomischen Theorie. Es stellt die unterschiedlichen Zielsetzungen von Sportvereinen und -unternehmen dar und diskutiert die verschiedenen Variablen, die der Maximierung unterliegen können.
- Fußball: Das Kapitel befasst sich mit dem Ligaaufbau im europäischen Fußball und der Allokation von Finanzmitteln. Es beleuchtet die unterschiedlichen Finanzierungsmodelle und die Auswirkungen auf die Wettbewerbslandschaft.
- Eishockey: Dieses Kapitel untersucht die Organisation des europäischen Eishockey-Wettbewerbs. Es analysiert den Ligaaufbau, die Finanzierungsmechanismen und die ökonomischen Aspekte der Finanzmittelallokation.
Schlüsselwörter
Sportökonomie, Organisationsformen, Teamwettbewerb, Europa, Fußball, Eishockey, Ligaaufbau, Finanzmittelallokation, Wettbewerbsausgeglichenheit, Gewinnmaximierung, Siegmaximierung, Nutzenmaximierung, Kapitalgesellschaft, GmbH & Co. KGaA, AG.
- Arbeit zitieren
- Michael Stahl (Autor:in), Daniel Stadler (Autor:in), 2005, Organisationsformen des sportlichen Teamwettbewerbes in Europa, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/43029