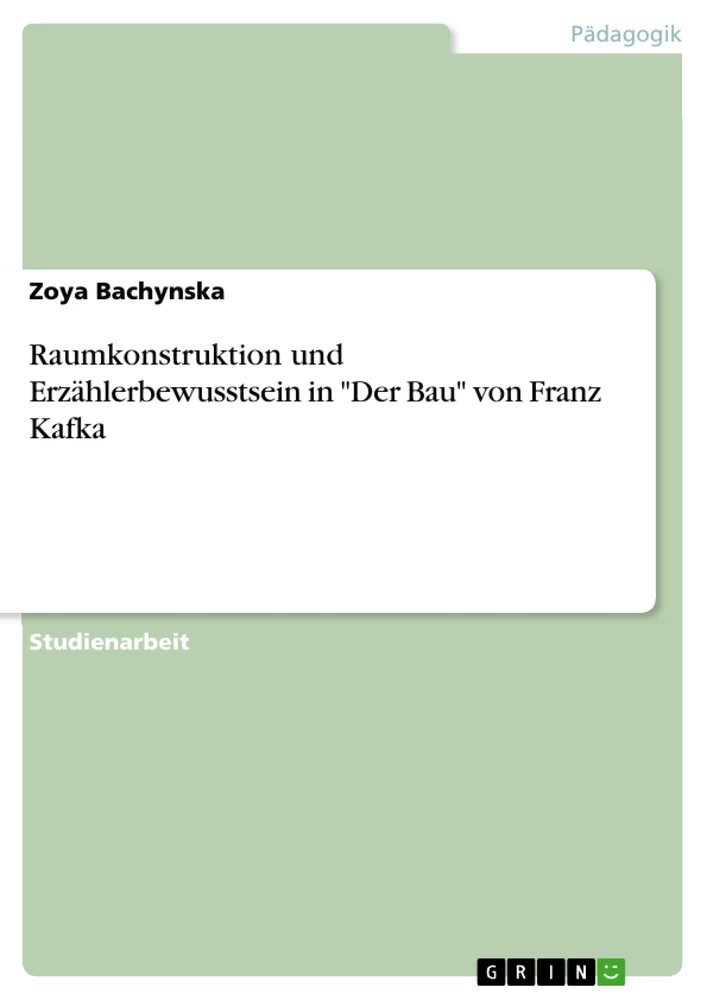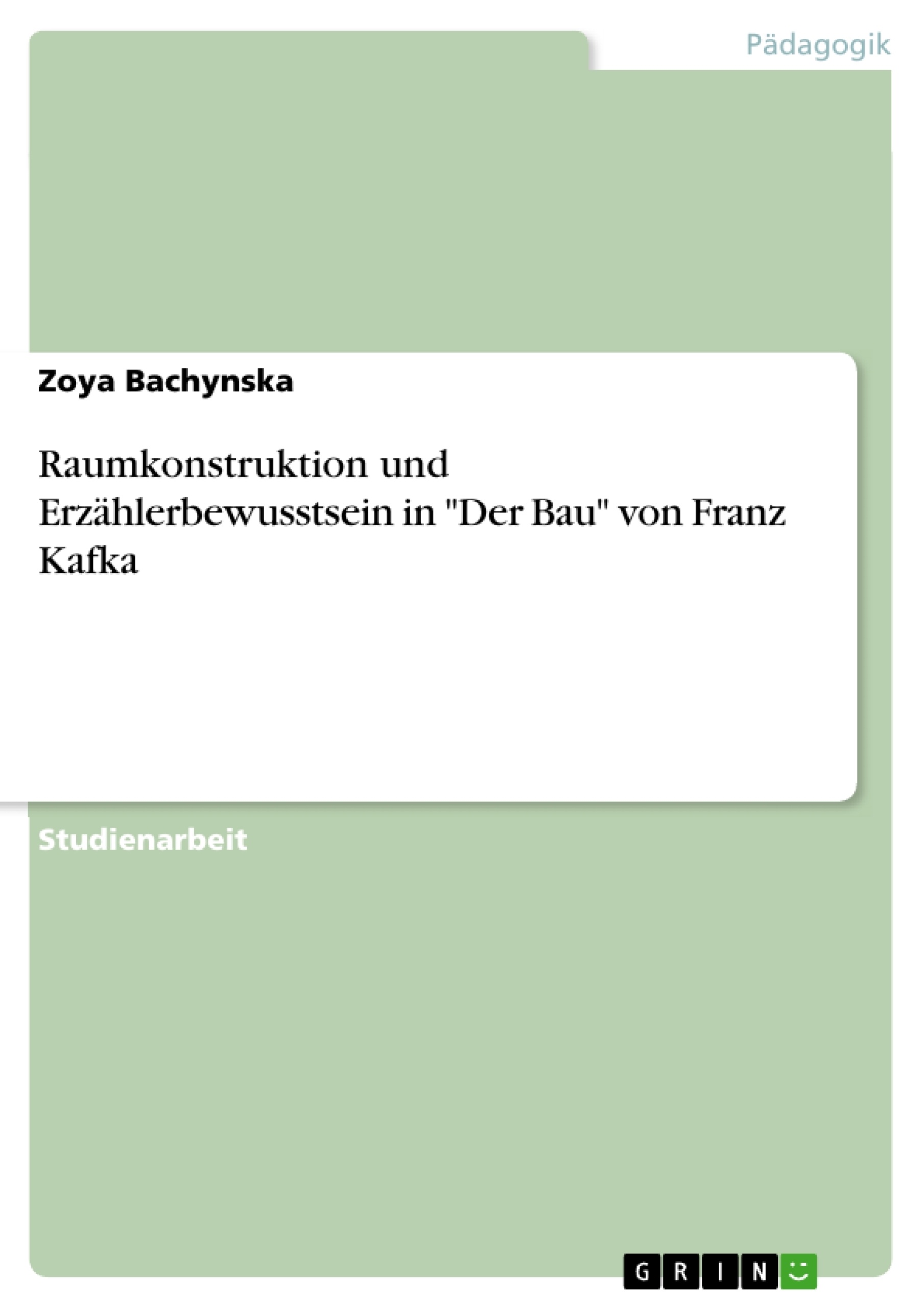Die Erzählung „Der Bau“ von Franz Kafka, die zwischen 1923 und 1924 entstanden ist, gehört zu den späten Erzählungen Kafkas und bietet wie seine sämtlichen Texte eine Menge an Deutungs- und Interpretationsraum. Der Begriff des Raums ist diesbezüglich überaus passend, da der Raum ein zentraler Begriff dieser Arbeit ist.
Die Forschungsliteratur zu dieser Erzählung geht in unterschiedlichste Richtungen und umfasst die verschiedensten Deutungsansätze. „Die Mannigfaltigkeit des Baues gibt […] mannigfaltigere Möglichkeiten“, wie es in dem Text selbst heißt. Im Verlauf dieser Arbeit wird der Fokus auf den formanalytischen und den allegorischen Ansatz gelegt.
Den Handlungsraum in der Erzählung bildet der Bau, der von einem tierähnlichen Wesen, das gleichzeitig der Erzähler ist, bewohnt wird. Es ist ein komplexer imaginärer Raum, der sehr detailliert beschrieben wird. Die Beschreibungen sind zumeist jedoch verwirrend und widersprüchlich und die Erzählung entzieht sich dem Verständnis des Lesers. Aufgrund der bildhaften Sprache und der innigen Verbundenheit des Wesens mit seinem Bau kann man den Bau allegorisch als ein Abbild des Erzählerbewusstseins deuten. Somit besagt die Hauptthese dieser Arbeit, dass die Konstruktion und die Gestaltung des Raums die Bewusstseinszustände des Erzählers widerspiegeln.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Narratologische Analyse
- 2.1 Beschreibung
- 2.1.1 Lokale und temporale Distanz
- 2.2 Bewusstseinsdarstellung
- 2.3 Bildlichkeit
- 3. Raumkonstruktion und Erzählerbewusstsein
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Franz Kafkas Erzählung „Der Bau“ unter dem Aspekt der Raumkonstruktion und ihrer Beziehung zum Erzählerbewusstsein. Der Fokus liegt auf der formanalytischen und allegorischen Interpretation des Raumes als Spiegelbild des inneren Erlebens des tierartigen Ich-Erzählers. Die narratologische Analyse der Raumdarstellung steht im Mittelpunkt der Untersuchung.
- Narratologische Analyse des Raums in "Der Bau"
- Beziehung zwischen Raumkonstruktion und Erzählerbewusstsein
- Allegorische Interpretation des Baus als Abbild des inneren Zustands
- Analyse von Beschreibungstechniken und Bewusstseinsdarstellung
- Untersuchung der Rolle der Bildlichkeit in der Raumgestaltung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Erzählung „Der Bau“ von Franz Kafka ein und erläutert die zentrale Rolle des Raums in der Geschichte. Sie beschreibt den reichhaltigen Interpretationsraum der Erzählung und benennt den formanalytischen und allegorischen Ansatz als Fokus der Arbeit. Die Hauptthese, dass die Raumkonstruktion die Bewusstseinszustände des Erzählers widerspiegelt, wird vorgestellt, sowie die methodische Vorgehensweise mittels narratologischer Analyse des Raumes und seiner Beziehung zum Erzählerbewusstsein.
2. Narratologische Analyse: Dieses Kapitel legt den Grundstein für die Analyse, indem es ein homogenes Verständnis von literarischem Raum und dessen Darstellung etabliert. Es definiert den literarischen Raum als ein fiktionales Konstrukt, das sich vom realen Raum unterscheidet und symbolische, allegorische und assoziative Bedeutungen tragen kann. Es werden verschiedene Arten der Raumdarstellung in narrativen Texten vorgestellt, insbesondere die Rolle des Erzählers in der Vermittlung und Wahrnehmung des Raumes. Die zentralen narratologischen Verfahren – Beschreibung, Bewusstseinsdarstellung und Bildlichkeit – werden als Werkzeuge der Raumgestaltung identifiziert und als Grundlage für die folgende Analyse von "Der Bau" etabliert.
2.1 Beschreibung: Dieses Unterkapitel konzentriert sich auf die Beschreibungstechniken in Kafkas Erzählung. Es wird erläutert, wie die Beschreibungen des Baus, oft versteckt im Gedankenfluss des Ich-Erzählers, eher wertend und instabil sind, im Gegensatz zu einer objektiven, wertneutralen Beschreibung. Beispiele wie die Beschreibung der "engen, ziemlich ungefährlichen Wege" oder die widersprüchliche Darstellung der Stille als sowohl schön als auch trügerisch werden analysiert. Die Beschreibung des Baus als "Labyrinth" mit seinen vielen Wegen und dem zentralen Platz wird detailliert dargestellt, ebenso wie die spärliche Schilderung der Außenwelt und die räumliche Trennung zwischen Innen- und Außenwelt. Die Perspektive der "erzählten Raumwahrnehmung" wird als zentrale Technik der Beschreibung identifiziert.
Schlüsselwörter
Franz Kafka, Der Bau, Narratologie, Raumdarstellung, Erzählerbewusstsein, Allegorie, Beschreibung, Bildlichkeit, Bewusstseinsdarstellung, fiktionaler Raum, Raumkonstruktion.
Häufig gestellte Fragen zu Franz Kafkas "Der Bau"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Franz Kafkas Erzählung "Der Bau" unter narratologischen Gesichtspunkten, mit besonderem Fokus auf die Raumkonstruktion und deren Beziehung zum Erzählerbewusstsein. Die Analyse zielt auf eine formanalytische und allegorische Interpretation des Raumes als Spiegelbild des inneren Erlebens des Ich-Erzählers ab.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die narratologische Analyse des Raumes in "Der Bau", die Beziehung zwischen Raumkonstruktion und Erzählerbewusstsein, die allegorische Interpretation des Baus als Abbild des inneren Zustands, die Analyse von Beschreibungstechniken und Bewusstseinsdarstellung sowie die Untersuchung der Rolle der Bildlichkeit in der Raumgestaltung.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur narratologischen Analyse (mit Unterkapiteln zu Beschreibung, Bewusstseinsdarstellung und Bildlichkeit), ein Kapitel zur Raumkonstruktion und Erzählerbewusstsein und ein Fazit. Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die methodische Vorgehensweise dar. Das Hauptkapitel zur narratologischen Analyse legt die theoretischen Grundlagen und analysiert die Raumdarstellung in Kafkas Erzählung. Das dritte Kapitel vertieft den Zusammenhang zwischen Raum und Erzählerbewusstsein. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine narratologische Analysemethode, um die Raumdarstellung und deren Beziehung zum Erzählerbewusstsein zu untersuchen. Dabei werden Beschreibungstechniken, Bewusstseinsdarstellung und Bildlichkeit als zentrale Analyseinstrumente eingesetzt. Die Interpretation erfolgt sowohl formanalytisch als auch allegorisch.
Welche Rolle spielt die Raumdarstellung in "Der Bau"?
Die Raumdarstellung in "Der Bau" ist zentral für das Verständnis der Erzählung. Der Bau selbst wird als komplexes, vielschichtiges Konstrukt interpretiert, das den inneren Zustand und die Bewusstseinszustände des Ich-Erzählers symbolisiert. Die Beschreibungen des Raumes sind oft widersprüchlich und instabil, spiegelnd die Unsicherheit und den inneren Konflikt des Erzählers.
Wie wird der Raum beschrieben?
Der Raum wird in "Der Bau" durch verschiedene Beschreibungstechniken dargestellt, oft versteckt im Gedankenfluss des Ich-Erzählers. Die Beschreibungen sind eher wertend und instabil, im Gegensatz zu einer objektiven Darstellung. Der Bau wird als Labyrinth mit vielen Wegen und einem zentralen Platz beschrieben. Die Außenwelt wird spärlich geschildert, was die räumliche Trennung zwischen Innen- und Außenwelt betont.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Franz Kafka, Der Bau, Narratologie, Raumdarstellung, Erzählerbewusstsein, Allegorie, Beschreibung, Bildlichkeit, Bewusstseinsdarstellung, fiktionaler Raum, Raumkonstruktion.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die zentrale These der Arbeit ist, dass die Raumkonstruktion in Franz Kafkas "Der Bau" die Bewusstseinszustände des Erzählers widerspiegelt. Der Bau fungiert als allegorisches Abbild des inneren Zustands des Ich-Erzählers.
- Arbeit zitieren
- Zoya Bachynska (Autor:in), 2016, Raumkonstruktion und Erzählerbewusstsein in "Der Bau" von Franz Kafka, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/430212