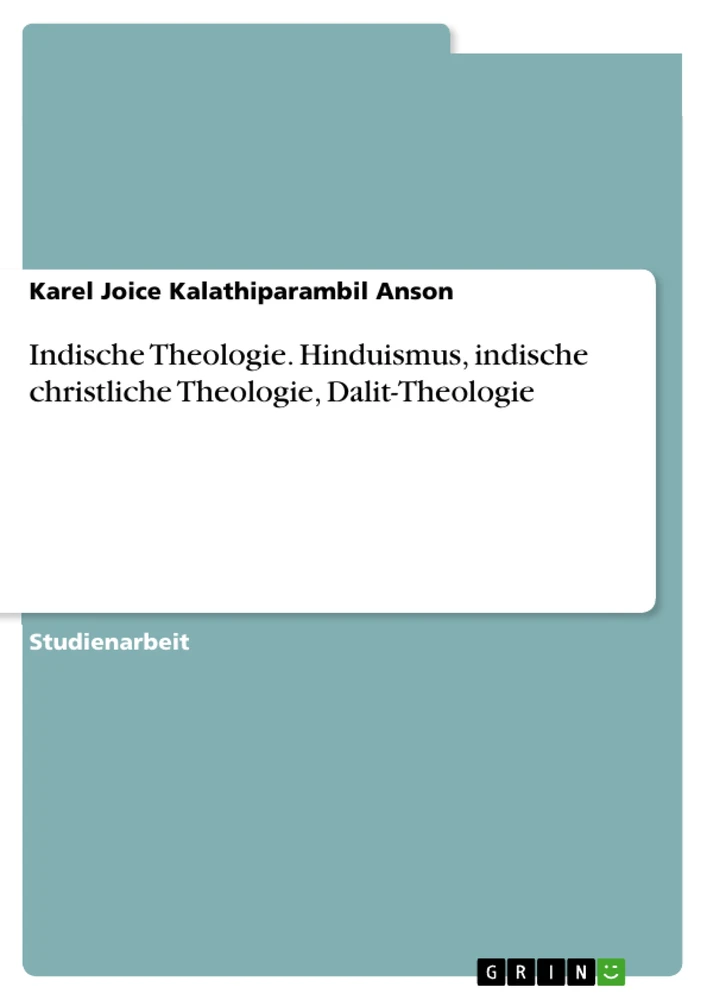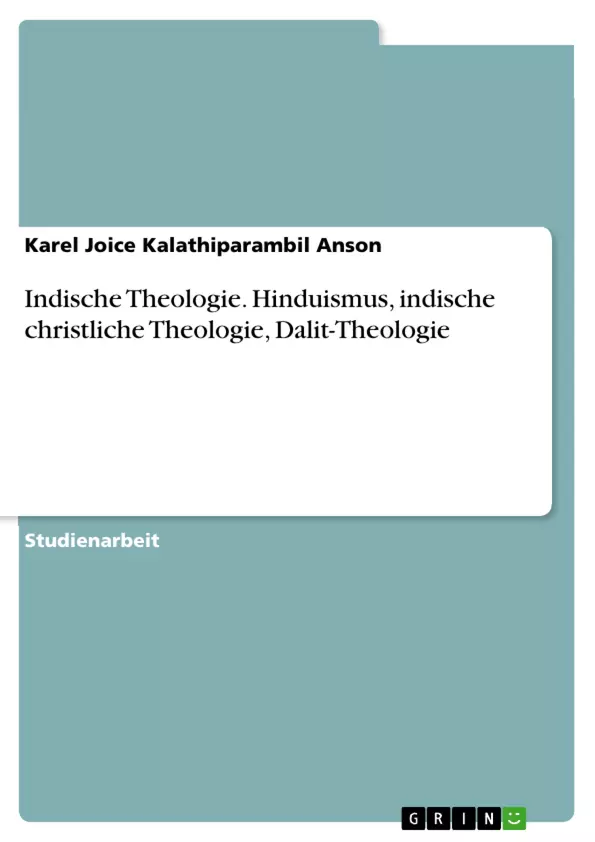Diese Arbeit beschäftigt sich zuerst mit dem Hinduismus, sowohl in seinen religiösen als auch in seinen philosophischen Aspekten, dann auch mit der indischen christlichen Theologie. Die Pioniere und einige wichtige Begriffe der indischen Theologie sind hier genannt. Die Dalit-Theologie wird in dieser Arbeit als eine Theologie der Unberuhbaren bezeichnet.
Inkulturation bezeichnet das Einbringen von Verhaltensmustern, Gedanken über Dinge oder Ansichten von einer Kultur in eine andere. Vor allem im Bereich der christlichen Mission bzw. Evangelisation wird diese Methode diskutiert und im Bereich der großen christlichen Kirchen teilweise als Grundlage genommen. Dies kann Auswirkungen zum Beispiel im Blick auf die Liturgie haben. Die Methode ist keineswegs neu; schon seit frühester christlicher Zeit wird in der Mission so verfahren.
Die Koexistenz des Christentums mit anderen Kulturen stammt aus der apostolischen Zeit. Vor seiner Himmelfahrt belehrte Jesus seine Jünger, seine Lehren bis zum Ende der Erde zu verbreiten (Mk 16,15), aber er sagte ihnen nicht, wie sie das machen sollten. Paulus Rede an die Griechen in Athen (Apg 17, 22-33) könnte als erster Versuch der Inkulturation betrachtet werden. Um das Jahr 50 beriefen die Apostel die erste Synode der Kirche ein, die Synode von Jerusalem, um zu entscheiden, ob die Kirche Heiden aufnehmen darf. Die Synode bestätigte, dass Heiden als Christen akzeptiert werden können, ohne vorher zum Judentum konvertiert zu haben.
Wie der heilige Paulus von einem unbekannten Gott der Griechen sprechen konnte, kann man auch vom ,,verborgenen Christus" der anderen Religionensprechen. Das Christentum ist heute ein ebenso globales wie interkulturelles Phänomen. Christliche Präsenz außerhalb Europas ist durch die kulturell-religiösen, sozialen und politischen Kontexte geprägt. Theologie wird irrelevant und unecht sein, wenn sie von der Lebenssituation der Menschen getrennt ist, für die sie erstellt ist.
Für die katholische Kirche war das Zweite Vatikanische Konzil eine deutliche Markierung. So betont die Pastoralkonstitution: ,,Denn so wird in jedem Volk die Fähigkeit, die Botschaft Christi auf eigene Weise auszusagen, entwickelt und zugleich der lebhafte Austausch zwischen der Kirche und den verschiedenen nationalen Kulturen gefördert“ (GS 44). Diese Aufforderung der Konstitution ist, in einer Weise, ein Aufruf, sich für eine kontextuelle Theologie zu engagieren und für den Glauben in Relevanz oder Kontext.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Typen kontextueller Theologie
- 2.1 Befreiungstheologie
- 2.2 Inkulturations- und Dialogtheologie
- 3. Kontextualisierung im indischen Kontext
- 3.1 Der Anfang indischer christlicher Theologie
- 3.1.1 Robert de Nobili (1577-1656)
- 3.1.2 Raja Ram Mohan Roy (1772-1833) und Keshab Chandra Sen (1838-1884)
- 3.1.3 Brahmabandhav Upadhyana (1861-1907)
- 3.2 Themen der indischen Theologie
- 3.2.1 Brahman
- 3.2.2 Bhakti
- 3.2.3 Shruti und Shraddha
- 3.2.4 Advaita und Tattvamasi
- 3.3 Interreligiöser Dialog in Indien
- 4. Raimundo Panikkar (1918-2010)
- 4.1 Die pluralistische Theologie
- 4.2 Die Begegnung zwischen dem Christentum und dem Hinduismus
- 5. Dalit-Theologie
- 5.1 Der Kontext
- 5.2 Inhalt der Dalit-Theologie
- 5.3 Die Rolle der Dalit-Theologie
- 6. Der Weg zu einer indischen Liturgie
- 7. Die römische Kritik
- 8. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die indische Theologie, ihre Entwicklung und ihre zentralen Themen im Kontext der Kontextualisierung des Christentums in Indien. Sie beleuchtet die Herausforderungen und Chancen interreligiösen Dialogs und die Bedeutung von Inkulturation für die christliche Glaubensverkündigung in einem vielschichtigen kulturellen Umfeld.
- Kontextualisierung des Christentums in Indien
- Entwicklung der indischen christlichen Theologie
- Interreligiöser Dialog zwischen Christentum und Hinduismus
- Bedeutung der Inkulturation und Befreiungstheologie
- Die Dalit-Theologie als Ausdruck von Protest und Befreiung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Inkulturation im christlichen Kontext ein und beleuchtet die historische Entwicklung der Auseinandersetzung mit anderen Kulturen. Sie betont die Relevanz kontextueller Theologie und verweist auf das Zweite Vatikanische Konzil als wichtigen Wendepunkt für die katholische Kirche in Bezug auf die Anpassung des Glaubens an verschiedene kulturelle Kontexte. Der Fokus liegt auf der Bedeutung einer Theologie, die sich mit der Lebenssituation der Menschen auseinandersetzt und die Herausforderungen der globalen und interkulturellen Verbreitung des Christentums adressiert. Die Arbeit kündigt die Fokussierung auf den Hinduismus und die indische christliche Theologie an.
2. Typen kontextueller Theologie: Dieses Kapitel differenziert zwischen verschiedenen Typen kontextueller Theologien. Es stellt die Befreiungstheologie heraus, die sich mit sozioökonomischen und politischen Unterdrückungen auseinandersetzt, und die Inkulturations- und Dialogtheologien, die die kulturelle und religiöse Dimension des Kontextes betonen. Der Unterschied zwischen theologischen Bewegungen und individuellen Gedankengebäuden wird verdeutlicht. Das Kapitel liefert eine theoretische Grundlage für die folgende Analyse der indischen Theologie.
3. Kontextualisierung im indischen Kontext: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Beginn indischer christlicher Theologie. Es beschreibt die frühen Versuche einer Kontextualisierung durch Robert de Nobili, der soziokulturelle Anpassungen vornahm und wertvolle Elemente hinduistischer Schriften erkannte. Weiterhin werden die Beiträge hinduistischer Reformer wie Raja Ram Mohan Roy und Keshab Chandra Sen dargestellt, die, obwohl selbst keine Christen, durch ihre reformorientierten Ansätze zur Entwicklung einer indischen Christologie beitrugen. Das Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis der komplexen Interaktion zwischen Christentum und Hinduismus in Indien.
4. Raimundo Panikkar (1918-2010): Dieses Kapitel widmet sich dem Werk von Raimundo Panikkar und dessen pluralistischer Theologie. Es untersucht seine Auseinandersetzung mit dem Hinduismus und dessen Beitrag zum interreligiösen Dialog. Panikkars Ideen zur Begegnung zwischen Christentum und Hinduismus werden ausführlich erläutert. Der Fokus liegt auf seinen Ansätzen zur Integration verschiedener religiöser Perspektiven.
5. Dalit-Theologie: Dieses Kapitel analysiert die Dalit-Theologie als eine Theologie der Unberührbaren. Es beschreibt den Kontext, die Inhalte und die Rolle dieser Theologie im Kampf gegen das Kastensystem. Die Kapitel beleuchten die Bedeutung dieser Theologie als Ausdruck des Protests und der Forderung nach sozialer Gerechtigkeit und Befreiung für die marginalisierten Gruppen in Indien.
6. Der Weg zu einer indischen Liturgie: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Entwicklung einer indischen Liturgie als Ausdruck der Inkulturation. Es wird analysiert, wie liturgische Praktiken an den indischen Kontext angepasst werden können, um den Glauben authentischer auszudrücken. Die Herausforderungen und Möglichkeiten einer solchen Kontextualisierung werden beleuchtet.
7. Die römische Kritik: Dieses Kapitel behandelt die kritischen Reaktionen der römischen Kirche auf die Entwicklungen der indischen Theologie. Es werden die verschiedenen Aspekte der Kritik beleuchtet und die daraus resultierenden Konflikte analysiert.
Häufig gestellte Fragen zur Indischen Theologie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die indische Theologie, ihre Entwicklung und zentralen Themen im Kontext der Kontextualisierung des Christentums in Indien. Sie beleuchtet die Herausforderungen und Chancen interreligiösen Dialogs und die Bedeutung von Inkulturation für die christliche Glaubensverkündigung in einem vielschichtigen kulturellen Umfeld.
Welche Typen kontextueller Theologie werden behandelt?
Die Arbeit differenziert zwischen verschiedenen Typen kontextueller Theologien, insbesondere der Befreiungstheologie (die sich mit sozioökonomischen und politischen Unterdrückungen auseinandersetzt) und der Inkulturations- und Dialogtheologie (die die kulturelle und religiöse Dimension des Kontextes betonen). Der Unterschied zwischen theologischen Bewegungen und individuellen Gedankengebäuden wird erläutert.
Wie wird die Kontextualisierung im indischen Kontext dargestellt?
Die Arbeit beschreibt den Beginn indischer christlicher Theologie, die frühen Versuche einer Kontextualisierung durch Robert de Nobili und die Beiträge hinduistischer Reformer wie Raja Ram Mohan Roy und Keshab Chandra Sen. Sie untersucht die komplexe Interaktion zwischen Christentum und Hinduismus in Indien und beleuchtet wichtige Themen wie Brahman, Bhakti, Shruti und Shraddha, Advaita und Tattvamasi.
Welche Rolle spielt Raimundo Panikkar in dieser Arbeit?
Die Arbeit widmet sich dem Werk von Raimundo Panikkar und seiner pluralistischen Theologie. Seine Auseinandersetzung mit dem Hinduismus und sein Beitrag zum interreligiösen Dialog, insbesondere seine Ansätze zur Integration verschiedener religiöser Perspektiven, werden ausführlich erläutert.
Was ist die Dalit-Theologie und ihre Bedeutung?
Die Arbeit analysiert die Dalit-Theologie als Theologie der Unberührbaren, beschreibt den Kontext, die Inhalte und die Rolle dieser Theologie im Kampf gegen das Kastensystem. Ihre Bedeutung als Ausdruck des Protests und der Forderung nach sozialer Gerechtigkeit und Befreiung für marginalisierte Gruppen wird hervorgehoben.
Wie wird der Weg zu einer indischen Liturgie beschrieben?
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung einer indischen Liturgie als Ausdruck der Inkulturation. Sie analysiert die Anpassung liturgischer Praktiken an den indischen Kontext und beleuchtet die Herausforderungen und Möglichkeiten einer solchen Kontextualisierung.
Wie wird die römische Kritik an der indischen Theologie behandelt?
Die Arbeit behandelt die kritischen Reaktionen der römischen Kirche auf die Entwicklungen der indischen Theologie, beleuchtet verschiedene Aspekte der Kritik und analysiert daraus resultierende Konflikte.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einleitung, Typen kontextueller Theologie, Kontextualisierung im indischen Kontext (inkl. wichtiger Persönlichkeiten und hinduistischer Konzepte), Raimundo Panikkar und seiner pluralistischen Theologie, Dalit-Theologie, dem Weg zu einer indischen Liturgie und der römischen Kritik. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die indische Theologie, ihre Entwicklung und zentralen Themen. Sie beleuchtet den interreligiösen Dialog zwischen Christentum und Hinduismus, die Bedeutung der Inkulturation und Befreiungstheologie und die Dalit-Theologie als Ausdruck von Protest und Befreiung.
- Quote paper
- Karel Joice Kalathiparambil Anson (Author), 2016, Indische Theologie. Hinduismus, indische christliche Theologie, Dalit-Theologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/427551