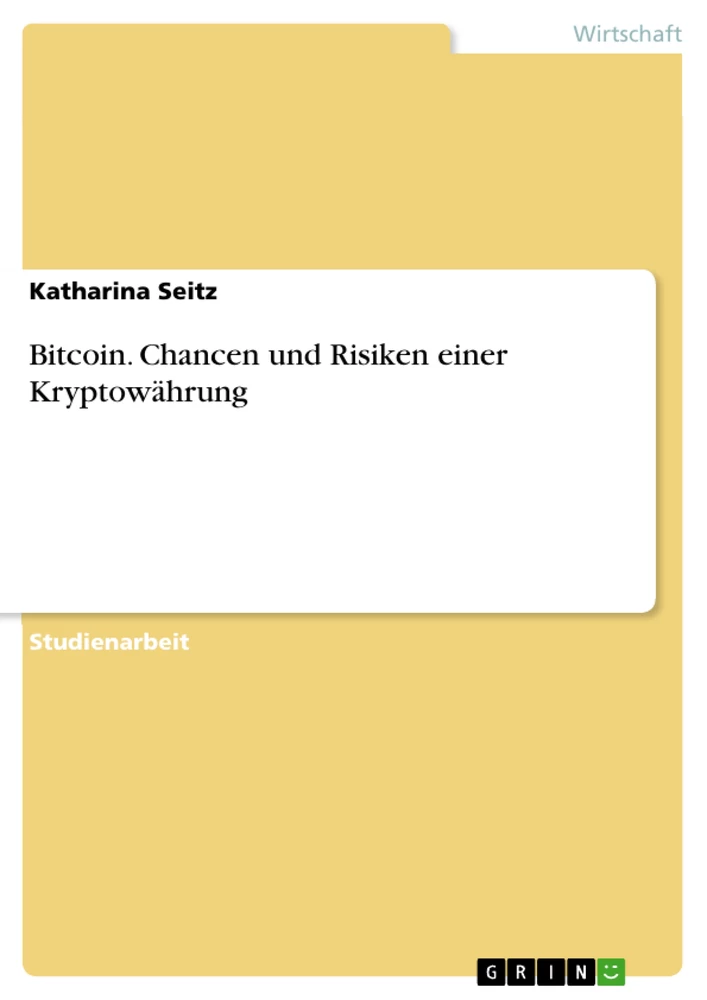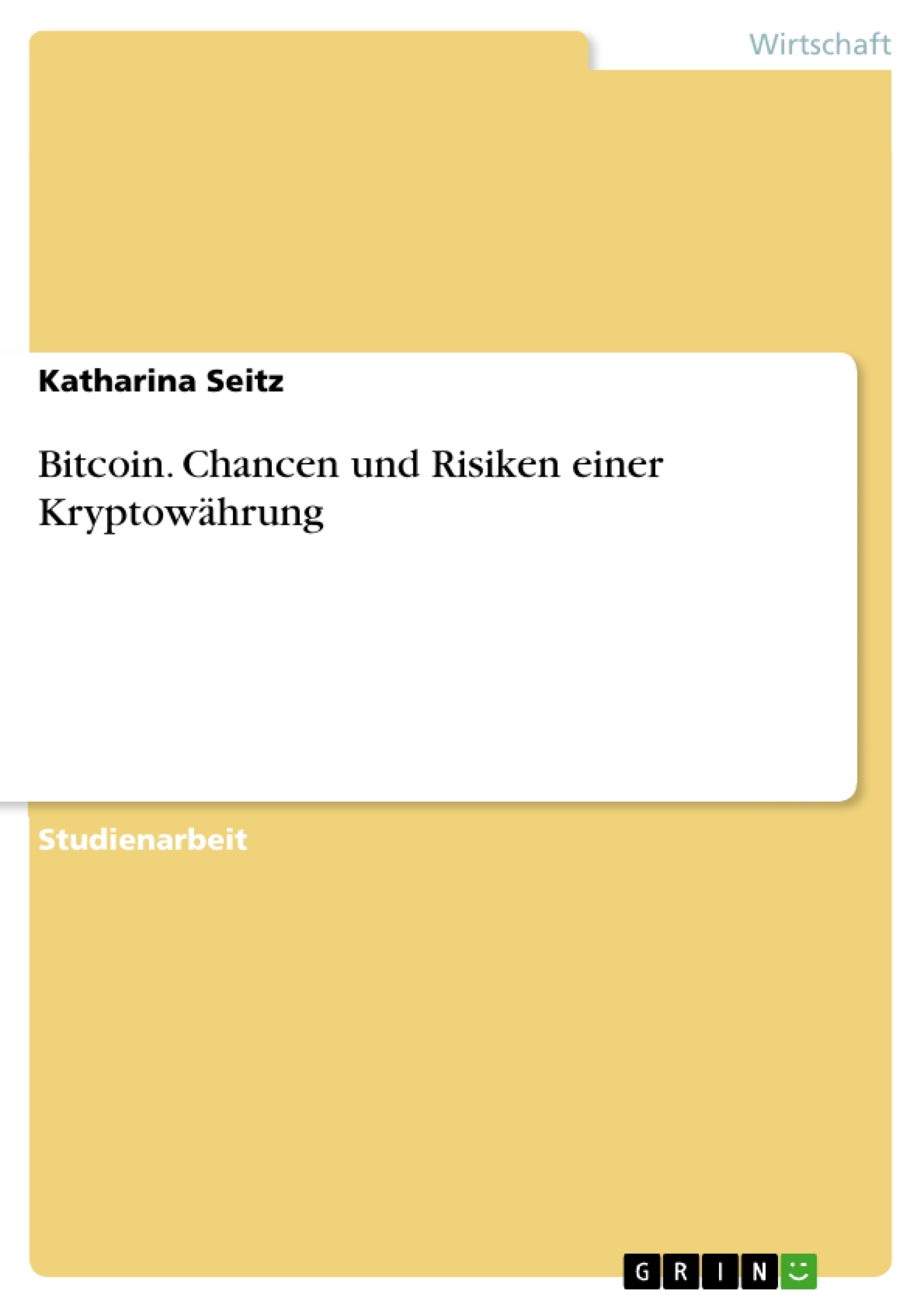Als dezentrale und digitale Währung ist der Bitcoin im letzten Kalenderjahr 2017 immer populärer geworden und wurde dabei zunehmend in entsprechenden Fachzeitschriften behandelt.
In dieser Arbeit werden zunächst die technischen Grundlagen und die Funktionsweise des Bitcoins erarbeitet. Dazu wird der Bitcoin von der gesetzlichen Fiat Währung abgegrenzt und generell erläutert wie der Bitcoin einzuordnen ist. Weiterhin werden die grundsätzlichen Chancen und Risiken des Bitcoins gegenübergestellt. Abschließend folgen ein Überblick über die aktuelle Situation und ein Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Ursprung und Funktionsweise des Bitcoins
- 2.1. Geld: Definition und Funktionsweise
- 2.2. Welcher Währungsform kann der Bitcoin zugeordnet werden?
- 2.3. Dezentralisation der Blockchain
- 2.4. Konsensus und Mining
- 3. Risiken
- 3.1. (Pseudo-)Anonymität
- 3.2. Verlustrisiko
- 4. Chancen
- 4.1. Dezentralisationschance
- 4.2. Marktchance
- 5. Aktuelle Situation
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Bitcoin, einer digitalen und dezentralen Währung, die in den letzten Jahren zunehmend an Popularität gewonnen hat. Ziel der Arbeit ist es, die technischen Grundlagen und Funktionsweise des Bitcoins zu erläutern, seine Chancen und Risiken aufzuzeigen und einen Einblick in die aktuelle Situation zu geben. Die Arbeit beleuchtet dabei insbesondere die Besonderheiten des Bitcoins im Vergleich zu herkömmlichen Fiat-Währungen.
- Dezentrale Funktionsweise und Blockchain-Technologie
- Chancen und Risiken des Bitcoins im Vergleich zu traditionellen Währungen
- Einteilung und Bedeutung des Bitcoins als Zahlungsmittel und Wertspeicher
- Anonymität und Datenschutz im Zusammenhang mit Bitcoin-Transaktionen
- Aktueller Stand der Bitcoin-Entwicklung und mögliche Zukunftsperspektiven
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel dieser Hausarbeit führt in das Thema ein und stellt die Relevanz des Bitcoins im Kontext der aktuellen Entwicklungen im Finanzsektor dar. Kapitel zwei beschäftigt sich mit dem Ursprung und der Funktionsweise des Bitcoins. Dabei werden grundlegende Konzepte wie Dezentralisierung, Blockchain-Technologie und Konsensusmechanismen erläutert. Kapitel drei beleuchtet die Risiken des Bitcoins, darunter die (Pseudo-)Anonymität und das Verlustrisiko. In Kapitel vier werden die Chancen des Bitcoins diskutiert, darunter die Dezentralisationschance und die Marktchance. Kapitel fünf bietet einen Überblick über die aktuelle Situation des Bitcoins, inklusive seiner Verbreitung und Wertentwicklung.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Hausarbeit behandelt die Themen Bitcoin, Kryptowährung, Blockchain, Dezentralisierung, Finanztechnologie, Risiko, Chance, Anonymität, Wertstabilität, Fiat-Währung, digitale Währung, Transaktionssicherheit, Mining, und Konsensusmechanismus. Diese Schlüsselwörter spiegeln die zentralen Themen und Fragestellungen der Arbeit wider.
- Arbeit zitieren
- Katharina Seitz (Autor:in), 2018, Bitcoin. Chancen und Risiken einer Kryptowährung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/427378