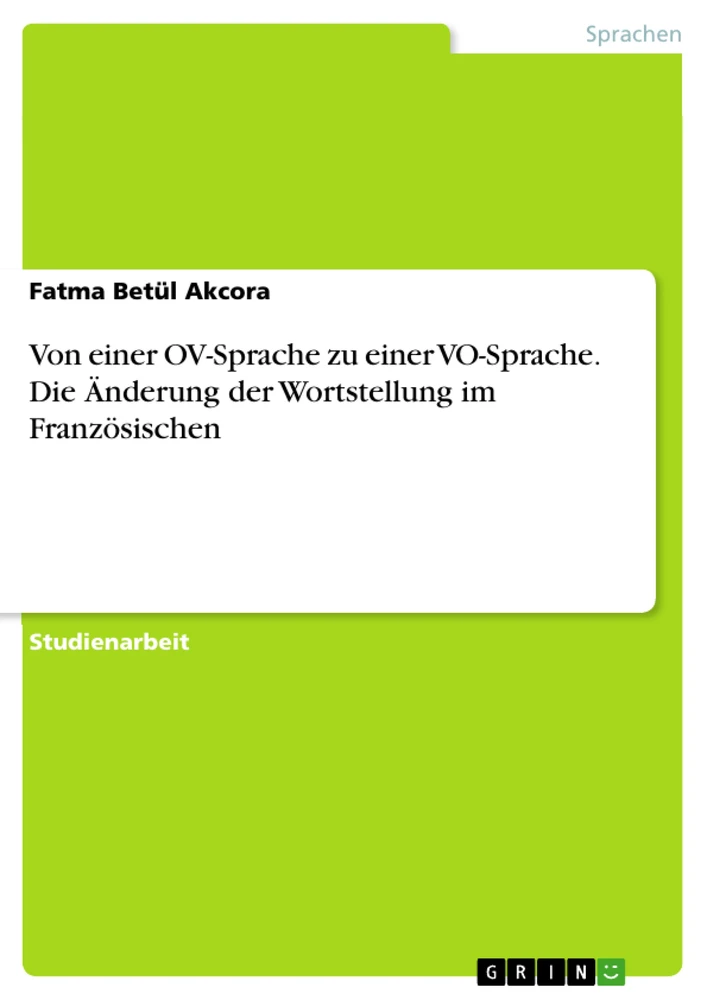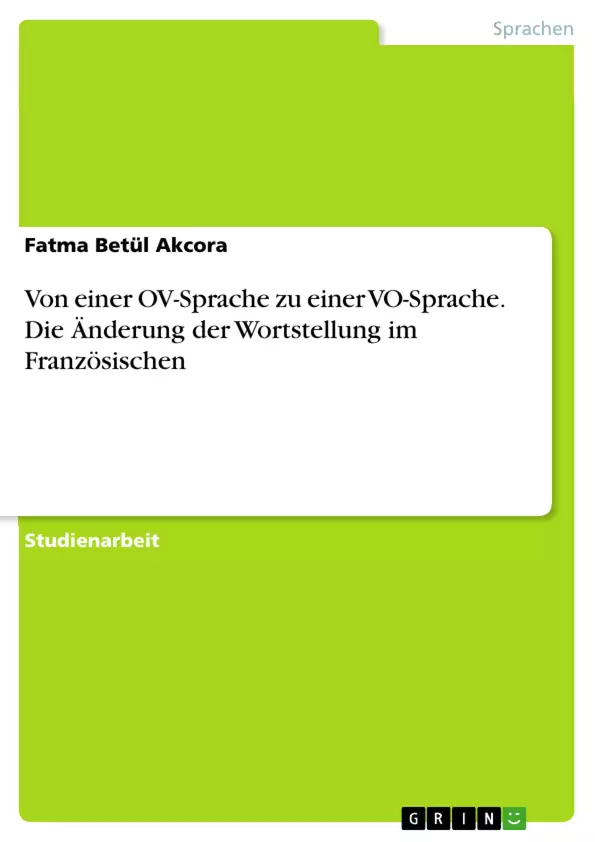Was den Sprachwandel betrifft, fällt bei genauer Betrachtung des Französischen auf, dass vor allem die Wortstellung im Satz einem eklatanten Wandel unterlag. Während in der lateinische Sprache die Reihenfolge der Wörter relativ frei war, jedoch die Form SOV bevorzugt wurde, ist die Ordnung der Wörter im heutigen Französisch strikt geregelt: Das Französische ist eine SVO-Sprache. Mit der Frage, warum dem so ist, wird sich die vorliegende wissenschaftliche Hausarbeit befassen.
Hierfür wird zuerst erläutert, zwischen welchen Sprachen in der linguistischen Typologie unterschieden wird und wie diese Typen formal aussehen. Danach soll auf den Satzbau im Früh- und Altlateinischen eingegangen und dieser sowohl mit dem des klassischen Latein als auch mit dem des Alt- und Mittelfranzösischen verglichen werden. Daraufhin werden die unterschiedlichen Hypothesen, die über die Entwicklung des französischen Satzbaus aufgestellt worden sind, betrachtet. Den Schluss dieser Arbeit bildet eine Zusammenfassung, die einen Überblick über alle gewonnenen Erkenntnisse gibt.
Sprachwandel ist sowohl ein relevantes als auch ein unumgängliches Phänomen, das ausschlaggebend für die (Weiter-) Entwicklung aller Sprachen der Welt – und somit auch des Französischen – ist. Der historisch-genealogischen Klassifikation zufolge, wird das Französische als ein Repräsentant der romanischen Sprachen betrachtet, die sich aus dem Vulgärlatein entwickelt haben und gehört folglich zur indoeuropäischen Sprachfamilie. Mit ca. 131 Mio. Sprechern (davon 76 Mio. Primärsprachler und 55 Mio. Zweitsprachler) in über 3 Kontinenten und einer Sprachgeschichte, die sich über mehrere Jahrhunderte streckt, ist das Französische also durchaus in der Lage, einen immensen Sprachwandel vorzuweisen.
Wird die Entwicklung der französischen Sprache näher in Betracht gezogen, so lassen sich drei Epochen herauskristallisieren, von denen die erste das Altfranzösische ist, das auf das 9. Jh. bis ca. 1300 datiert wird. Die zweite Phase bildet die Epoche des Mittelfranzösischen, dessen Beginn auf 1300 und Ende ca. auf das 16. Jh. festgelegt ist. Mit dem Ende des 15. und dem Anfang des 16. Jahrhunderts begann die Epoche des Neufranzösischen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Typen der Sprache
- 2.1 SOV
- 2.2 SVO
- 2.3 VSO
- 2.4 VOS, OVS, OSV
- 3. Wandel der Wortstellung
- 3.1 Proto-Indoeuropäisch
- 3.2 Früh- und Altlatein
- 3.3 Klassisches Latein
- 3.4 Altfranzösisch
- 3.5 Mittel- und Neufranzösisch
- 4. Hypothesen zum Wandel
- 4.1 Kasusschwund
- 4.2 Post- und Prädeterminierung
- 4.2.1 Left branching
- 4.2.2 Right branching
- 5. Die Modifikatoren im Lateinischen und Französischen
- 5.1 Unveränderte VO-Konstruktionen
- 5.2 Unveränderte OV-Konstruktionen
- 5.3 OV-Konstruktionen, die zu VO-Konstruktionen übergingen
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit untersucht den Wandel der Wortstellung im Französischen, von einer OV- zu einer SVO-Sprache. Die Arbeit analysiert die Entwicklung des Satzbaus im historischen Kontext und beleuchtet verschiedene linguistische Theorien, die diesen Wandel erklären sollen.
- Typologie der Wortstellung in verschiedenen Sprachen
- Vergleich des Satzbaus im Lateinischen (Früh-, Alt- und Klassisches Latein) und Französischen (Alt- und Mittelfranzösisch)
- Hypothesen zum Kasusschwund und dessen Einfluss auf die Wortstellung
- Analyse der Modifikatoren im Lateinischen und Französischen
- Entwicklung der Wortstellung vom Proto-Indoeuropäischen bis zum modernen Französisch
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Sprachwandel ein und betont dessen Relevanz für die Entwicklung aller Sprachen, insbesondere des Französischen. Sie positioniert Französisch innerhalb der indoeuropäischen Sprachfamilie und hebt die drei Entwicklungsphasen der Sprache hervor: Altfranzösisch, Mittelfranzösisch und Neufranzösisch. Der Fokus liegt auf dem Wandel der Wortstellung vom relativ freien Satzbau des Lateinischen hin zur strikten SVO-Struktur des modernen Französischen. Die Arbeit skizziert den methodischen Ansatz, der die verschiedenen Sprachtypen erläutert und den Satzbau in den verschiedenen Phasen des Lateinischen und Französischen vergleicht, um schließlich verschiedene Hypothesen zum Sprachwandel zu beleuchten.
2. Typen der Sprache: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Sprachtypen anhand der Wortstellung (SOV, SVO, VSO, VOS, OVS, OSV). Es werden die zwei dominanten Typen, SVO und SOV, detailliert erläutert, inklusive ihrer geographischen Verbreitung und Beispielen aus verschiedenen Sprachen wie Türkisch, Französisch und Irisch. Die weniger verbreiteten Typen VOS, OVS und OSV werden ebenfalls kurz vorgestellt und ihre Seltenheit im Vergleich zu SVO und SOV hervorgehoben. Das Kapitel liefert die Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Wortstellung im Französischen, indem es die möglichen Varianten der Satzstruktur aufzeigt.
3. Wandel der Wortreihenfolge: Dieses Kapitel untersucht den Wandel der Wortstellung im Französischen, beginnend mit dem Proto-Indoeuropäischen als Ursprungssprache. Es analysiert den Satzbau im Früh- und Altlatein, im Klassischen Latein, Altfranzösisch und schließlich im Mittel- und Neufranzösisch. Der Vergleich der verschiedenen Sprachstufen verdeutlicht die graduelle Veränderung der Wortstellung, die den Übergang vom relativ freien Satzbau des Lateinischen zur festen SVO-Struktur des modernen Französischen dokumentiert. Der Abschnitt legt die historische Grundlage für die Erörterung der Hypothesen im folgenden Kapitel.
4. Hypothesen zum Wandel: Dieses Kapitel präsentiert unterschiedliche Hypothesen, die den Wandel der Wortstellung im Französischen erklären sollen. Im Mittelpunkt stehen der Kasusschwund und die Konzepte der Post- und Prädeterminierung, inklusive Left- und Right-Branching. Diese Hypothesen werden als Erklärungen für die Entwicklung vom OV- zum VO-System im Französischen diskutiert, wobei die komplexen Zusammenhänge zwischen morphologischen und syntaktischen Veränderungen beleuchtet werden. Die verschiedenen Ansätze bieten alternative Perspektiven auf die Ursachen des beobachteten Sprachwandels.
5. Die Modifikatoren im Lateinischen und Französischen: Dieses Kapitel vergleicht die Modifikatoren (Wortgruppen, die ein anderes Wort näher beschreiben) im Lateinischen und Französischen, um den Wandel der Wortstellung weiter zu beleuchten. Es analysiert unveränderte VO- und OV-Konstruktionen sowie OV-Konstruktionen, die im Laufe der Sprachentwicklung zu VO-Konstruktionen wurden. Die Analyse von konkreten Beispielen verdeutlicht, wie sich die Position von Modifikatoren im Satz mit der Entwicklung der Wortstellung verändert hat. Die detaillierte Betrachtung der Modifikatoren liefert weitere Einblicke in den komplexen Prozess des Sprachwandels.
Schlüsselwörter
Sprachwandel, Französisch, Wortstellung, SVO, SOV, OV, VO, Latein, Proto-Indoeuropäisch, Altfranzösisch, Mittelfranzösisch, Neufranzösisch, Kasusschwund, Prädeterminierung, Postdeterminierung, Linguistische Typologie.
Häufig gestellte Fragen zur wissenschaftlichen Hausarbeit: Wandel der Wortstellung im Französischen
Was ist das Thema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den Wandel der Wortstellung im Französischen, von einer OV- zu einer SVO-Sprache. Sie analysiert die Entwicklung des Satzbaus im historischen Kontext und beleuchtet verschiedene linguistische Theorien, die diesen Wandel erklären sollen.
Welche Sprachstufen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht den Satzbau im Proto-Indoeuropäischen, Früh- und Altlatein, Klassischen Latein, Altfranzösisch, Mittelfranzösisch und Neufranzösisch. Der Fokus liegt auf dem Vergleich des Lateinischen und Französischen, um den Sprachwandel nachzuvollziehen.
Welche Arten der Wortstellung werden behandelt?
Die Hausarbeit behandelt verschiedene Sprachtypen anhand der Wortstellung (SOV, SVO, VSO, VOS, OVS, OSV). Besonders im Detail werden die dominanten Typen SVO und SOV erläutert. Die weniger verbreiteten Typen werden kurz vorgestellt.
Welche Hypothesen zum Sprachwandel werden diskutiert?
Die Arbeit präsentiert verschiedene Hypothesen, die den Wandel der Wortstellung erklären sollen. Im Mittelpunkt stehen der Kasusschwund und die Konzepte der Post- und Prädeterminierung (inkl. Left- und Right-Branching). Diese Hypothesen werden als Erklärungen für die Entwicklung vom OV- zum VO-System diskutiert.
Welche Rolle spielen Modifikatoren in der Analyse?
Die Hausarbeit analysiert die Modifikatoren im Lateinischen und Französischen, um den Wandel der Wortstellung weiter zu beleuchten. Es werden unveränderte VO- und OV-Konstruktionen sowie OV-Konstruktionen, die zu VO-Konstruktionen wurden, verglichen. Die Analyse konkreter Beispiele verdeutlicht die Veränderung der Position von Modifikatoren im Satz.
Wie ist die Hausarbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Sprachtypen, dem Wandel der Wortstellung in verschiedenen Sprachstufen, Hypothesen zum Sprachwandel, einer Analyse der Modifikatoren und einem Fazit. Jedes Kapitel fasst seine Kernaussagen zusammen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Sprachwandel, Französisch, Wortstellung, SVO, SOV, OV, VO, Latein, Proto-Indoeuropäisch, Altfranzösisch, Mittelfranzösisch, Neufranzösisch, Kasusschwund, Prädeterminierung, Postdeterminierung, Linguistische Typologie.
Welche Zielsetzung verfolgt die Hausarbeit?
Die Zielsetzung ist die Untersuchung des Wandels der Wortstellung im Französischen von OV zu SVO, die Analyse der Entwicklung im historischen Kontext und die Beleuchtung verschiedener linguistischer Theorien zur Erklärung dieses Wandels.
- Quote paper
- Fatma Betül Akcora (Author), 2017, Von einer OV-Sprache zu einer VO-Sprache. Die Änderung der Wortstellung im Französischen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/426463