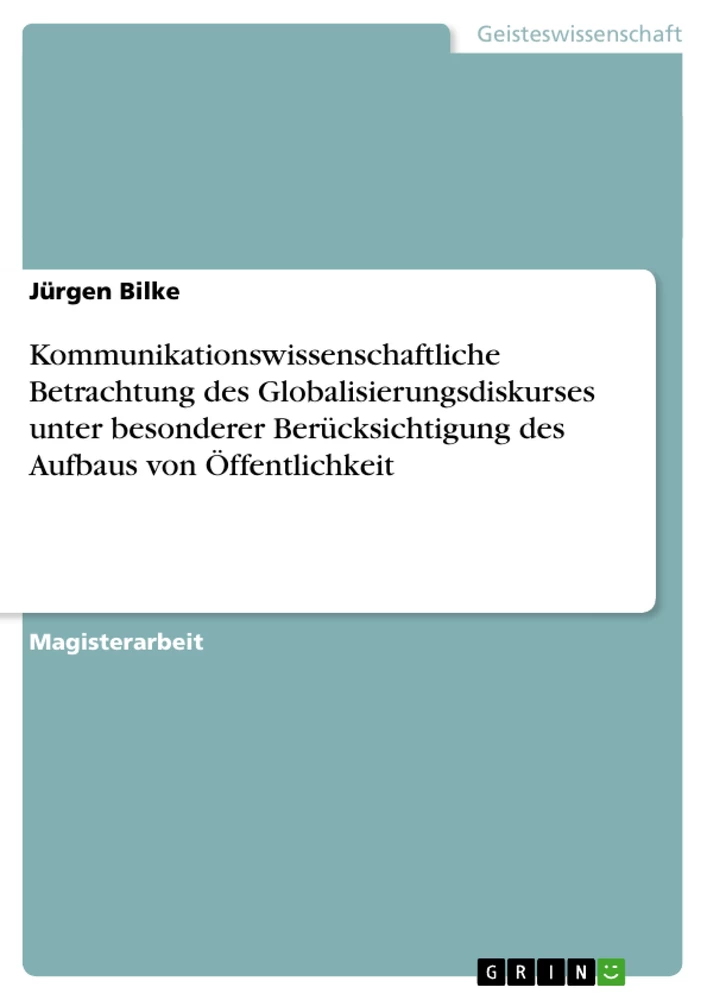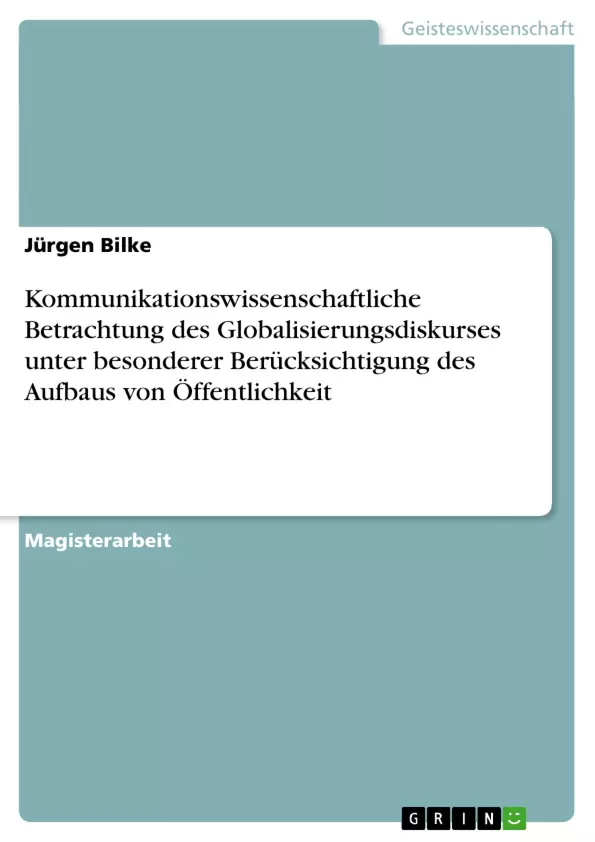Einleitung
Als sich die Frage stellte, womit sich meine Magisterarbeit auseinandersetzen sollte, kam ich unter der Prämisse „mit etwas was mir auf den Nägeln brennt“ in sekundenschnelle auf die Antwort: „Globalisierung“. Mir begegnete dieses Wort in verschiedenen Kontexten. Die Rationalisierung von Arbeitsplätzen, der Aufstieg der „New Economy“ oder die Finanzkrise in Asien, alles wurde in Verbindung gebracht mit der Globalisierung. Durch diese und vorherige Erfahrungen, zum Beispiel daß Kriege aus ökonomischen Interessen hervorgingen oder daß Kinder in Entwicklungsländern Markenschuhe für Hungerlöhne fertigen, kamen Vorannahmen und Vorurteile zustande, die meiner wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit diesem Thema zugrunde liegen. Dieses Immer-schon-vorhanden-sein von Vorurteilen, auch in wissenschaftlichen Theorien, thematisiert Gerold Ungeheuer in seinem Aufsatz „Vor- Urteile über Sprechen, Mitteilen, Verstehen“1. So soll am Anfang dieser Arbeit das hier verwendete Mittel zur Beschreibung des Globalisierungsprozesses, die Gesellschaftstheorie von Jürgen Habermas, aus der Ableitung von meinen Vorannahmen begründet werden. Nach Ungeheuer ist jegliche Erfahrung eine individuelle „...womit ich die Meinung verbinde, prinzipiell müsse angenommen werden, daß unter gleichen äußeren Erfahrungen die individuelle Erfahrungsinhalte verschieden sind.“2 Diese Erfahrungen konstituieren die individuelle Welttheorie, die als Interpretationsressource die Existenz von Vorurteilen und Vorannahmen beinhaltet. So fordert Ungeheuer bezüglich der Arbeitsweise des Wissenschaftlers: „Unausweichlich wird er dazu geführt, in einem ersten Arbeitsschritt die Erfahrungsinhalte, die theoretisch erklärt werden und die ihre Theorie begründen sollen, zu beschreiben, mit natürlicher Sprache oder nach künstlichen Notationssystem.“3 Die zugrundeliegenden Annahmen und Vermutungen dieser Arbeit sind die der Unterdrückung von bestimmten Formen der menschlichen Kommunikation, durch den der Globalisierungsprozeß gekennzeichnet ist. Das Vorurteil kann generell als Vermachtung zwischenmenschlicher Kommunikation durch systemische Zwänge charakterisiert werden.
...
----
1 Ungeheuer, Gerold (1987): Kommunikationstheoretische Schriften 1: Sprechen, Mitteilen,
Verstehen. Aachen: Alano Verlag. S.290-339.
2 Ungeheuer, Gerold (1987), S.290.
3 Ungeheuer, Gerold (1987), S.291.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aspekte der Gesellschaftstheorie von Habermas
- Kommunikatives versus zweckrationales Handeln
- Das System/Lebenswelt-Konzept
- Die Lebenswelt
- Das System
- Die Entkopplung und Kolonisierungsthese
- Der Globalisierungsdiskurs
- Ökonomie
- Historische Betrachtung
- Status Quo
- Der freie Markt
- Internationale Finanzmärkte
- Transnationale Konzerne
- Wissenschaftliche Annäherung
- Politik
- Der Nationalstaat
- Global governance
- Wissenschaftliche Annäherung
- Information und Kommunikation
- Digitale Revolution
- Wissenschaftliche Annäherung
- Kultur
- Homogenisierungsthese
- Heterogenisierungsthese
- Wissenschaftliche Annäherung
- Ökologie
- Globale Ökologieprobleme
- Ökologieprobleme durch Globalisierung
- Entwicklungstendenzen politischer Einflussnahme
- Wissenschaftliche Annäherung
- Zwischenbetrachtung
- Öffentlichkeit als Gegenmacht
- Öffentlichkeit nach Habermas
- Öffentlichkeit im Anschluss an das System/Lebenswelt- Konzept
- Autonome Öffentlichkeiten
- Das Recht als Mittler zwischen System und Lebenswelt
- Neue soziale Bewegungen: Ausdruck einer globalen Zivilgesellschaft
- Globalisierungskritische Bewegungen
- Historie
- Attac
- Entstehung
- Selbstverständnis
- Grundannahmen, Methoden, Ziele
- Struktur
- Zukunftsprognose
- Fremddarstellung
- Ist Attac eine autonome Öffentlichkeit?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit befasst sich mit der kommunikationswissenschaftlichen Betrachtung des Globalisierungsdiskurses, insbesondere mit dem Aufbau von Öffentlichkeit und der Rolle globalisierungskritischer Bewegungen. Sie analysiert, wie der Globalisierungsprozess die gesamtgesellschaftliche Entwicklung beeinflusst und wie sich die Öffentlichkeit als Gegenmacht positioniert.
- Die Gesellschaftstheorie von Jürgen Habermas und ihre Relevanz für die Analyse des Globalisierungsdiskurses
- Der Einfluss von Ökonomie, Politik, Information und Kommunikation sowie Kultur und Ökologie auf die Globalisierung
- Die Rolle von Öffentlichkeit im Globalisierungsprozess und die Herausforderungen für den Aufbau eines gesellschaftlichen Konsenses
- Die Analyse der globalisierungskritischer Bewegung Attac als Beispiel für eine autonome Öffentlichkeit
- Die Bedeutung der Kommunikation und des Dialogs im Kontext der Globalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Globalisierung dar und erläutert die persönlichen Vorannahmen und das wissenschaftliche Erkenntnisinteresse der Arbeit.
- Aspekte der Gesellschaftstheorie von Habermas: Dieses Kapitel beleuchtet die zentralen Elemente der Gesellschaftstheorie von Jürgen Habermas, insbesondere das Konzept des kommunikativen Handelns und das System/Lebenswelt-Konzept.
- Der Globalisierungsdiskurs: Das Kapitel untersucht die verschiedenen Facetten des Globalisierungsdiskurses aus ökonomischer, politischer, informations- und kommunikationswissenschaftlicher, kultureller und ökologischer Perspektive.
- Öffentlichkeit als Gegenmacht: Dieses Kapitel befasst sich mit der Rolle der Öffentlichkeit als Gegenmacht im Globalisierungsprozess und analysiert, wie sich das Konzept der Öffentlichkeit nach Habermas im Kontext des System/Lebenswelt-Konzepts anwenden lässt.
- Neue soziale Bewegungen: Ausdruck einer globalen Zivilgesellschaft: Das Kapitel untersucht globalisierungskritische Bewegungen, insbesondere Attac, und analysiert deren Entstehung, Selbstverständnis, Strukturen und Zielsetzungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Globalisierung, Gesellschaftstheorie, Jürgen Habermas, Kommunikation, Öffentlichkeit, Zivilgesellschaft, Attac, Globalisierungskritik, und Weltwirtschaftspolitik.
- Ökonomie
- Arbeit zitieren
- Jürgen Bilke (Autor:in), 2003, Kommunikationswissenschaftliche Betrachtung des Globalisierungsdiskurses unter besonderer Berücksichtigung des Aufbaus von Öffentlichkeit, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/42559