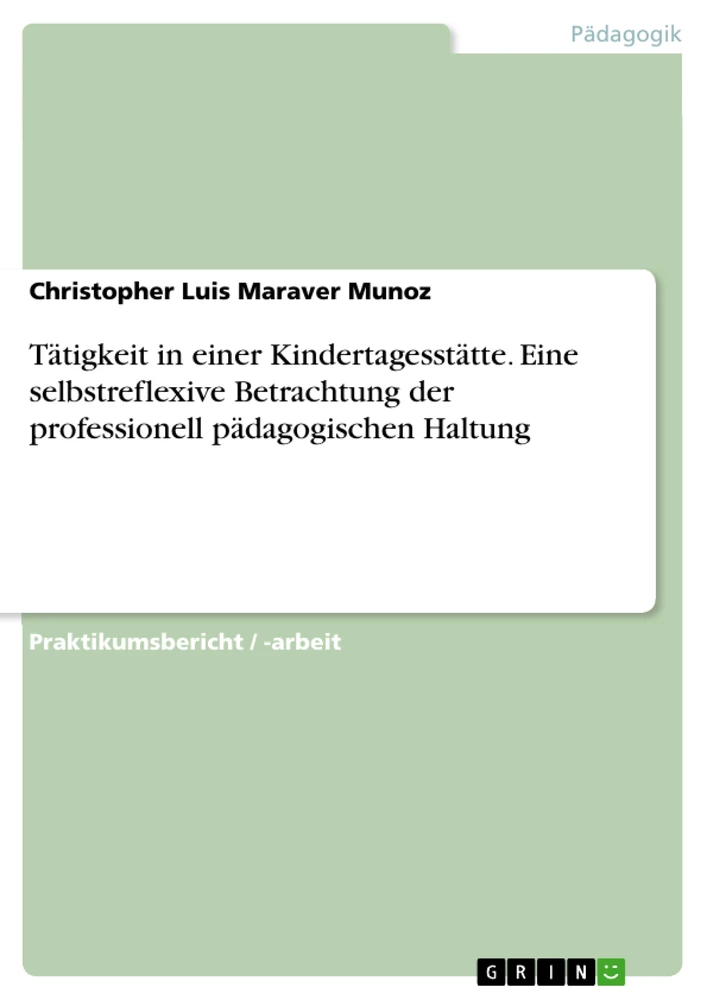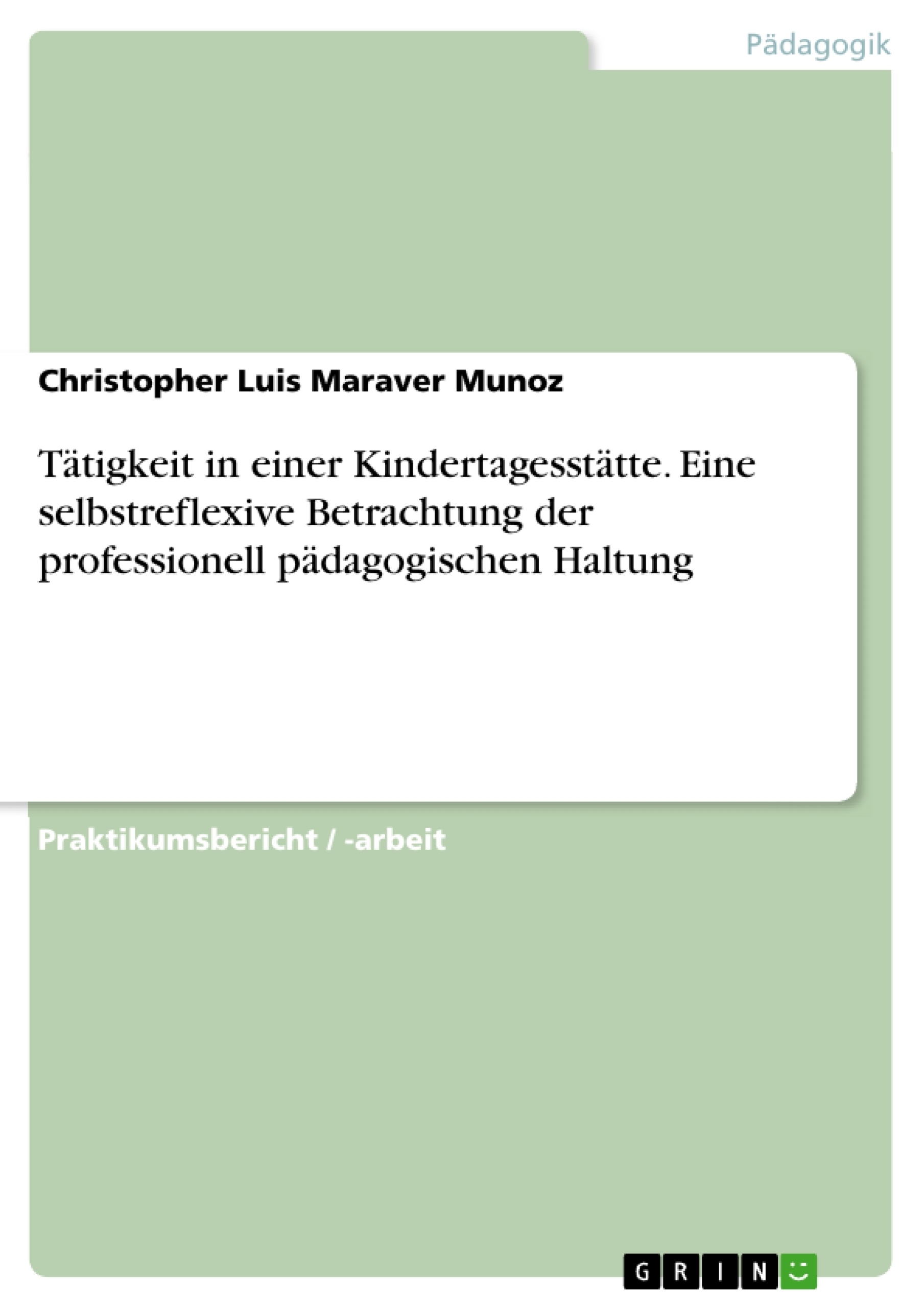Einleitend wird die Einrichtung, sowie die eigene Tätigkeit im Felde beschrieben. Der Praktikumsbericht setzt sich dann mit der Frage auseinander, was eine professionelle Haltung im pädagogischem Alltag ausmacht und welche Rahmenbedingungen die pädagogische Arbeit bedingen. So wird zunächst mit Hilfe des Dienstleistungsbegriffs eine Orientierung von dem aufgeworfen, was Qualität in der pädagogischen Arbeit sein kann. Im Anschluss daran werden die Anforderungen und die Komplexität von pädagogischer Qualität als multidimensionales Gebilde dargestellt, um die Rahmenbedingungen des pädagogischen Alltags zu verdeutlichen und um diese auf die eigene Arbeit reflektieren zu können. Das Modell der Professionellen Haltung, welches aufgezeigt wird, dient als Schablone der eigenen pädagogischen professionellen Haltung, anhand derer eine Reflexion der eigenen Erfahrungen mit den einzelnen Aspekten von Professionalität unternommen wird. Die Ergebnisse werden sodann abschließend für die weitere berufliche Laufbahn reflektiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Weg zur gewählten Einrichtung
- Beitrag zur pädagogischen Professionalisierung/ Berufswunsch und Zusammenhänge zum Studieninhalt
- Beschreibung der Einrichtung
- Beschreibung der Tätigkeiten
- Eigenständige Projekte
- Weitere Bereiche der Einrichtung
- Das Verhältnis von Theorie und Praxis
- Das Verhältnis von Nähe und Distanz
- Die Rahmenbedingungen des Alltags
- Weiteres Vorgehen des vorliegenden Praktikumsberichts
- Hauptteil
- Der Dienstleistungsbegriff in der Pädagogik
- Dimensionen pädagogischer Qualität
- Das Modell der professionellen Haltung in der Pädagogik
- Schlussteil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Praktikumsbericht beleuchtet die dreijährige Tätigkeit des Autors in einer Kindertagesstätte, mit besonderem Fokus auf die letzten beiden Jahre. Die Arbeit analysiert die Auswirkungen der Praxis auf die pädagogische Professionalisierung des Autors im Hinblick auf seinen Berufswunsch als Familientherapeut und die Verbindung zum Masterstudium der Erziehungswissenschaften.
- Zusammenspiel von Theorie und Praxis in der pädagogischen Arbeit
- Entwicklung der professionellen Haltung im Kontext der Kindertagesstätte
- Analyse des Dienstleistungsbegriffs in der Pädagogik
- Bewertung von Qualitätsmerkmalen in der pädagogischen Arbeit
- Reflexion des Verhältnisses von Nähe und Distanz in der pädagogischen Beziehung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt den Leser in die Entstehungsgeschichte des Praktikumsberichts ein. Sie schildert den Weg des Autors zur gewählten Einrichtung, die Motivation für die Tätigkeit und die Verbindung zum Studium.
Hauptteil
Der Dienstleistungsbegriff in der Pädagogik
Dieses Kapitel beleuchtet den Dienstleistungsbegriff im Kontext der pädagogischen Arbeit. Es untersucht die Frage, ob die pädagogische Arbeit als Dienstleistung verstanden werden kann und welche Implikationen dies für die professionelle Haltung hat.
Dimensionen pädagogischer Qualität
In diesem Kapitel werden verschiedene Dimensionen pädagogischer Qualität analysiert. Es wird untersucht, welche Faktoren zu einer hohen pädagogischen Qualität beitragen und wie diese in der Praxis umgesetzt werden können.
Das Modell der professionellen Haltung in der Pädagogik
Das Kapitel widmet sich dem Modell der professionellen Haltung in der Pädagogik. Es beschreibt die verschiedenen Komponenten der professionellen Haltung und analysiert, wie diese im Kontext der Kindertagesstätte zum Tragen kommen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen der pädagogischen Professionalisierung, dem Dienstleistungsbegriff in der Pädagogik, den Dimensionen pädagogischer Qualität und dem Modell der professionellen Haltung in der Pädagogik. Der Fokus liegt auf der Reflexion der eigenen Entwicklung als pädagogischer Fachkraft im Kontext der Arbeit in einer Kindertagesstätte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema dieses Praktikumsberichts?
Das zentrale Thema ist die selbstreflexive Betrachtung der professionellen pädagogischen Haltung während der Arbeit in einer Kindertagesstätte.
Wie wird "Qualität" in der pädagogischen Arbeit definiert?
Die Arbeit nutzt den Dienstleistungsbegriff als Orientierungshilfe, um die multidimensionale Komplexität pädagogischer Qualität darzustellen.
Welche Rolle spielt das Verhältnis von Nähe und Distanz?
Es wird untersucht, wie Pädagogen die Balance zwischen emotionaler Nähe zum Kind und professioneller Distanz wahren können.
In welchem Zusammenhang steht die Arbeit zum Studium?
Der Bericht reflektiert die Praxis im Hinblick auf das Masterstudium der Erziehungswissenschaften und den Berufswunsch als Familientherapeut.
Was dient als "Schablone" für die Reflexion?
Ein spezifisches Modell der professionellen Haltung dient als theoretische Grundlage, um die eigenen Erfahrungen systematisch zu spiegeln.
- Arbeit zitieren
- Bachelor Christopher Luis Maraver Munoz (Autor:in), 2018, Tätigkeit in einer Kindertagesstätte. Eine selbstreflexive Betrachtung der professionell pädagogischen Haltung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/424719