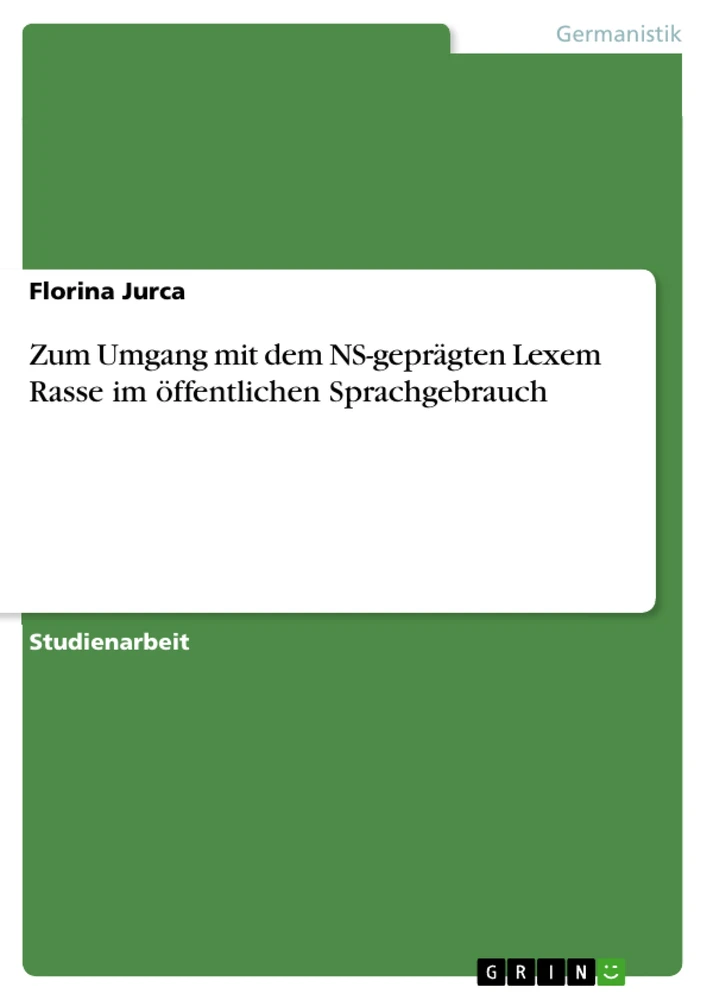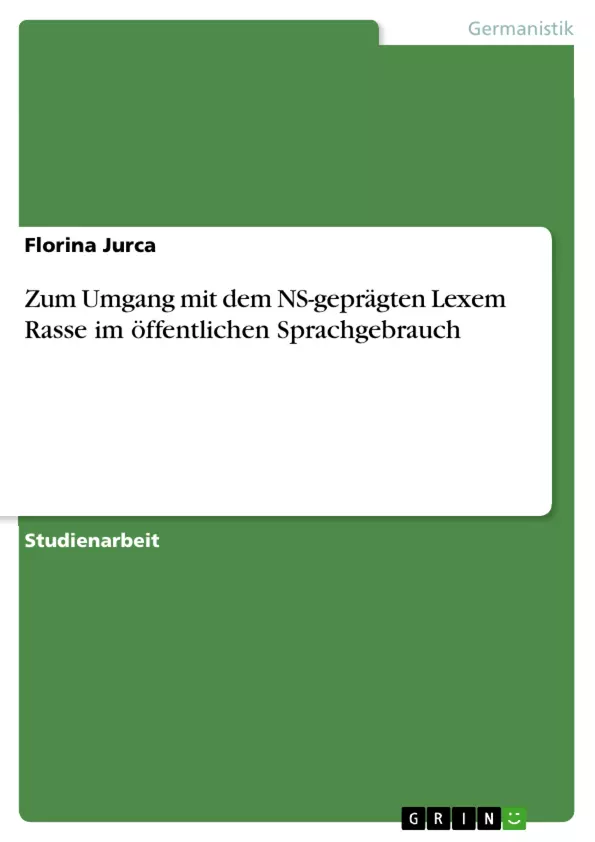Kommunikation ist im Allgemeinen die lebensnotwendige Befähigung des Menschen, die es ihm ermöglicht, mit anderen Personen in Kontakt zu treten, mit ihnen zu interagieren und Beziehungen zu ihnen aufzubauen. Wesentlichster Bestandteil dessen ist die Sprache, da Kommunikation in erster Linie über sie geschieht. Aus sprachwissenschaftlicher Sicht kann der Sprache eine ästhetische, aber auch eine affektive Funktion zugeordnet werden. Darüber hinaus erfüllt sie, als Medium des Denkens und Erkennens, sowohl eine kognitive als auch epistemologische Funktion. Gleichzeitig kommt ihr neben der kommunikativen Aufgabe, der den Informations- und Gedankenaustausch zwischen Kommunikationspartnern meint, auch eine soziale Funktion zu. Sprache regelt soziale Strukturen, trägt zur Entstehung, Verbreitung und Verfestigung von Werten und Normen bei und ermöglicht dadurch ein geordnetes Zusammenleben innerhalb einer sozialen Gemeinschaft. Da die Sprache einerseits von der Wirklichkeit beeinflusst und verändert wird, sie andererseits jedoch auch selbst die Wirklichkeit mitgestaltet, kann ihr eine instrumentelle Funktion zugesprochen werden. Sprache kann somit von dem Kommunikator genutzt werden um seine Ziele, Wünsche oder Bedürfnisse durchzusetzen oder um den Kommunikationspartner von einer Ansicht, einem Weltbild oder einer Gesinnung zu überzeugen. Unter Berücksichtigung eines bestimmten Sprachgebrauchs kann die Sprache demnach Gesinnungen transportieren und in dessen Dienste seine/n Kommunikationspartner/in beeinflussen. In diesem Fall können „Worte […] sein wie winzige Arsendosen: sie werden unbemerkt verschluckt, sie scheinen keine Wirkung zu tun, und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da“ (Klemperer 2006). Gerade wenn es um die Tradierung von Gesellschaftsnormen geht, werden diese Ansichten von dem Kommunikationspartner oft unbewusst übernommen und in seine eigene Weltsicht integriert.
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung
- Sprache und Sprachlenkung im 'Dritten Reich'
- Zum Umgang mit dem NS-geprägten Lexem Rasse
- Der Rassebegriff im Nationalsozialismus
- Zum Umgang mit dem Rassebegriff nach 1945
- Zum Umgang mit dem Rassebegriff nach der Jahrtausendwende
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Umgang des öffentlichen Sprachgebrauchs mit dem im Nationalsozialismus geprägten Lexem „Rasse“. Die Arbeit analysiert die Entwicklung der Verwendung dieses Begriffs im Kontext der nationalsozialistischen Sprachlenkung und untersucht, wie er nach 1945 und der Jahrtausendwende behandelt wurde. Dabei geht sie auf die problematischen Aspekte des Begriffs ein und beleuchtet, wie er in den heutigen Diskursen verwendet wird.
- Sprachlenkung im Nationalsozialismus
- Der Rassebegriff im Nationalsozialismus und seine Folgen
- Der Umgang mit dem Begriff „Rasse“ in der Nachkriegszeit
- Der aktuelle Umgang mit dem Begriff „Rasse“ in der öffentlichen Kommunikation
- Die ethischen und moralischen Implikationen der Verwendung des Begriffs „Rasse“
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt die Thematik des Lexems "Rasse" im Kontext der Sprachsituation im "Dritten Reich" vor und erläutert den historischen Hintergrund und die Relevanz des Themas.
Das zweite Kapitel beleuchtet die umfassende Sprachlenkung und Propaganda, die während der NS-Zeit praktiziert wurde, und analysiert die Rolle der Sprache als Instrument der Macht und Ideologie.
Das dritte Kapitel untersucht den Rassebegriff im Nationalsozialismus und seine Verwendung als zentrale Ideologie des Regimes. Es analysiert die Auswirkungen des Rassekonzepts auf die Gesellschaft und die daraus resultierenden Diskriminierung und Gewalt.
Schlüsselwörter
Nationalsozialismus, Sprachlenkung, Propaganda, Rassebegriff, Rassenideologie, Nachkriegszeit, Jahrtausendwende, öffentlicher Sprachgebrauch, ethische Implikationen, Diskriminierung, Erinnerungskultur.
- Quote paper
- M.A. Florina Jurca (Author), 2011, Zum Umgang mit dem NS-geprägten Lexem Rasse im öffentlichen Sprachgebrauch, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/423955