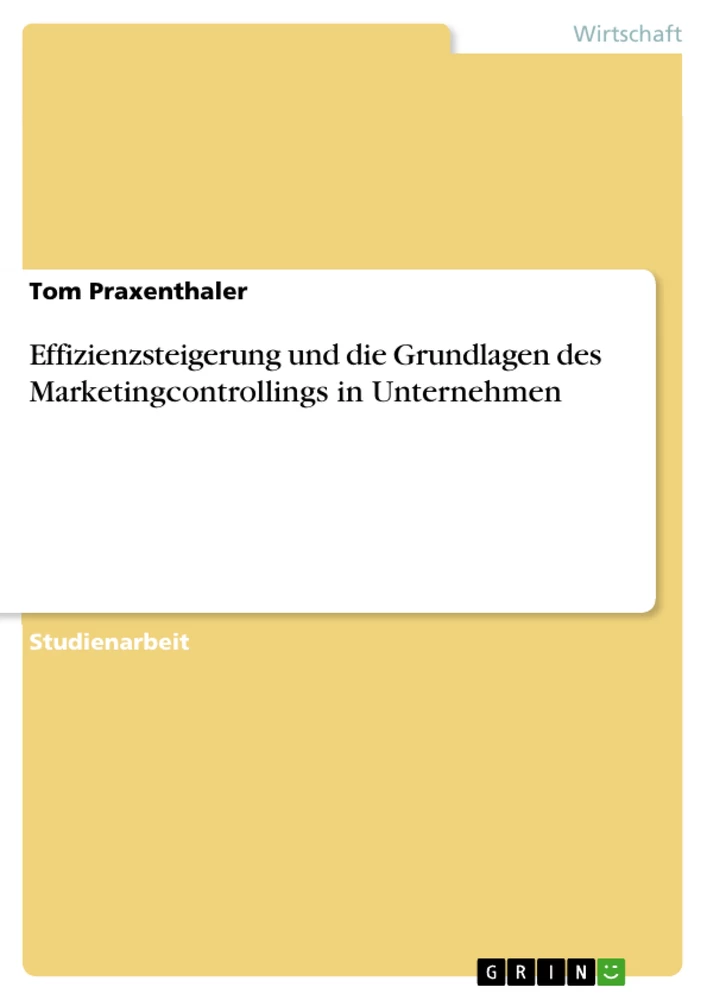In Zeiten des internationalen Wettbewerbs und der dadurch verschärften Wettbewerbsbedingungen
stehen im Vordergrund einer jeden Unternehmung. Das Marketing spielt bei dieser Problematik eine große Rolle, da für diese Unternehmensfunktion meist hohe Budgets investiert werden. Im Rahmen ganzheitlicher Effizienzsteigerung muss demnach also auch das Marketing beachtet werden. Für die meisten Abteilungen eines Unternehmens ist dafür das Controlling zuständig, jedoch findet man in vielen Unternehmen bereits eine spezielle Abteilung des Marketingcontrollings.
Welche Funktionen diese Abteilung hat und aus welchem Grund diese immer mehr etabliert wird, soll im Laufe dieser Arbeit geklärt werden. Das Wort Marketingcontrolling verrät bereits durch seinen Wortlaut, dass es sich bei dieser Unternehmensfunktion um eine Überschneidung des Controllings und des Marketings handeln muss. Im Folgenden werden diese beiden Unternehmensfunktionen zunächst einzeln behandelt und deren Grundlagen erläutert. Dadurch wird verdeutlicht, was aus der Schnittmenge der beiden Bereiche entsteht.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Grundlagen des Marketingcontrollings
- Grundlagen des Marketings
- Grundlagen des Controlling
- Marketingcontrolling als Schnittmenge von Controlling und Marketing
- Herausforderungen im Marketingcontrolling
- Strategische und operative Perspektive
- Strategisches Marketingcontrolling
- Operatives Marketingcontrolling
- Instrumente des Marketingcontrollings
- Ausgewählte strategische Instrumente
- Portfolio-Analyse
- SWOT-Analyse
- Ausgewählte operative Instrumente
- Break-Even-Analyse
- ABC-Analyse
- Ausgewählte strategische Instrumente
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der wichtigen Funktion des Marketingcontrollings in Unternehmen. Ziel ist es, die Rolle des Marketingcontrollings im Kontext der langfristigen Überlebensfähigkeit von Unternehmen zu beleuchten, insbesondere im Hinblick auf die effiziente Verwendung von Marketingbudgets. Die Arbeit analysiert die Grundlagen des Marketings und des Controllings, um die Entstehung und Relevanz des Marketingcontrollings als Schnittmenge dieser beiden Bereiche zu verdeutlichen.
- Die Bedeutung des Marketingcontrollings für die Unternehmenserfolg
- Die Herausforderungen im Bereich des Marketingcontrollings
- Die strategische und operative Perspektive des Marketingcontrollings
- Die wichtigsten Instrumente des Marketingcontrollings
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Dieses Kapitel stellt die Thematik des Marketingcontrollings vor und verdeutlicht die Relevanz dieses Funktionsbereichs in Zeiten des internationalen Wettbewerbs. Es wird auf die zentrale Frage der langfristigen Überlebensfähigkeit von Unternehmen eingegangen und die Rolle des Marketings in diesem Kontext betont.
- Grundlagen des Marketingcontrollings: Dieses Kapitel befasst sich mit den Grundlagen des Marketings und des Controllings. Die Entwicklung des Begriffs "Marketing" wird erläutert und die Bedeutung der Kundenorientierung und der Anpassung an veränderte Marktbedingungen hervorgehoben. Zudem wird die Entwicklung des Controllings im deutschsprachigen Raum betrachtet, wobei der Schwerpunkt auf der Planung, Steuerung und Kontrolle des operativen Geschäftes liegt.
- Herausforderungen im Marketingcontrolling: Dieses Kapitel beleuchtet die besonderen Herausforderungen, denen sich das Marketingcontrolling im heutigen Wettbewerbsumfeld stellen muss.
- Strategische und operative Perspektive: Dieses Kapitel unterscheidet zwischen dem strategischen und dem operativen Marketingcontrolling. Es werden die spezifischen Aufgaben und Instrumente beider Bereiche vorgestellt.
- Instrumente des Marketingcontrollings: Dieses Kapitel analysiert ausgewählte Instrumente des Marketingcontrollings, sowohl im strategischen als auch im operativen Bereich. Es werden Methoden wie die Portfolio-Analyse, die SWOT-Analyse, die Break-Even-Analyse und die ABC-Analyse vorgestellt.
Schlüsselwörter
Marketingcontrolling, Marketing, Controlling, Kundenorientierung, Wettbewerbsbedingungen, strategisches Marketingcontrolling, operatives Marketingcontrolling, Portfolio-Analyse, SWOT-Analyse, Break-Even-Analyse, ABC-Analyse, Unternehmensführung, Effizienzsteigerung, langfristige Überlebensfähigkeit, Entscheidungs- und Steuerungsprozess, Zielerreichung.
- Arbeit zitieren
- Tom Praxenthaler (Autor:in), 2017, Effizienzsteigerung und die Grundlagen des Marketingcontrollings in Unternehmen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/421166