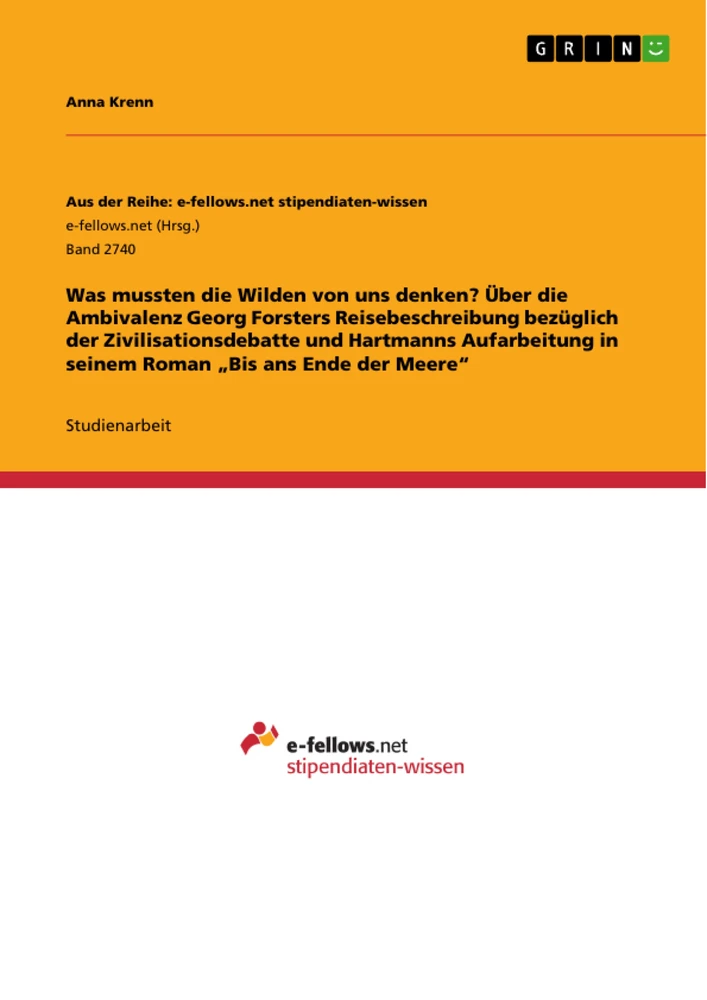Die Entdeckungsfahrten von Kapitän James Cook am Ende des 18. Jahrhundert üben bis heute eine Faszination auf die Menschen aus. So sehr die 1777 von Georg Forster veröffentlichte Reisebeschreibung „A Voyage Round The World“ über die zweite Weltumsegelung ein breites Publikum entzückte, so sehr wurde auch Lukas Hartmanns Roman „Bis ans Ende der Meere“ aus dem Jahr 2009 begeistert aufgenommen. Historisch werden die Weltumsegelungen heute dem sogenannten Zweiten Entdeckungszeitalter zugeordnet, in dem europäische Expeditionen erstmals explizit auch mit wissenschaftlichem Erkenntnisanspruch durchgeführt wurden. Dieser Paradigmenwechsel lässt sich auch in Forsters Reisebeschreibung erkennen: Das „Fremde“ wird von ihm genau beobachtet und ganz im Sinne eines von Rousseau geforderten philosophischen Reisenden für das Publikum „daheim“ beschrieben und reflektiert. Besondere Bedeutung erhalten dabei seine Ausführungen über die „wilden“ Bevölkerungen des Südpazifiks, die die Grundlage vieler zeitgenössischer anthropologischer Entwürfe der Aufklärungsphilosophen bildeten. So unterschiedlich die Philosophen die „Wilden“ allerdings bewerteten, so sehr scheint auch Forsters Werk durch eine innere Ambivalenz gekennzeichnet zu sein. Die Begegnungen zwischen den Europäern und den Einheimischen werden im Verlauf des Berichtes „unterschiedlich, ja widersprüchlich“ eingeschätzt, was sich auch auf seine Beurteilung der Expedition auswirkt. Bringt die Zivilisation den Menschen Glück oder Unheil? Diese Frage wird nicht nur für Forsters Reisebeschreibung wichtig, sondern stellt auch einen der zentralen Aspekte in Lukas Hartmanns Roman über die dritte Weltumsegelung von Cook dar. Im Folgenden soll deshalb die Beurteilung der europäischen Entdeckungsfahrten vergleichend untersucht werden. Unerlässlich ist dafür ein Verständnis des zugrundeliegenden Menschenbildes: Wie werden die „Wilden“ und wie wird die eigene Kultur bewertet? Um diese Frage zu klären, wird zunächst der zweifelsohne beeinflussende Diskurs der Aufklärung skizziert, bevor dann auf die Darstellungen von Forster und Hartmann eingegangen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Zivilisationsdebatte der Aufklärung
- Scheitern an den eigenen Maßstäben: Der Zivilisationsdiskurs bei Forster
- ,,Wilde sind wir selbst\": Der Zivilisationsdiskurs bei Lukas Hartmann
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text beschäftigt sich mit der Ambivalenz von Georg Forsters Reisebeschreibung im Kontext der Zivilisationsdebatte der Aufklärung und der Aufarbeitung dieses Themas im Roman „Bis ans Ende der Meere“ von Lukas Hartmann. Er untersucht, wie die Begegnungen zwischen Europäern und „Wilden“ in beiden Werken dargestellt werden und welche Auswirkungen diese Darstellungen auf die Bewertung der eigenen Kultur und der Expeditionen haben.
- Die Zivilisationsdebatte der Aufklärung und ihre Auswirkungen auf die Wahrnehmung von „Wilden“
- Die Darstellung von „Wilden“ und „Zivilisierten“ in Georg Forsters Reisebeschreibung
- Die Bewertung der Expedition von James Cook durch Forster
- Der Umgang mit der Zivilisationsdebatte in Lukas Hartmanns Roman „Bis ans Ende der Meere“
- Die Rolle von Reiseberichten in der Geschichte der Anthropologie und Philosophie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Der Text stellt die Reisebeschreibung von Georg Forster und den Roman von Lukas Hartmann als zwei literarische Werke vor, die sich mit der Geschichte der europäischen Entdeckungsfahrten auseinandersetzen. Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung der Weltumsegelungen im 18. Jahrhundert und stellt die Frage nach der Bewertung von „Wilden“ und der eigenen Kultur in beiden Werken.
- Die Zivilisationsdebatte der Aufklärung: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den vielschichtigen und teilweise widersprüchlichen Diskurs der Aufklärung. Es beleuchtet die gegensätzlichen Perspektiven von Fortschrittsgläubigen und Skeptikern, die sich in der Bewertung des Naturzustandes und der eigenen Gesellschaft widerspiegeln. Darüber hinaus wird die Bedeutung von Reisebeschreibungen und deren Einfluss auf die anthropologischen Entwürfe der Aufklärung hervorgehoben.
- Scheitern an den eigenen Maßstäben: Der Zivilisationsdiskurs bei Forster: Dieses Kapitel analysiert Forsters Reisebeschreibung und untersucht die Darstellung der Begegnungen zwischen Europäern und „Wilden“ sowie deren Auswirkungen auf die Bewertung der Expedition von James Cook. Der Text geht auf Forsters kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Kultur und die Ambivalenz in seiner Beurteilung der „Wilden“ ein.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Zivilisationsdebatte, Aufklärung, Reisebericht, Georg Forster, Lukas Hartmann, „Wilde“, Naturzustand, Kultur, Anthropologie, Expedition, James Cook, Terra Australis, Kolonialismus, Wissenschaft, Ambivalenz.
- Quote paper
- Anna Krenn (Author), 2017, Was mussten die Wilden von uns denken? Über die Ambivalenz Georg Forsters Reisebeschreibung bezüglich der Zivilisationsdebatte und Hartmanns Aufarbeitung in seinem Roman „Bis ans Ende der Meere“, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/419797