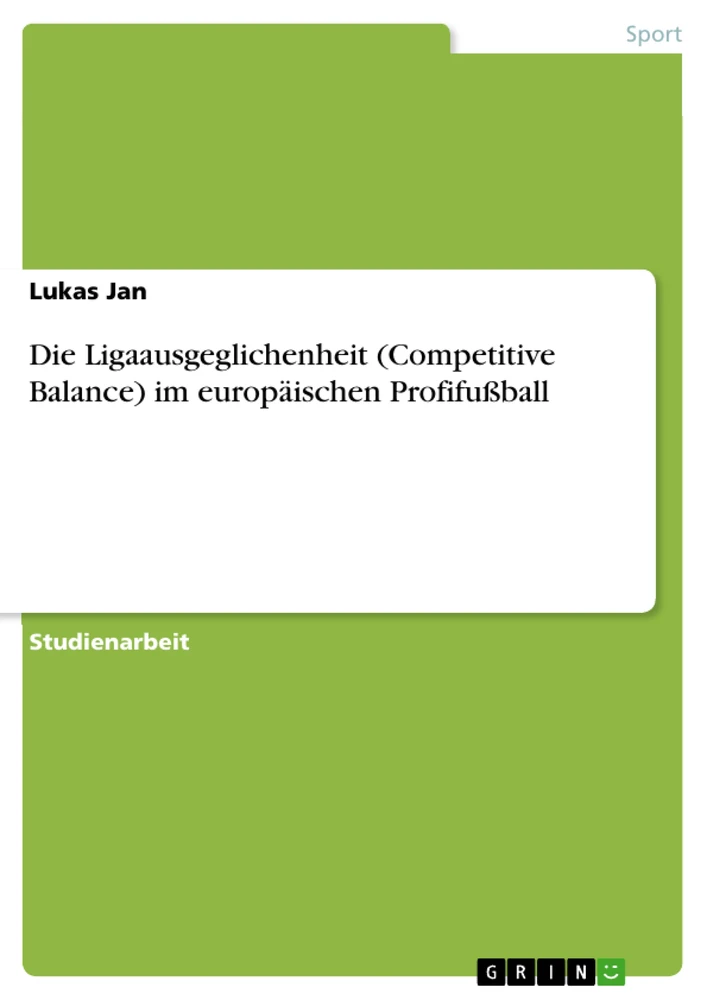Die wirtschaftliche Lage im Berufssport und vor allem im europäischen Profifußball wird immer positiver. Zahlreiche Sponsoren haben die Plattform des Sports, um Werbung in eigener Sache zu machen, erkannt und so gelangten in den letzten Jahren immer mehr liquide Mittel in die Reihen von Vereinen und deren Managern. Diese investierten die gegebenen Mittel bedacht und konnten somit ihre Vereine optimal fördern. So wurde z.B. der FC Bayern München in den letzten 15 Jahren neunmal Deutscher Meister und konnte fünf internationale Titel sammeln, darunter auch zweimal die Champions League.
Doch Vereine sind nicht nur von Finanzspritzen von Sponsoren oder anderweitigen Geldgebern abhängig, sondern generieren durch den wirtschaftlichen Boom des Profisports immer mehr Gelder durch die Vermarktung ihres Clubs oder durch Bonuszahlungen der UEFA, z.B. für die Teilnahmen an der Champions League oder Euro League. Die Gefahr besteht darin, dass durch Generierung dieser Gelder die starken Clubs, welche sich für die Champions League qualifiziert haben, noch mehr finanzielle Mittel zur Verfügung bekommen, ihren Verein noch erfolgreicher vermarkten und den Vorsprung auf den Großteil der restlichen Liga immer weiter ausbauen können. Mittelfristig hätte dies zur Folge, dass schwächere Mannschaften nicht mehr ernsthaft mit dem oberen Drittel einer Liga konkurrieren können und die nationale Liga sportlich uninteressanter für die Zuschauer werden würde. Doch es ist von enormer Bedeutung, vor allem für den Sport, dass der Wettkampf zweier Mannschaften von ungewissem Ausgang ist und die Zuschauer sich sicher sein können, dass das Endergebnis nicht abgesprochen ist. Je gleichermaßen die Spielstärken innerhalb eines Wettbewerbs auf die einzelnen Mannschaften verteilt sind, desto interessanter wird die Wirkung des Spiels auf die Zuschauer.
Um der Einseitigkeit der Liga, die von finanziellen Übermachten wie Manchester City, Real Madrid, Paris St. Germain oder auch dem FC Bayern München angeführt werden, entgegenzuwirken, ist es notwendig, Regeln aufzustellen, die die Wettbewerbsintensität der Liga garantiert. Diese Ausgeglichenheit einer Liga, wird im Fachjargon mit der sogenannten Competitive Balance beschrieben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Problemstellung
- Theoretische Grundlagen der Competitive Balance
- Konzepte zur Messung der Competitive Balance
- Spannweite
- Quartilsabstand
- Konzentrationsrate
- Hirschman Herfindahl Index
- Competitive Balance im deutschen Profifußball
- Empirische Anwendung in der Bundesliga
- Vergleich zu anderen Sportarten und Ligen
- Wettbewerbsintensität aus Sicht der Fans
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Competitive Balance im europäischen Profifußball. Ziel ist es, Methoden zur Berechnung der Competitive Balance darzustellen und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie diese im europäischen Fußball verbessert und langfristig gesichert werden kann, um die Intensität des sportlichen Wettkampfes zu erhalten. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf die "within-season-Komponente".
- Definition und Komponenten der Competitive Balance
- Methoden zur Messung der Competitive Balance (Spannweite, Quartilsabstand, Konzentrationsrate, Hirschman Herfindahl Index)
- Analyse der Competitive Balance im deutschen Profifußball im Vergleich zu anderen Ligen
- Der Einfluss der Competitive Balance auf die Wettbewerbsintensität und die Zuschauerzahlen
- Herausforderungen für kleinere Vereine durch die zunehmende Ungleichheit im Profifußball
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung und Problemstellung: Die Einleitung beschreibt den zunehmenden wirtschaftlichen Erfolg im europäischen Profifußball und die daraus resultierende Gefahr einer wachsenden Ungleichheit zwischen den Vereinen. Starke Vereine generieren immer mehr Einnahmen, was zu einer Verringerung der Wettbewerbsintensität und damit zu einem Verlust an Attraktivität für die Zuschauer führen kann. Die Arbeit untersucht daher die Competitive Balance als Maß für die Ausgeglichenheit einer Liga und fragt nach Möglichkeiten, diese zu verbessern.
Theoretische Grundlagen der Competitive Balance: Dieses Kapitel definiert Competitive Balance als die Ausgeglichenheit eines Wettbewerbs innerhalb (intra-divisional) oder zwischen (inter-divisional) Ligen. Es unterscheidet zwischen der "within-season-Komponente" (Ausgeglichenheit innerhalb einer Saison) und der "within-team-Komponente" (langfristige Entwicklung der Teams). Die Arbeit konzentriert sich auf die "within-season-Komponente" und diskutiert die "Uncertainty of outcome-Hypothese", die besagt, dass ein ungewisser Spielausgang die Zuschauerattraktivität erhöht. Weiterhin werden die negativen Folgen der Ungleichheit für kleinere Vereine thematisiert, die aufgrund finanzieller Nachteile in einen Teufelskreislauf geraten können.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Competitive Balance im deutschen Profifußball
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Competitive Balance im europäischen Profifußball, insbesondere die "within-season-Komponente". Sie analysiert Methoden zur Messung der Competitive Balance und sucht nach Möglichkeiten, diese im europäischen Fußball zu verbessern, um die Intensität des sportlichen Wettkampfes zu erhalten und die Attraktivität für Zuschauer zu steigern.
Welche Methoden zur Messung der Competitive Balance werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Methoden zur Messung der Competitive Balance, darunter die Spannweite, den Quartilsabstand, die Konzentrationsrate und den Hirschman-Herfindahl-Index. Diese Methoden werden angewendet, um die Ausgeglichenheit der Liga zu quantifizieren.
Welche Aspekte der Competitive Balance werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf die "within-season-Komponente" der Competitive Balance, also die Ausgeglichenheit innerhalb einer Saison. Sie untersucht den Einfluss der Competitive Balance auf die Wettbewerbsintensität und die Zuschauerzahlen und beleuchtet die Herausforderungen für kleinere Vereine aufgrund der zunehmenden Ungleichheit im Profifußball.
Wie wird die Competitive Balance im deutschen Profifußball analysiert?
Die Arbeit beinhaltet eine empirische Anwendung der beschriebenen Methoden auf die Bundesliga. Die Ergebnisse werden mit anderen Sportarten und Ligen verglichen, um ein umfassenderes Bild der Competitive Balance im europäischen Fußball zu erhalten. Zusätzlich wird die Wettbewerbsintensität aus der Sicht der Fans betrachtet.
Welche Ziele verfolgt die Seminararbeit?
Die Hauptziele der Arbeit sind die Darstellung von Methoden zur Berechnung der Competitive Balance und die Aufzeigen von Möglichkeiten, diese im europäischen Fußball zu verbessern und langfristig zu sichern. Ein weiterer Fokus liegt auf der Analyse der Auswirkungen der Competitive Balance auf die Attraktivität des Wettbewerbs.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung und Problemstellung, Theoretische Grundlagen der Competitive Balance, Konzepte zur Messung der Competitive Balance, Competitive Balance im deutschen Profifußball (inkl. Vergleich zu anderen Ligen und Betrachtung der Fan-Perspektive), und Zusammenfassung und Fazit.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Seminararbeit behandelt?
Schlüsselbegriffe sind Competitive Balance, "within-season-Komponente", "Uncertainty of outcome-Hypothese", Spannweite, Quartilsabstand, Konzentrationsrate, Hirschman-Herfindahl-Index, Bundesliga, Wettbewerbsintensität, Zuschauerzahlen und Ungleichheit im Profifußball.
- Quote paper
- Lukas Jan (Author), 2016, Die Ligaausgeglichenheit (Competitive Balance) im europäischen Profifußball, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/418745