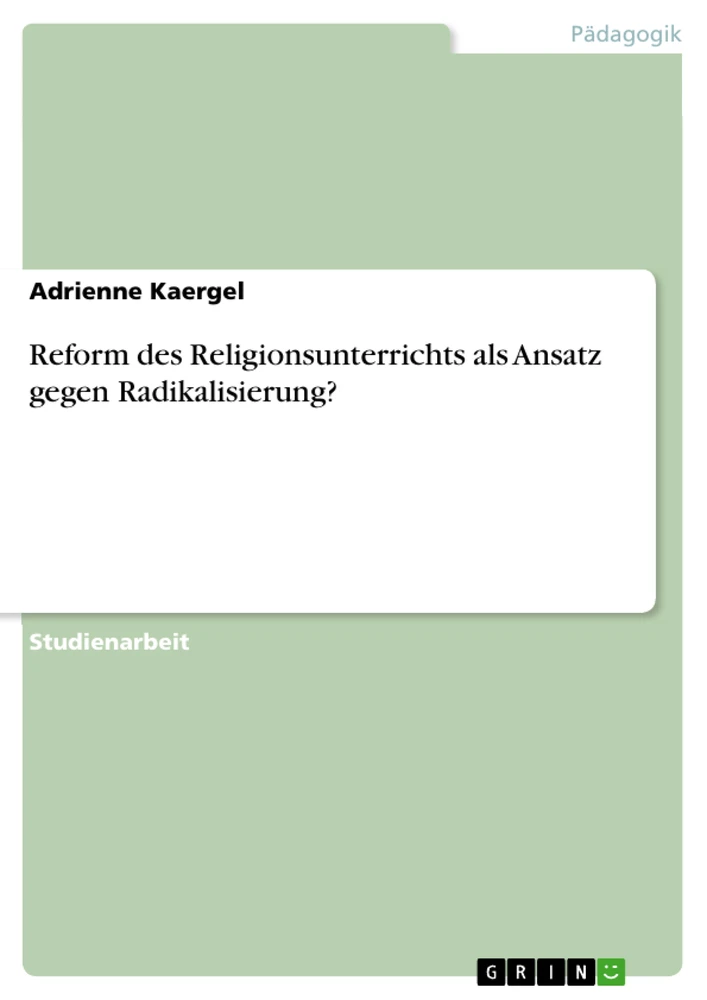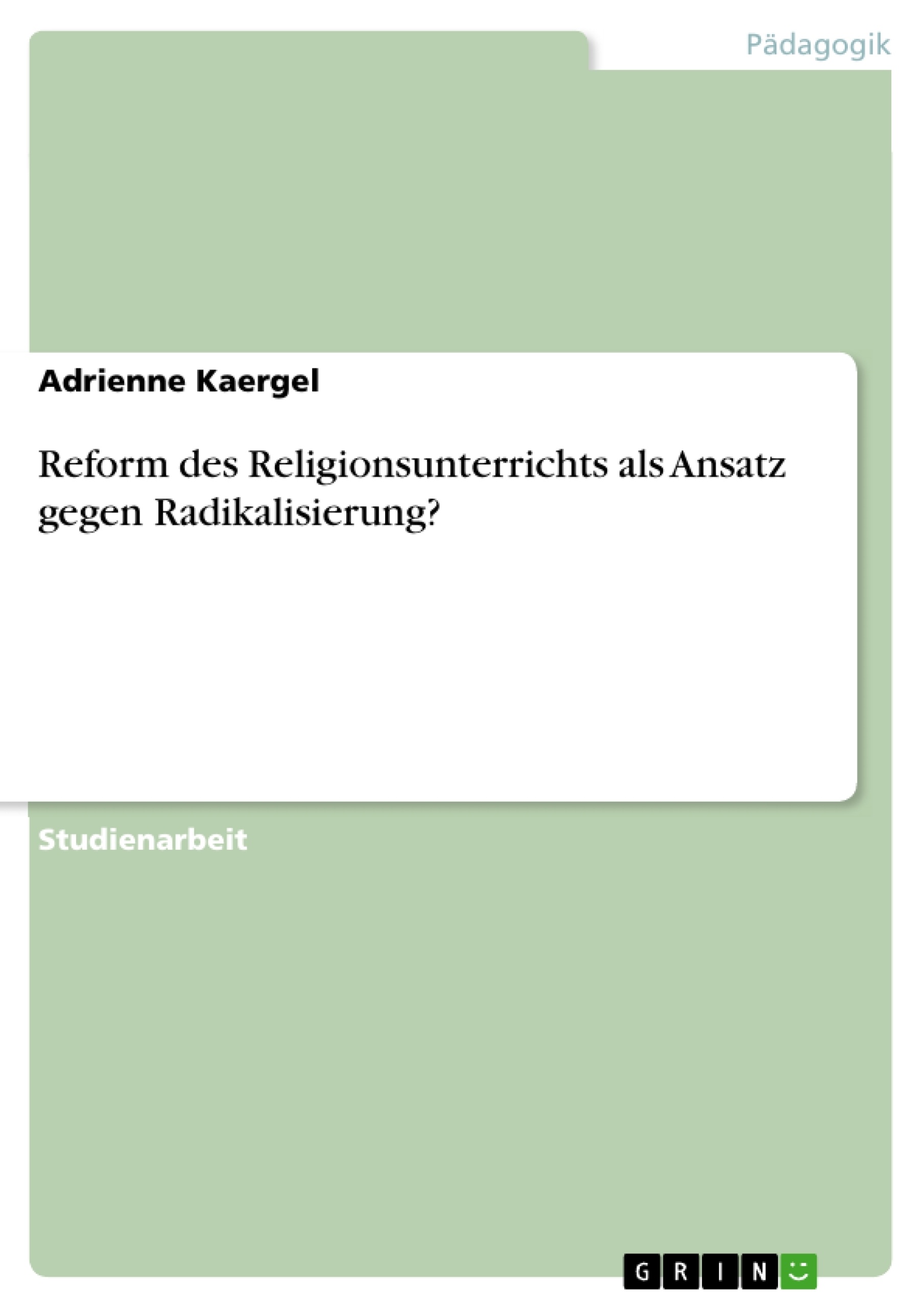Welche Bedeutung hat der Religionsunterricht (RU) im 21. Jahrhundert, in dem die SuS katholisch, evangelisch, freikirchlich, atheistisch, islamistisch, alevitisch, neuapostolisch oder Zeugen Jehovas sind und wie kann ein Religionsunterricht aussehen, der allen gerecht wird? Ziel der Arbeit ist es herauszufinden, wie die verschiedenen Bundesländer diese Fragen beantworten und die entsprechenden Konzepte kritisch zu hinterfragen. Die Erkenntnisse aus den Untersuchungen sollen letztendlich dazu dienen einen Hinweis zur Beantwortung der Leitfrage zu finden, ob eine Reform des RU als Ansatz gegen Radikalisierung dienen könnte.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Eine Gesellschaft im Wandel
- 2.1 Gesellschaftliche und religiöse Entwicklung in Deutschland
- 2.2 Überzeugungswandel – Säkularisierung und Individualisierung
- 2.3 Radikalisierung – eine logische Konsequenz?
- 2.3.1 Begriffsdefinitionen
- 2.3.2 Radikalisierung in Deutschland – was sagt die Forschung?
- 2.3.3 Mögliche Hintergründe
- 3 Religionsunterricht
- 3.1 Geschichte des Religionsunterrichts in Deutschland
- 3.2 Rechtliche und organisatorische Grundlagen
- 3.3 Religionsunterricht heute
- 4 Verschiedene Modelle – eine Lösung?
- 4.1 Der konfessionelle Bekenntnisunterricht (KBU)
- 4.2 Der konfessionell-kooperative Religionsunterricht (KoKo)
- 4.3 Überkonfessionelle Religionskunde (ÜRK)
- 4.4 Interreligiöse Kooperation
- 5 Kritische Gegenüberstellung
- 6 Zusammenführung der Ergebnisse und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage, ob eine Reform des Religionsunterrichts (RU) als Ansatz gegen Radikalisierung dienen könnte. Sie analysiert die gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland, beleuchtet den Begriff der Radikalisierung und beschreibt verschiedene Modelle des RU in deutschen Schulen.
- Der Einfluss von Säkularisierung und Individualisierung auf die Gesellschaft
- Die Ursachen und Hintergründe von Radikalisierung
- Die verschiedenen Modelle des Religionsunterrichts in Deutschland
- Die Rolle des Religionsunterrichts in der Integration und Prävention von Radikalisierung
- Die Bedeutung von interreligiöser Kooperation und Dialog im Religionsunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der Forschungsfrage vor und skizziert die Themengebiete der Arbeit. Kapitel 2 beschäftigt sich mit der gesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland, wobei insbesondere der Überzeugungswandel, die Säkularisierung und die damit verbundene Radikalisierung im Vordergrund stehen. Kapitel 3 liefert einen geschichtlichen Überblick zum Religionsunterricht in Deutschland und erläutert dessen rechtliche und organisatorische Grundlagen. Kapitel 4 beschreibt verschiedene Modelle des Religionsunterrichts an deutschen Schulen, die sich mit der Thematik der Heterogenität und deren Auswirkungen auseinandersetzen. Kapitel 5 bietet eine kritische Gegenüberstellung der verschiedenen Modelle und erörtert deren Vor- und Nachteile.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Themen dieser Arbeit sind: Religionsunterricht, Radikalisierung, Säkularisierung, Individualisierung, Integration, Interreligiöser Dialog, Konfessioneller Bekenntnisunterricht, Konfessionell-kooperativer Religionsunterricht, Überkonfessionelle Religionskunde, Interreligiöse Kooperation.
- Quote paper
- Adrienne Kaergel (Author), 2017, Reform des Religionsunterrichts als Ansatz gegen Radikalisierung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/417871