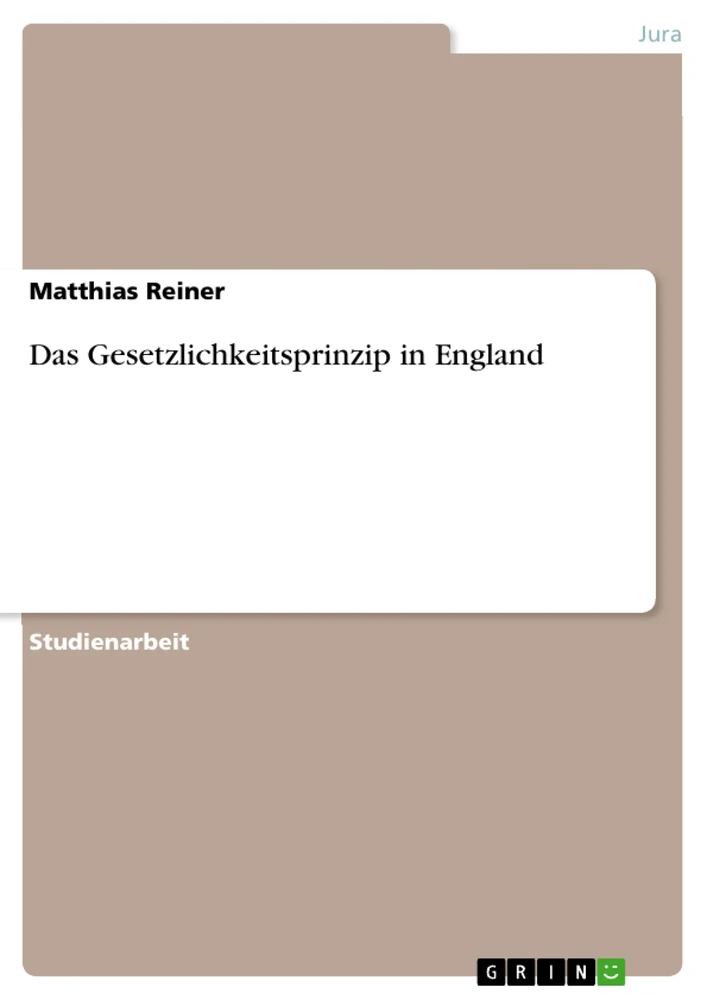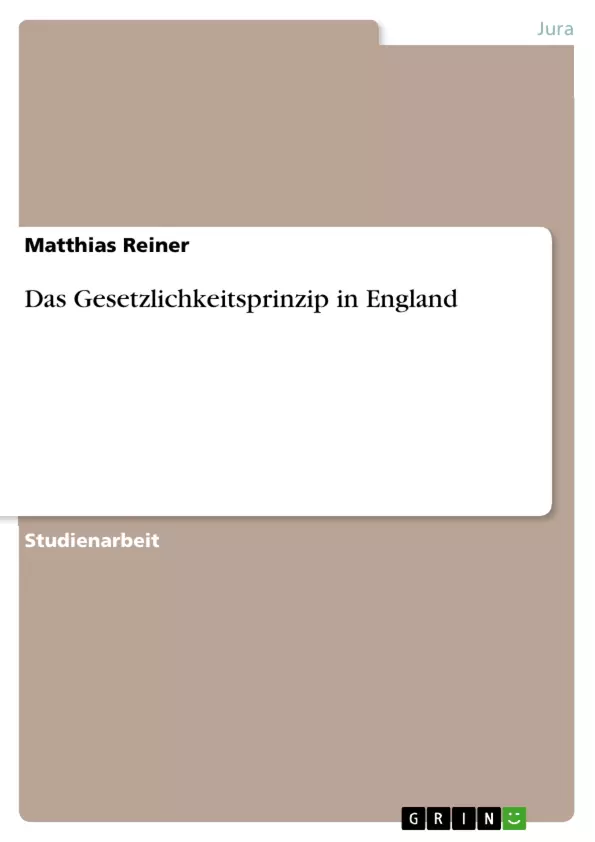Wohl jeder gewissenhafte Jurist in Deutschland kennt das Gesetzlichkeitsprinzip, welches meist in lateinischem Gewand als „Nullum crimen, nulla poena sine lege“ (zu Deutsch: Kein Verbrechen, keine Strafe ohne Gesetz) auftritt. Mit den Worten „Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde“ ist das Prinzip in Deutschland prominent in Art. 103 Abs. 2 GG und § 1 StGB niedergeschrieben.
In England erhielt das Gesetzlichkeitsprinzip jedoch erst durch die Implementierung der Europäischen Menschenrechtskonvention 1998 eine – im kontinentaleuropäischen Verständnis - unmittelbare Rechtsgrundlage. Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass sich die englischen rechtssetzenden, wie auch die rechtsanwendenden Organe schon lange Zeit vorher an das Gesetzlichkeitsprinzip hielten.
In dieser Untersuchung wird deshalb mit einem Blick auf die Rechtsgeschichte Englands die tiefergehende Grundlage für das Gesetzlichkeitsprinzip herausgearbeitet.
Insbesondere der grundlagenbewusste Jurist verknüpft die englische Rechtskultur mit dem auf Präzedenzfällen beruhenden Common Law. Wohl kaum eine andere Strafrechtsordnung in Europa unterscheidet sich derart vom deutschen Strafrecht wie die englische. Wie das System der Präzedenzfälle funktioniert, soll deshalb ebenso untersucht werden.
Daran anschließend wird unter Eingehung auf die verschiedenen Ausprägungen des Gesetzlichkeitsprinzips das englische Verständnis von Strafgesetzlichkeit aufgezeigt. Um dem Leser den besten Erkenntnisgewinn zu garantieren, soll diese Darstellung unter Zuhilfenahme anschaulicher Beispiele erfolgen. Bevor ein abschließendes Fazit gezogen wird, soll noch durchleuchtet werden, wie es in England um die Gesamtkodifikation des Strafrechts steht.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einführung
- B. Grundlagen des englischen Rechts
- I. Rechtshistorischer Überblick
- 1. Die Entstehung des Common Law
- 2. Die Entwicklung englischer Strafgesetzlichkeit
- II. Gegenwärtige Grundlage des Gesetzlichkeitsprinzips
- 1. Verfassungsrechtlicher Bezug
- 2. Rechtstheoretischer Bezug
- 3. Der Human Rights Act 1998
- 4. Die Rechtsquellen englischen Strafrechts
- III. Zusammenspiel
- I. Rechtshistorischer Überblick
- C. Formelle Anforderungen an die Rechtsquelle
- I. Aufriss
- II. Der Mordtatbestand in England
- III. Würdigung
- D. Bestimmtheitsgebot
- I. Überblick
- II. Beispielfälle
- III. Würdigung
- E. Grenzen der Auslegung und Rückwirkungsverbot
- I. Zusammenhang
- II. Grenzen der Auslegung
- 1. Aufriss
- 2. Das Prinzip im Wandel
- III. Rückwirkungsverbot im Common Law
- 1. Schaffung von neuen Delikten
- 2. Aufhebung von Strafausschließungsgründen
- 3. Erweiterung und Schaffung von Strafausschließungsgründen
- IV. Wider den Autoritarismus
- F. Die Idee einer Gesamtkodifikation
- G. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Gesetzlichkeitsprinzip ("Nullum crimen, nulla poena sine lege") im englischen Rechtssystem. Sie beleuchtet dessen historische Entwicklung im Kontext des Common Law und analysiert die gegenwärtige Rechtslage unter Berücksichtigung des Human Rights Act 1998. Die Arbeit zielt darauf ab, das englische Verständnis von Strafgesetzlichkeit im Vergleich zum kontinentaleuropäischen Modell zu verdeutlichen.
- Historische Entwicklung des Gesetzlichkeitsprinzips in England
- Das Zusammenspiel von Common Law und Statute Law im englischen Strafrecht
- Der Einfluss des Human Rights Act 1998 auf das Gesetzlichkeitsprinzip
- Die Bedeutung des Bestimmtheitsgebots und des Rückwirkverbots
- Die Diskussion um eine mögliche Gesamtkodifikation des englischen Strafrechts
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einführung: Die Einleitung zitiert Albert Venn Dicey, einen bedeutenden englischen Juristen, mit der Aussage, dass Engländer allein vom Recht regiert werden. Die Arbeit untersucht, inwieweit dies zutrifft, indem sie das Gesetzlichkeitsprinzip im englischen Rechtssystem im Vergleich zum deutschen System analysiert. Sie hebt die Besonderheiten des englischen Ansatzes hervor, insbesondere die späte, indirekte Kodifizierung des Prinzips durch die Europäische Menschenrechtskonvention im Gegensatz zur direkten Verankerung in deutschem Recht.
B. Grundlagen des englischen Rechts: Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über die Entstehung des englischen Rechts, mit besonderem Fokus auf das Common Law. Es erklärt, wie das Common Law durch die Tätigkeit reisender Richter (Assize Courts) unter Heinrich II. entstand und sich als vorrangiges Recht durchsetzte. Der Abschnitt verdeutlicht die Unterschiede zwischen dem Common Law und dem Statute Law und betont die Bedeutung des Präzedenzfallrechts für die Entwicklung des englischen Strafrechts. Der Einfluss dieses Systems auf das Verständnis und die Anwendung des Gesetzlichkeitsprinzips wird herausgestellt.
C. Formelle Anforderungen an die Rechtsquelle: Dieses Kapitel befasst sich vermutlich mit den formellen Kriterien, die eine Rechtsquelle im englischen Recht erfüllen muss, um als Grundlage für Strafbarkeit zu gelten. Es analysiert wahrscheinlich, wie Klarheit und Bestimmtheit der Rechtstexte im englischen System gewährleistet werden sollen, um dem Prinzip "Nullum crimen, nulla poena sine lege" zu entsprechen. Ein mögliches Beispiel ist die Untersuchung des Mordtatbestandes, um die Anforderungen an die Rechtsklarheit zu demonstrieren.
D. Bestimmtheitsgebot: Dieses Kapitel untersucht detailliert das Bestimmtheitsgebot als zentralen Aspekt des Gesetzlichkeitsprinzips. Es beleuchtet wahrscheinlich den Umfang und die Grenzen des Gebots im englischen Rechtssystem. Anhand von Beispielsfällen wird die Anwendung und Auslegung des Bestimmtheitsgebots in der Praxis verdeutlicht. Die Würdigung dieser Fälle wird eine kritische Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung und ihrer Interpretation des Gebots ermöglichen.
E. Grenzen der Auslegung und Rückwirkungsverbot: Dieses Kapitel dürfte sich mit der Frage befassen, wo die Grenzen der Auslegung von Gesetzen liegen und wie das Rückwirkungsverbot im englischen Common Law umgesetzt wird. Es wird wahrscheinlich die Entwicklung des Prinzips im Wandel der Zeit untersuchen und anhand von Beispielen die Konsequenzen der Schaffung neuer Delikte, Aufhebung oder Erweiterung von Strafausschließungsgründen analysieren. Die Analyse des Rückwirkverbotes im Kontext des Autoritarismus wird vermutlich einen wichtigen Teil dieses Kapitels bilden.
F. Die Idee einer Gesamtkodifikation: Dieses Kapitel dürfte die Diskussion um eine mögliche Kodifikation des englischen Strafrechts behandeln. Es wird verschiedene Argumente für und gegen eine solche Kodifikation untersuchen, und möglicherweise die Vor- und Nachteile einer vollständigen Kodifikation des englischen Strafrechts im Vergleich zum bestehenden System aus Common Law und Statute Law diskutieren.
Schlüsselwörter
Gesetzlichkeitsprinzip, Nullum crimen, nulla poena sine lege, Common Law, Statute Law, Richterrecht, Präzedenzfall, England, Human Rights Act 1998, Bestimmtheitsgebot, Rückwirkungsverbot, Strafgesetzlichkeit, Gesamtkodifikation, Rechtsquellen, Rechtsauslegung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum englischen Gesetzlichkeitsprinzip
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Gesetzlichkeitsprinzip ("Nullum crimen, nulla poena sine lege") im englischen Rechtssystem. Sie beleuchtet dessen historische Entwicklung im Kontext des Common Law und analysiert die gegenwärtige Rechtslage unter Berücksichtigung des Human Rights Act 1998. Ein Vergleich mit kontinentaleuropäischen Modellen wird angestrebt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter die historische Entwicklung des Gesetzlichkeitsprinzips in England, das Zusammenspiel von Common Law und Statute Law im englischen Strafrecht, den Einfluss des Human Rights Act 1998, die Bedeutung des Bestimmtheitsgebots und des Rückwirkverbots sowie die Diskussion um eine mögliche Gesamtkodifikation des englischen Strafrechts.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert (A-G): Eine Einführung, Grundlagen des englischen Rechts (inkl. historischem Überblick und dem Human Rights Act 1998), formelle Anforderungen an Rechtsquellen, das Bestimmtheitsgebot, Grenzen der Auslegung und das Rückwirkungsverbot, die Idee einer Gesamtkodifikation und ein Resümee. Jedes Kapitel ist in Unterkapitel und oftmals weitere Unterpunkte unterteilt.
Welche Rolle spielt das Common Law?
Das Common Law spielt eine zentrale Rolle. Die Arbeit untersucht seine historische Entwicklung und seinen Einfluss auf das Verständnis und die Anwendung des Gesetzlichkeitsprinzips im englischen Recht. Der Unterschied zwischen Common Law und Statute Law wird erläutert und ihre Interaktion im Kontext des Gesetzlichkeitsprinzips analysiert.
Welche Bedeutung hat der Human Rights Act 1998?
Der Human Rights Act 1998 wird als wichtiger Einflussfaktor auf das Gesetzlichkeitsprinzip im englischen Recht hervorgehoben. Seine Rolle in der gegenwärtigen Rechtslage wird detailliert untersucht.
Was sind die zentralen Aspekte des Bestimmtheitsgebots und des Rückwirkverbots?
Die Arbeit analysiert Umfang und Grenzen des Bestimmtheitsgebots und des Rückwirkverbots im englischen Rechtssystem. Anhand von Beispielsfällen wird die praktische Anwendung und Auslegung dieser Prinzipien verdeutlicht.
Wird die Idee einer Gesamtkodifikation diskutiert?
Ja, die Arbeit diskutiert die Vor- und Nachteile einer möglichen Gesamtkodifikation des englischen Strafrechts und setzt diese im Kontext des bestehenden Systems aus Common Law und Statute Law.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Gesetzlichkeitsprinzip, Nullum crimen, nulla poena sine lege, Common Law, Statute Law, Richterrecht, Präzedenzfall, England, Human Rights Act 1998, Bestimmtheitsgebot, Rückwirkungsverbot, Strafgesetzlichkeit, Gesamtkodifikation, Rechtsquellen, Rechtsauslegung.
Gibt es Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält ausführliche Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, die deren Inhalte und Schwerpunkte prägnant beschreiben.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke bestimmt und dient der Analyse von Themen im englischen Rechtssystem auf strukturierte und professionelle Weise.
- Quote paper
- Matthias Reiner (Author), 2017, Das Gesetzlichkeitsprinzip in England, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/417351