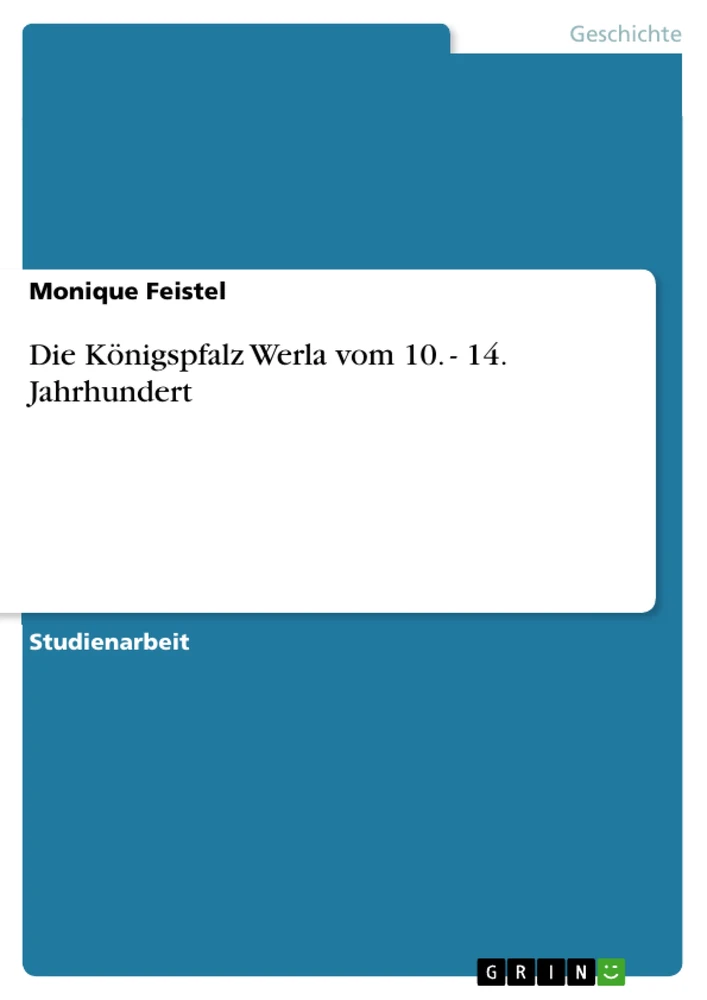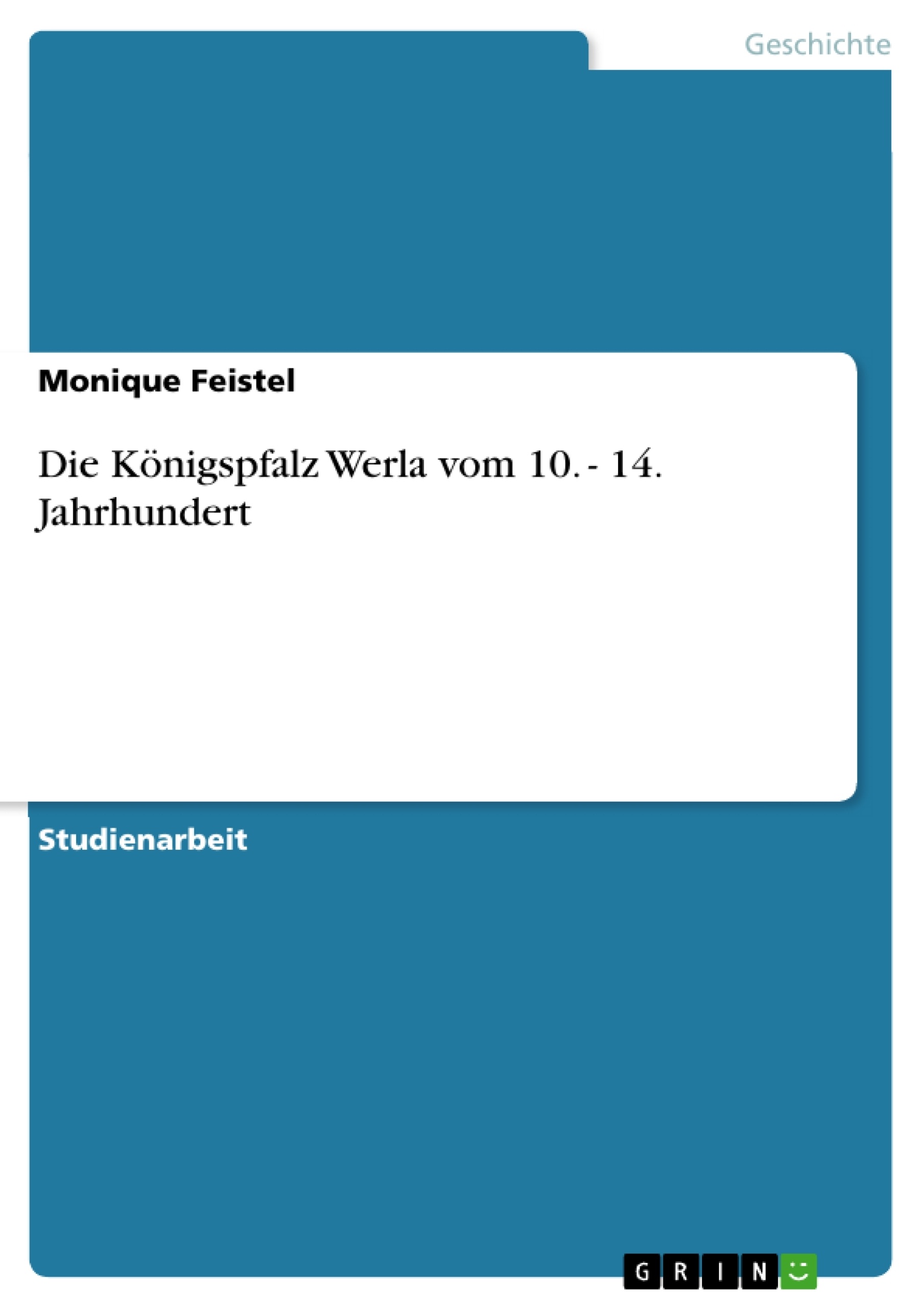Als man die Werla im 19. Jahrhundert wiederentdeckte, war obererdig von ihr so gut wie nichts erhalten. Erst intensive Grabungen von 1875 bis 1964 verschafften uns heute das Bild, welches wir von der größten Pfalzanlage Niedersachsens haben. Einst war sie eine bedeutende Stätte für die Reichsherren, vor allem im zehnten Jahrhundert für die Ottonen. Doch verlor sie im Laufe der Jahre immer mehr an Bedeutung, da die Pfalz Goslar am Rammelsberg der Vorreiter wurde. Bis zum vierzehnten Jahrhundert konnte die Werla sich durch ihre Wirtschaft noch aufrecht erhalten, bevor sie zur Wüstung verfiel und weitgehend in Vergessenheit geriet. Dieser kurze Wirkungszeitraum der Werla soll dennoch nicht ohne große Bedeutung und Folgen gewesen sein. Betrachtet man den Aufbau und Grundriss der Werla, so zeugt sich dieser als ein typischer Aufbau einer frühmittelalterlichen Pfalz. Herrensitz, Wirtschaftshof und eine ausgedehnte Befestigung konnten rekonstruiert werden.
In dieser Arbeit soll nach einem kurzen Geschichtlichen Überblick zur Werla, die Anlage mit ihren wichtigsten Gebäuden beschrieben und gedeutet werden. Auch soll die Lage von Herrensitz und Wirtschaftshof diskutiert werden. Zum Schluss wird die Funktion und Bedeutung der Werla aufgezeigt, sowie ein Ausblick zur weiteren Forschungsgeschichte gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zur Geschichte der Pfalz
- 2.1. Namensherkunft
- 2.2. Werla im 10.-12. Jahrhundert
- 2.3. Die Verortung der Pfalz
- 3. Die Anlage der Werla
- 4. Funktion und Bedeutung der Pfalz
- 5. Forschungsausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Königsfalz Werla vom 10. bis 14. Jahrhundert. Ziel ist es, anhand archäologischer Funde und historischer Quellen die Anlage, Funktion und Bedeutung der Pfalz zu beschreiben und zu interpretieren. Die Arbeit beleuchtet insbesondere die Entwicklung der Pfalz über verschiedene Bauphasen und deren strategische und politische Rolle im frühmittelalterlichen Sachsen.
- Die Geschichte und Namensherkunft der Pfalz Werla
- Die Architektur und Anlage der Pfalz, inklusive Hauptburg und Vorburgen
- Die Funktion der Pfalz als königlicher Herrschaftssitz und Versammlungsort
- Die wirtschaftliche Bedeutung der Pfalz und ihr Verhältnis zum Umland
- Offene Forschungsfragen und Ausblick auf zukünftige Untersuchungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit behandelt die Königsfalz Werla, deren oberirdische Reste im 19. Jahrhundert entdeckt wurden. Ausgrabungen erbrachten Erkenntnisse über die größte Pfalzanlage Niedersachsens, die im 10. Jahrhundert unter den Ottonen eine bedeutende Rolle spielte, bevor sie im Laufe der Zeit an Goslar verlor und verfiel. Die Arbeit konzentriert sich auf die Beschreibung der Anlage, die Lage von Herrensitz und Wirtschaftshof und die Funktion und Bedeutung der Pfalz.
2. Zur Geschichte der Pfalz: Dieses Kapitel beleuchtet die Geschichte der Pfalz Werla, beginnend mit der Namensherkunft, die auf den Flussnamen Werila zurückzuführen ist. Die frühesten schriftlichen Erwähnungen stammen aus dem 10. Jahrhundert, die Pfalz diente Heinrich I. und Otto I. als Stützpunkt und Versammlungsort. Im Laufe des 11. und 12. Jahrhunderts verlor Werla an Bedeutung zugunsten von Goslar, behielt aber bis ins 14. Jahrhundert eine wirtschaftliche Funktion bevor sie wüst fiel. Die Quellenlage ist spärlich, weswegen die archäologischen Funde von großer Bedeutung sind.
3. Die Anlage der Werla: Das Kapitel beschreibt die Anlage der Pfalz Werla in vier Bauphasen. Die erste Phase umfasste eine Hauptburg mit Erdwall, gefolgt von der Erweiterung durch Vorburgen und Ringmauern. Die Hauptburg enthielt Wohngebäude, Repräsentationsbauten und eine Kirche. Detailliert werden der Palas I mit seiner Heizanlage, der Palas II als möglicher Repräsentationssaal, sowie die Kirche mit ihren verschiedenen Bauphasen und Bestattungen beschrieben. Die Vorburgen mit ihren Verteidigungsanlagen und die Wirtschaftsgebäude werden ebenfalls analysiert, wobei die Wasserversorgung und die Infrastruktur der Pfalz beleuchtet werden.
4. Funktion und Bedeutung der Pfalz: Dieses Kapitel diskutiert die Funktion der Pfalz Werla als königlicher Herrschaftssitz, Versammlungsort und militärischer Stützpunkt. Es werden die weltliche und kirchliche Bedeutung der Anlage im Kontext der ottonischen und späteren Herrscher untersucht. Die Rolle der Pfalz für das Umland und ihr Einfluss auf andere Pfalzen und Burgen, insbesondere Goslar, werden analysiert. Die Arbeit untersucht die Parallelen zur Pfalz Goslar und zu ungarischen Burgen.
5. Forschungsausblick: Das Kapitel benennt offene Forschungsfragen und den Bedarf an weiteren Untersuchungen auf dem Gelände der Pfalz Werla. Diskutiert werden die unterschiedlichen Interpretationen der Anlage (Burg, Pfalz, Königshof), die ungeklärte Lage der Dorfkirche, die unzureichend erforschten Vorburgen und die Wasserversorgung. Die Notwendigkeit einer Neubewertung der Funde aus früheren Grabungen und die Bedeutung zukünftiger Forschung werden hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Königspfalz Werla, Ottonen, Frühmittelalter, Archäologie, Baugeschichte, Hauptburg, Vorburgen, Funktion, Bedeutung, Wirtschaft, Militär, Repräsentation, Forschungsausblick.
Häufig gestellte Fragen zur Königsfalz Werla
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Königsfalz Werla vom 10. bis 14. Jahrhundert. Sie analysiert anhand archäologischer Funde und historischer Quellen die Anlage, Funktion und Bedeutung dieser wichtigen Pfalzanlage im frühmittelalterlichen Sachsen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Geschichte und Namensherkunft der Pfalz Werla, ihre Architektur und Anlage (Hauptburg und Vorburgen), ihre Funktion als königlicher Herrschaftssitz und Versammlungsort, ihre wirtschaftliche Bedeutung und ihr Verhältnis zum Umland, sowie offene Forschungsfragen und einen Ausblick auf zukünftige Untersuchungen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Geschichte der Pfalz Werla, Anlage der Werla, Funktion und Bedeutung der Pfalz, und Forschungsausblick. Jedes Kapitel fasst einen spezifischen Aspekt der Pfalz Werla zusammen.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung stellt die Königsfalz Werla vor, deren oberirdische Reste im 19. Jahrhundert entdeckt wurden. Sie beschreibt die Bedeutung der Pfalz als größte Pfalzanlage Niedersachsens im 10. Jahrhundert unter den Ottonen und ihren späteren Verfall. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der Anlage, der Lage von Herrensitz und Wirtschaftshof sowie der Funktion und Bedeutung der Pfalz.
Welche Informationen enthält das Kapitel zur Geschichte der Pfalz Werla?
Dieses Kapitel beleuchtet die Geschichte der Pfalz, beginnend mit der Namensherkunft (vom Flussnamen Werila). Es beschreibt die ersten schriftlichen Erwähnungen aus dem 10. Jahrhundert, die Nutzung durch Heinrich I. und Otto I., den Bedeutungsschwund zugunsten Goslars im 11. und 12. Jahrhundert und die bis ins 14. Jahrhundert andauernde wirtschaftliche Funktion bevor die Pfalz wüst fiel. Die spärliche Quellenlage und die Bedeutung archäologischer Funde werden hervorgehoben.
Wie beschreibt die Arbeit die Anlage der Werla?
Das Kapitel zur Anlage beschreibt die Pfalz in vier Bauphasen. Es werden die Hauptburg mit Erdwall, die Erweiterung durch Vorburgen und Ringmauern, die Wohngebäude, Repräsentationsbauten, die Kirche mit ihren Bauphasen und Bestattungen, die Vorburgen mit Verteidigungsanlagen und Wirtschaftsgebäude detailliert analysiert, inklusive der Wasserversorgung und Infrastruktur.
Welche Funktionen und Bedeutung wird der Pfalz Werla zugeschrieben?
Dieses Kapitel diskutiert die Funktion der Pfalz als königlicher Herrschaftssitz, Versammlungsort und militärischer Stützpunkt. Es untersucht die weltliche und kirchliche Bedeutung im Kontext der ottonischen und späteren Herrscher, die Rolle der Pfalz für das Umland und ihren Einfluss auf andere Pfalzen und Burgen (insbesondere Goslar), sowie Parallelen zur Pfalz Goslar und ungarischen Burgen.
Welche offenen Forschungsfragen werden im Ausblick genannt?
Der Forschungsausblick benennt offene Fragen wie unterschiedliche Interpretationen der Anlage (Burg, Pfalz, Königshof), die ungeklärte Lage der Dorfkirche, die unzureichend erforschten Vorburgen und die Wasserversorgung. Die Notwendigkeit einer Neubewertung alter Funde und die Bedeutung zukünftiger Forschung werden betont.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Königspfalz Werla, Ottonen, Frühmittelalter, Archäologie, Baugeschichte, Hauptburg, Vorburgen, Funktion, Bedeutung, Wirtschaft, Militär, Repräsentation, Forschungsausblick.
- Arbeit zitieren
- Monique Feistel (Autor:in), 2017, Die Königspfalz Werla vom 10. - 14. Jahrhundert, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/415925