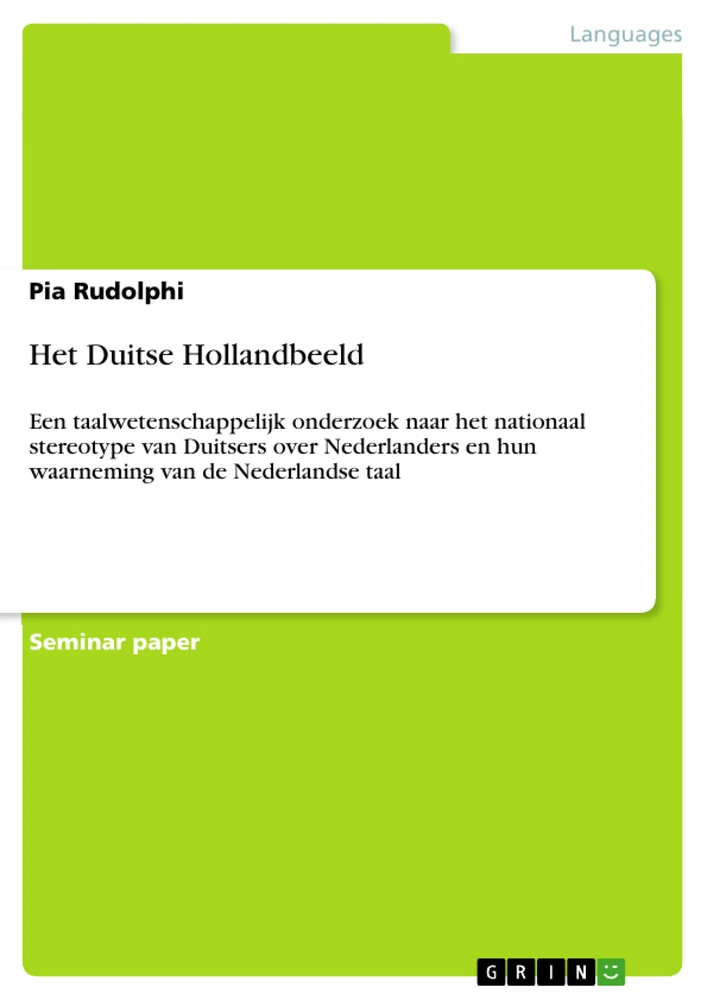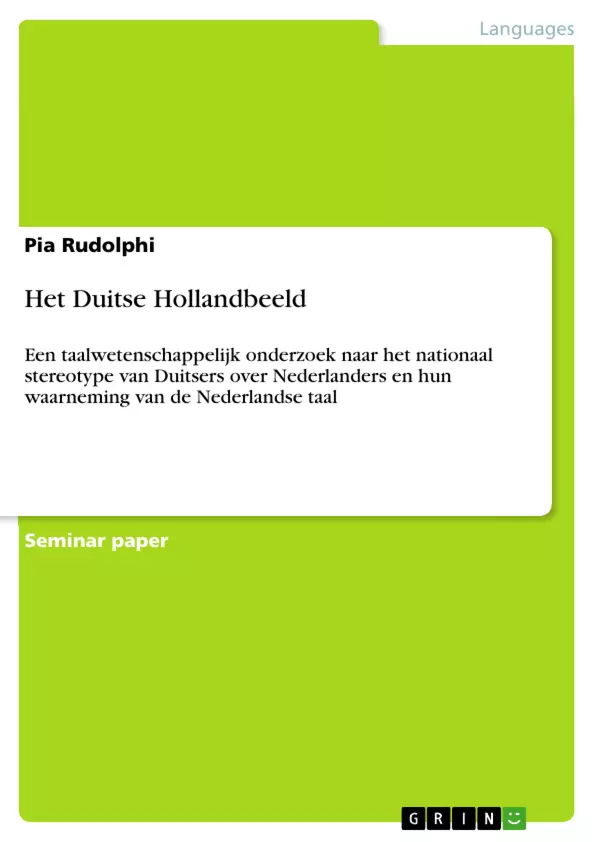Het is algemeen bekend, of het lijkt de algemene openbare mening te zijn, dat Duitsers positief ingesteld zijn tegenover de Nederlanders. Uit onderzoek bleek, dat Duitsers zelfs positiever tegenover Nederlanders dan tegenover zichzelf ingesteld zijn (Beelen, 2001). Men zou kunnen denken, dat het altijd zo is geweest: de onvriendelijke, hardwerkende Duitser en de sympathieke, gastvriendelijke Nederlander. Maar als men het Duitse Hollandbeeld in de literatuur bekijkt, lijkt er een door de eeuwen heen wisselend, niet steeds positief beeld te existeren.
In de 17e eeuw keken de Duitsers nog vol bewondering op Nederland. Vanaf de tweede helft van de 18e eeuw keken ze echter vol hoogmoed op hen neer. Vooral de taal is een “bevoorrecht mikpunt van spot” (Groenewold, 2001). De meeste auteurs tussen 1790 en 1870 herhalen voortdurend de stereotypen en vooroordelen van de longue dureé en storen zich aan de “zonder meer lelijke Nederlandse taal” (Groenewold, 2001). Het Duits beeld van de Nederlander lijkt toen doorgaans negatief te zijn: langzaam, plomp, stijf, koud, pedant en formeel (Groenewold, 2001). Slechts een handvol auteurs probeert dit negatief beeld te relativeren. Zo schrijft Langbehn dat de “Hollanders de betere Duitsers zijn” en dat “vooroordelen zouden verdwijnen als de Duitsers … meer tot “Hollandgangers” zouden worden” (Groenewold, 2001).
In de literatuur uit de naoorlogse periode is een duidelijk positievere houding, maar tegelijkertijd nog steeds negatief beeld van de Duitsers over de Nederlanders te vinden (Groenewold, 2001). Volgens Groenewold (2001) is er bij de auteurs uit de tijd van de Weimarer Republiek meer kennis over Nederland te vinden dan in de naoorlogse periode.
Tegenwoordig, in het begin van de 21e eeuw, is nog steeds deze bestendige positieve houding te vinden. Beelen (2001) beschrijft het stereotype van andere nationaliteiten als nationaal stereotype . Hoe zo een nationaal stereotype eruit kan zien presenteerde DER SPIEGEL in 1994: het destijds typische Holland-cliché “Frau Antje”.
De karikaturist Sebastian Krüger beeldde ze af met verschillende stereotypen: tulpen, molen, drugs, bier enz. (Hetzel, 2009). Zowel de karikatuur als ook het artikel bereidden een groot discussiepotentiaal, omdat het een publiek negatief beeld verbreidde: Nederland is decadent, een drugsparadijs en crimineel (Hetzel, 2009).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Inleiding
- 2. Voorafgaand onderzoek
- 3. Onderzoek
- 3.1 Onderzoeksvragen
- 3.2 Methode
- 3.3 Verwachtingen
- 4. Resultate
- 4.1 Stereotype van Duitsers over Nederlanders
- 4.2 Waarneming van de Nederlandse spreekster
- 4.3 Kennis en contact
- 5. Conclusie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das aktuelle deutsche Stereotyp von Niederländern und deren Wahrnehmung der niederländischen Sprache. Ziel ist es, das heutige Bild, das Deutsche von Niederländern haben, zu aktualisieren und zu analysieren, ob dieses Bild mit dem Kontakt zu Niederländern und der Kenntnis des Landes zusammenhängt.
- Das aktuelle deutsche Stereotyp von Niederländern
- Die Wahrnehmung der niederländischen Sprache durch Deutsche
- Der Zusammenhang zwischen dem deutschen Bild von Niederländern und dem Kontakt/der Kenntnis des Landes
- Vergleich mit historischen Bildern des "Hollandbildes" in der deutschen Literatur
- Analyse von bestehenden Forschungslücken zum Thema
Zusammenfassung der Kapitel
1. Inleiding: Die Einleitung stellt die allgemeine, scheinbar positive Einstellung der Deutschen gegenüber Niederländern fest, basierend auf früheren Studien wie der von Beelen (2001). Sie beleuchtet jedoch auch den Wandel des deutschen Hollandbildes in der Literatur, von Bewunderung im 17. Jahrhundert über Herablassung im 18. und 19. Jahrhundert (mit negativen Stereotypen wie „langsam, plomp, stijf, kalt, pedant und formeel“) bis hin zu einem wieder positiveren, aber immer noch ambivalenten Bild in der Nachkriegszeit. Die Arbeit begründet die Notwendigkeit einer Aktualisierung des Stereotyps und die Untersuchung der Wahrnehmung der niederländischen Sprache.
2. Voorafgaand onderzoek: Dieses Kapitel beleuchtet den bisherigen Forschungsstand zur deutsch-niederländischen Beziehung. Es wird deutlich, dass zwar viel über die niederländische Wahrnehmung von Deutschen geforscht wurde, jedoch weniger über die Gegenrichtung. Es werden frühere Studien, wie das Europroject-Forschung von Hagendoorn (1995) und das Euregio-Forschung (Blank & Wiengarn, 1994), erwähnt, die positive Einstellungen der Deutschen gegenüber Niederländern aufzeigen, gleichzeitig aber auch die Forschungslücke im Fokus auf die deutsche Perspektive betonen.
Schlüsselwörter
Deutsch-Niederländisches Verhältnis, nationales Stereotyp, Sprachwahrnehmung, Niederländisch, Deutschland, Hollandbild, Empirie, Enquête, Stereotypen, Vorurteile, Kontakt, Kenntnis.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Das deutsche Stereotyp von Niederländern und die Wahrnehmung der niederländischen Sprache
Was ist das Thema dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht das aktuelle deutsche Stereotyp von Niederländern und deren Wahrnehmung der niederländischen Sprache. Sie analysiert, welches Bild Deutsche von Niederländern haben und ob dieses Bild mit dem Kontakt zu Niederländern und der Kenntnis des Landes zusammenhängt.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das heutige deutsche Bild von Niederländern zu aktualisieren und zu analysieren, ob und wie es mit dem Kontakt zu Niederländern und der Kenntnis des Landes korreliert. Sie untersucht auch die Wahrnehmung der niederländischen Sprache durch Deutsche.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit dem aktuellen deutschen Stereotyp von Niederländern, der Wahrnehmung der niederländischen Sprache, dem Zusammenhang zwischen dem deutschen Bild von Niederländern und dem Kontakt/der Kenntnis des Landes, einem Vergleich mit historischen Bildern des „Hollandbildes“ in der deutschen Literatur und der Analyse bestehender Forschungslücken.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Vorangegangenes Forschungsgebiet, Forschungsdurchführung (inkl. Forschungsfragen, Methode und Erwartungen), Ergebnisse (inkl. Stereotypen, Wahrnehmung der niederländischen Sprache und dem Einfluss von Kontakt/Kenntnis) und Schlussfolgerung.
Was wird in der Einleitung besprochen?
Die Einleitung stellt die scheinbar positive allgemeine Einstellung der Deutschen gegenüber Niederländern fest (basierend auf früheren Studien). Sie beleuchtet aber auch den Wandel des deutschen „Hollandbildes“ in der Literatur – von Bewunderung im 17. Jahrhundert über negative Stereotypen im 18. und 19. Jahrhundert bis hin zu einem wieder positiveren, aber ambivalenten Bild in der Nachkriegszeit. Die Notwendigkeit einer Aktualisierung des Stereotyps und die Untersuchung der Wahrnehmung der niederländischen Sprache werden begründet.
Was wird im Kapitel zum Vorangegangenen Forschungsgebiet behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet den bisherigen Forschungsstand zur deutsch-niederländischen Beziehung. Es zeigt, dass zwar viel über die niederländische Wahrnehmung von Deutschen geforscht wurde, aber weniger über die Gegenrichtung. Es werden frühere Studien (z.B. Europroject von Hagendoorn (1995) und Euregio-Forschung (Blank & Wiengarn, 1994)) erwähnt, die positive Einstellungen der Deutschen gegenüber Niederländern aufzeigen, aber auch die Forschungslücke im Fokus auf die deutsche Perspektive betonen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Deutsch-Niederländisches Verhältnis, nationales Stereotyp, Sprachwahrnehmung, Niederländisch, Deutschland, Hollandbild, Empirie, Enquête, Stereotypen, Vorurteile, Kontakt, Kenntnis.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse befassen sich mit dem deutschen Stereotyp von Niederländern, der Wahrnehmung der niederländischen Sprechern und dem Einfluss von Wissen und Kontakt auf die Wahrnehmung.
- Quote paper
- Pia Rudolphi (Author), 2017, Het Duitse Hollandbeeld, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/414013