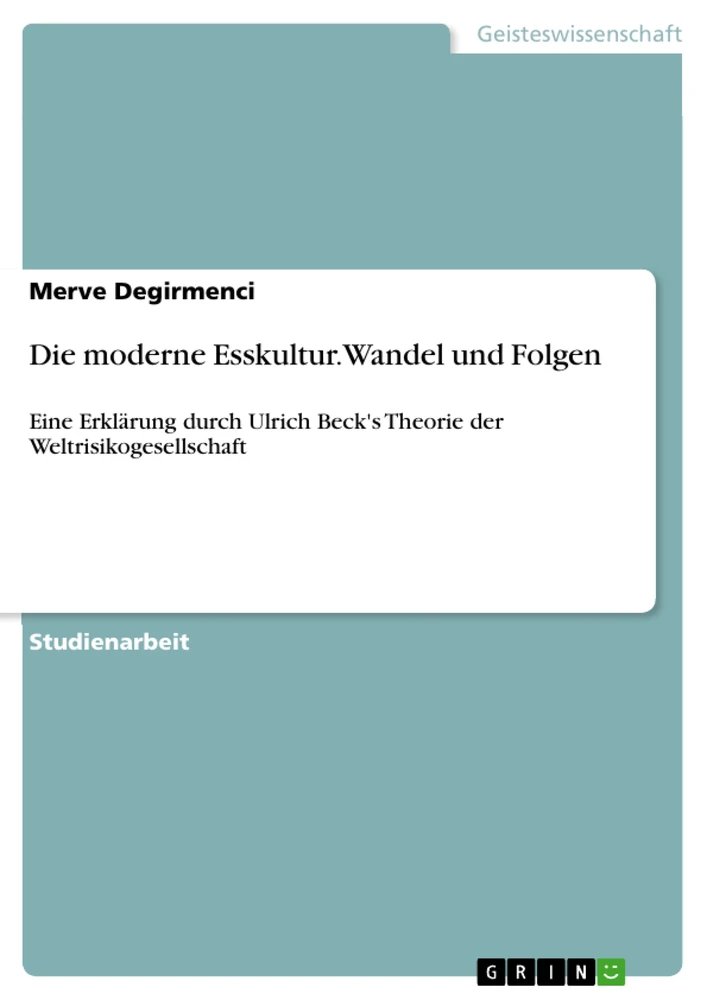Heute ist es für Menschen normal, Nahrung aus der Fabrik zu verzehren. Die Ernährungsindustrie ist zu einer der größten Branchen geworden. In den Supermärkten finden wir viele verschiedene Produkte vor und für jeden ist etwas dabei. Ob man sich nun vegetarisch ernährt, an Bio glaubt oder doch lieber Tiefkühlkost isst, Lebensmittel in alle dieser Richtungen werden heute hergestellt. Millionen von Menschen müssen ernährt werden, dies wäre ohne industrialisierte Produktion heute nicht mehr möglich. Es ist normal geworden, nicht mehr zu wissen, wie ein bestimmtes Nahrungsmittel hergestellt wurde, denn sie werden hinter den Kulissen verarbeitet und fertig in den Supermarktregal gestellt.
Unter diesem Hintergrund möchte der Autor im Laufe seiner Arbeit herausfinden, inwiefern Essen einen kulturellen Anspruch hat und wie sich die Esskultur heute gestaltet. Durch das Heranziehen der Theorie von der „Weltrisikogesellschaft“ und der damit verbundenen These der Industrialisierung sollen die Wandlungen in der Esskultur und die dadurch verursachten Folgen für die Umwelt analysiert werden.
Das Nahrungsbedürfnis ist das erste Bedürfnis eines jeden Menschen, das vor allen anderen Bedürfnissen befriedigt werden muss. Ohne Nahrung ist das Überleben und Leben unmöglich, es ist eine physische Notwendigkeit.
Wie in der bekannten Maslow’schen Pyramide dargestellt, bildet die Ernährung als physische Notwendigkeit die Basis menschlichen Überlebens. Erst, wenn die „niedrigsten Bedürfnisse“ - außer Schlafen und Kleidung vor allem die Ernährung - erfüllt sind, kann sich der Mensch um seine „höheren Bedürfnisse“ kümmern. An der Spitze der Pyramide stehen also die kulturellen Bedürfnisse des Menschen, die entfallen, wenn der Mensch nicht vorher sein Überleben durch Nahrungsmittelzufuhr gesichert hat. Daraus resultiert für das Essen, dass es in Zeiten der Not außer der biologischen Notwendigkeit keine kulturelle Bedeutung besitzt.
Dies würde eine klare Trennung von Natur und Kultur in Anbetracht des Essens bedeuten, der Mensch sei somit ein Wesen, das vom Natur- in den Kulturzustand übergeht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Von der Natur der Ernährung zur Kultur des Essens
- Nahrung als biologische Notwendigkeit
- Zur Anthropologie des Essens
- Die biokulturelle Erklärung
- Das strukturalistische Modell
- Der Omnivore-Charakter des Menschen
- Fazit aus allen drei Positionen
- Kultureller Anteil beim Essen
- Die „natürliche Künstlichkeit“ des Menschen nach Helmut Plessner
- Die „natürliche Künstlichkeit“ des Essens
- Essen als Kultur
- Die Küche als ein kulturelles Regelwerk
- Verfestigung in bestimmten Institutionen
- Kulturelle und soziale Differenzierung durch Essen
- Diät als kulturelle Abgrenzung von den Anderen
- Vegetarischer Lebensstil als Ausdruck individueller Selbstbestimmtheit
- Weibliches und Männliches Essen als Indiz für klassische Rollenverteilung
- Esskultur im gesellschaftlichen Wandel
- Massenproduktion und Entfremdung
- Veränderung des Konsumverhaltens
- Auswirkungen auf die Umwelt
- Ulrich Beck: Auf dem Weg in die Zweite Moderne
- Das Leben in einer Risikogesellschaft
- Theorie reflexiver Moderne
- Risiken
- Individualisierungsthese
- Kosmopolitisierung
- Das Leben in einer Risikogesellschaft
- Anwendung der Theorie Becks auf die Esskultur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Wandel der Esskultur und seinen Folgen, insbesondere im Kontext von Ulrich Becks Theorie der Weltrisikogesellschaft. Ziel ist es, die Entwicklung der Esskultur von der biologischen Notwendigkeit zur kulturellen Praxis zu beleuchten und die Auswirkungen der Industrialisierung, der Massenproduktion und der Entfremdung auf die heutige Esskultur zu analysieren.
- Die anthropologische Bedeutung von Essen als kulturelle Praxis
- Die Rolle der Industrialisierung und der Massenproduktion in der Entwicklung der Esskultur
- Die Folgen der Esskultur für die Umwelt
- Die Anwendung der Theorie der Weltrisikogesellschaft auf die Esskultur
- Die Bedeutung von Individualisierung und Kosmopolitisierung für die Esskultur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Relevanz der Esskultur in der heutigen Zeit dar. Kapitel 2 beleuchtet die Entwicklung der Esskultur von der biologischen Notwendigkeit zur kulturellen Praxis und analysiert unterschiedliche Theorien zum Verhältnis von Natur und Kultur im Kontext von Essen.
Kapitel 3 untersucht die Bedeutung der Küche als kulturelles Regelwerk und die soziale und kulturelle Differenzierung durch Essen. Kapitel 4 beleuchtet die Auswirkungen des gesellschaftlichen Wandels auf die Esskultur, insbesondere die Folgen der Massenproduktion und der Entfremdung.
Kapitel 5 stellt die Theorie der Weltrisikogesellschaft von Ulrich Beck vor und diskutiert die Konzepte der reflexiven Moderne, Individualisierung und Kosmopolitisierung. Kapitel 6 wendet die Theorie Becks auf die Esskultur an und analysiert die Folgen der Industrialisierung und der Individualisierung für die Esskultur.
Schlüsselwörter
Esskultur, Weltrisikogesellschaft, Industrialisierung, Massenproduktion, Entfremdung, Umwelt, Individualisierung, Kosmopolitisierung, Reflexive Moderne, Biokulturelle Erklärung, Strukturalistisches Modell.
- Quote paper
- Merve Degirmenci (Author), 2017, Die moderne Esskultur. Wandel und Folgen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/413389