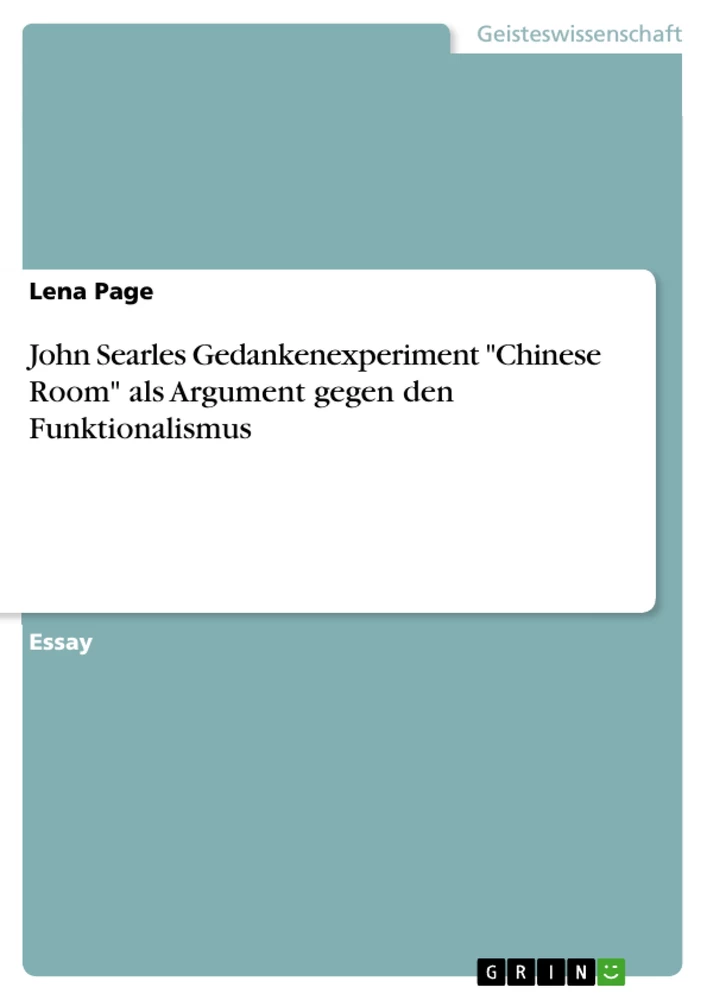Gibt es so etwas wie eine Seele, wie verhält sie sich zum Körper, wie verhalten sich mentale und physische Zustände zueinander? Das alles sind Fragen, die man sich nicht nur manchmal im Alltag stellt, sondern mit denen sich ein ganzes philosophisches Teilgebiet, die Philosophie des Geistes, beschäftigt. Eine Antwort auf die Fragen, die sich auch unter dem Stichwort Leib-Seele-Problem zusammenfassen lassen, gibt der Funktionalismus.
Funktionalisten vertreten die These, dass mentale Zustände funktionale Zustände sind. Diese funktionalen Zustände sind durch ihre kausale Rolle definiert. Die kausale Rolle wiederum wird bestimmt durch die Input-, Interaktions- und Output-Klauseln.
Und genau an diesem Punkt möchte ich ansetzen. Ich möchte dafür argumentieren, dass es nicht ausreicht, die richtigen Funktionen (Input, Interaktion und Output) zu erfüllen um davon sprechen zu können, sich in einem mentalen Zustand zu befinden oder einen Verstand zu haben. Zu diesem Zweck werde ich das von John Searle entwickelte Gedankenexperiment des „Chinese Room“ verwenden, welches im Folgenden erläutert werden soll. Danach werde ich darstellen, welches Fazit Searle selbst aus dem Gedankenexperiment zieht. Da keine philosophische Position unumstritten bleibt, werde ich mich im darauffolgenden Teil des Essays den Einwänden gegen Searles Argumente widmen um anschließend John Searles Argumentation noch einmal zu beleuchten wie er es auch tut.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Der „Chinese Room“
- Searles Argumentation (Teil 1)
- Einwände und Searles Erwiderung
- Searles Argumentation (Teil 2)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay von Lena Page analysiert John Searles Gedankenexperiment „Chinese Room“ als Argument gegen den Funktionalismus in der Philosophie des Geistes. Der Text zielt darauf ab, zu untersuchen, ob das Erfüllen von funktionalen Zuständen, wie sie der Funktionalismus definiert, ausreichend für mentales Verstehen und Bewusstsein ist. Dabei wird die Frage gestellt, ob Maschinen denken können, insbesondere ob digitale Computer in der Lage sind, Sprache wirklich zu verstehen.
- John Searles Gedankenexperiment „Chinese Room“
- Funktionalismus und die Definition von mentalen Zuständen
- Syntax und Semantik im Kontext von Sprache und Verständnis
- Kritik am Funktionalismus aus der Perspektive des „Chinese Room“
- Die Bedeutung von kausaler Interaktion mit der Welt für mentales Verstehen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt die Problemstellung des Leib-Seele-Problems vor und führt den Funktionalismus als eine mögliche Antwort darauf ein. Der Autor beschreibt die Funktionsweise des Funktionalismus und betont die Bedeutung der kausalen Rolle mentaler Zustände. Das zweite Kapitel widmet sich dem Gedankenexperiment „Chinese Room“ und erläutert den Aufbau des Experiments, die Unterscheidung zwischen Syntax und Semantik, und Searles Interpretation des Experiments. In Kapitel drei werden zwei gängige Einwände gegen Searles Argumentation vorgestellt und seine Erwiderungen darauf analysiert. Abschließend fasst das vierte Kapitel Searles Hauptargumentation zusammen, in der er die Frage nach dem Denken von Maschinen und digitalen Computern untersucht und seine Schlussfolgerung präsentiert.
Schlüsselwörter
Der Essay dreht sich um die zentralen Themen des Funktionalismus, des Leib-Seele-Problems, des Gedankenexperiments „Chinese Room“, der Unterscheidung zwischen Syntax und Semantik, und der Frage nach dem Denken von Maschinen und künstlicher Intelligenz. Weitere wichtige Begriffe sind die kausale Rolle von mentalen Zuständen, die Bedeutung von kausaler Interaktion mit der Welt, und die philosophische Position des Funktionalismus.
- Quote paper
- Lena Page (Author), 2012, John Searles Gedankenexperiment "Chinese Room" als Argument gegen den Funktionalismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/412530