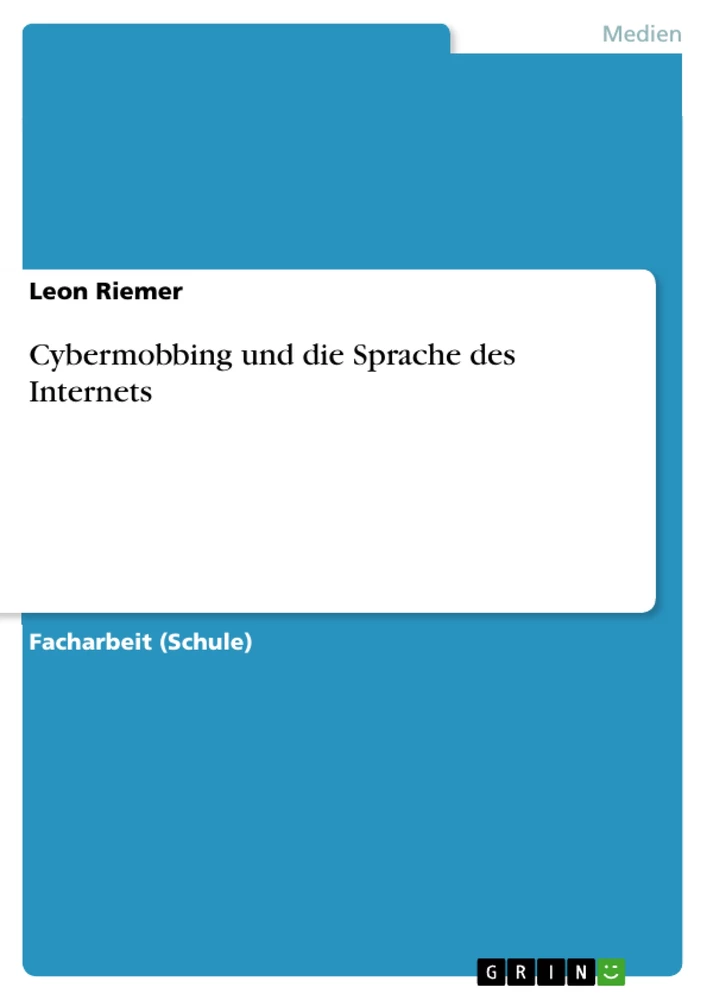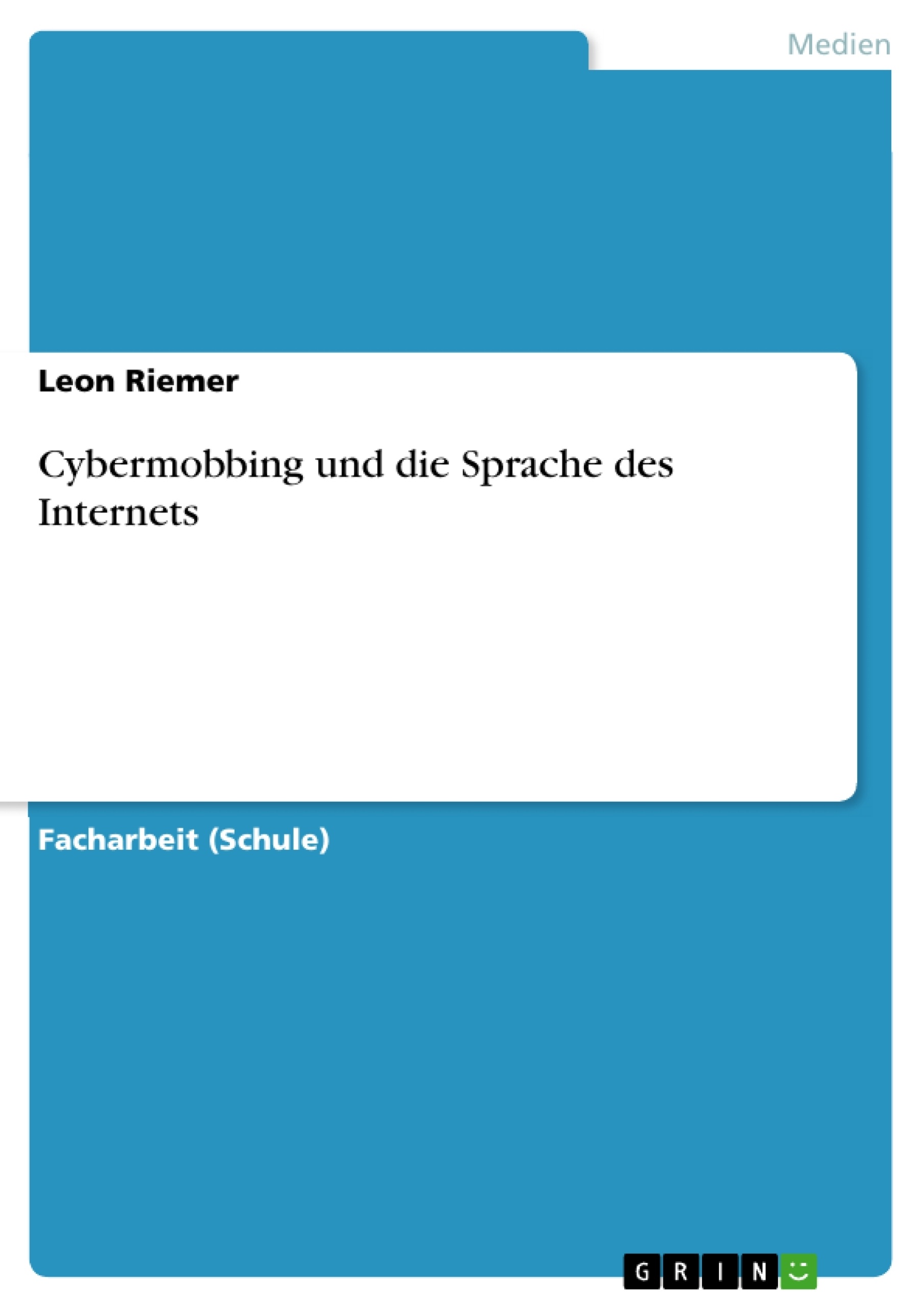Das Thema Cybermobbing spielt in der heutigen Gesellschaft eine große Rolle und nimmt auch in verschiedensten Weisen im Unterrichtsgeschehen eine große Rolle ein. Dadurch, dass wir in den modernen Medien und im Besonderen in den sozialen Plattformen über dieses Problem in Kontakt kommen und somit informiert werden, ist im Grunde jeder in der Lage, etwas über diesen Themenbereich zu erzählen. Jeder tritt damit in Kontakt, egal ob man es möchte oder nicht. Mobbing ist generell gesagt ein sehr großes Thema und Cybermobbing ein Unterthema davon.
Im Pädagogikunterricht wurde dieses Thema ausführlich genug behandelt, um feststellen zu können, dass viel mehr Leute betroffen sind als man es glaubt. Das Ganze geschieht sehr häufig in den sozialen Plattformen und die Mittel sind wirklich interessant. Als Außenstehender kann man denken, dass heutzutage in einer komplett anderen Sprache geschrieben wird. Aber doch, es handelt sich um die deutsche Sprache, zwar ist diese etwas verfremdet, dennoch kann man sie verstehen. Die Sprache des Internets löst momentan die geregelte deutsche Sprache zumindest im Internet ab, um eine schnellere Kommunikation zu ermöglichen.
Auch diese Art von Problemstellung fasziniert mich, da der Sprachwandel und in gewissen Zügen auch der Sprachverfall ein hoch interessanter Fall ist, welches uns alle betrifft und somit sehr aktuell ist. Dem Thema Mobbing liegt also der Sprachwandel und die Sprache des Internets zugrunde. Meinen Überlegungen zufolge habe ich also zwei ansprechende Themen gefunden, welche eine Verbindung haben und es sich daher lohnt, diese zwei Bereiche zu kombinieren.
Da die Welt nie aufhört zu funktionieren und daher der Kreislauf nicht gestoppt wird, ist folgende Fragestellung entstanden: Wie ist die deutsche Sprache zu wahren? Muss man dazu erst die Sprache des Internets "eliminieren" oder reicht simples Aufklären?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Cybermobbing - was ist das eigentlich?
- Die Sprache des Internets
- Problemfrage: Wie ist die deutsche Sprache zu wahren?
- Fazit und eigene Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Phänomen des Cybermobbings und untersucht dabei insbesondere die Rolle der Sprache im Internet. Ziel ist es, die Eigenheiten der Sprache im Internet zu beleuchten und deren Bedeutung im Kontext von Cybermobbing zu analysieren. Die Arbeit stellt die Frage, wie die deutsche Sprache im digitalen Raum bewahrt werden kann.
- Cybermobbing als moderne Form des Mobbings
- Die Sprache des Internets als eigenständiges Sprachsystem
- Der Einfluss der Sprache auf die Kommunikation im Internet
- Die Bedeutung des Sprachwandels im digitalen Raum
- Die Herausforderungen für die deutsche Sprache im Internet
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Arbeit stellt das Thema Cybermobbing und seine Verbindung zur Sprache des Internets in den Vordergrund. Cybermobbing wird als ein aktuelles und relevantes Problem der heutigen Gesellschaft beschrieben, das sowohl in den Medien als auch im Unterricht eine große Rolle spielt.
Cybermobbing – was ist das eigentlich?
Das Kapitel erklärt den Begriff des Cybermobbings und grenzt ihn vom klassischen Mobbing ab. Cybermobbing findet vor allem im Internet statt und nutzt soziale Plattformen, um Personen zu bedrohen, zu beleidigen oder bloßzustellen. Die Arbeit verdeutlicht die besondere Gefahr des Cybermobbings, da Täter im Internet eine anonyme Identität annehmen können.
Die Sprache des Internets
Dieses Kapitel widmet sich der Sprache des Internets und beschreibt sie als ein eigenständiges Sprachsystem, das sich von der Alltagssprache der Erwachsenen und Jugendlichen unterscheidet. Die Sprache des Internets basiert auf der deutschen Sprache, beinhaltet aber auch Elemente anderer Sprachen sowie eigens kreierte Wörter. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung der englischen Sprache im Internet und zeigt auf, dass die Sprache des Internets von Land zu Land unterschiedlich ist.
- Arbeit zitieren
- Leon Riemer (Autor:in), 2018, Cybermobbing und die Sprache des Internets, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/412388