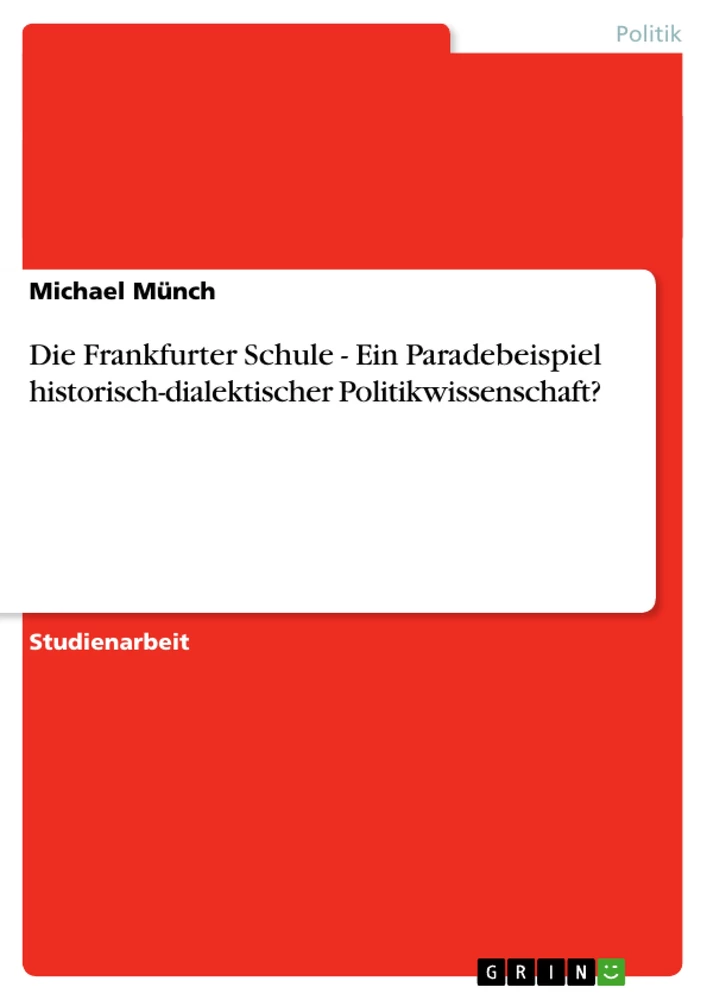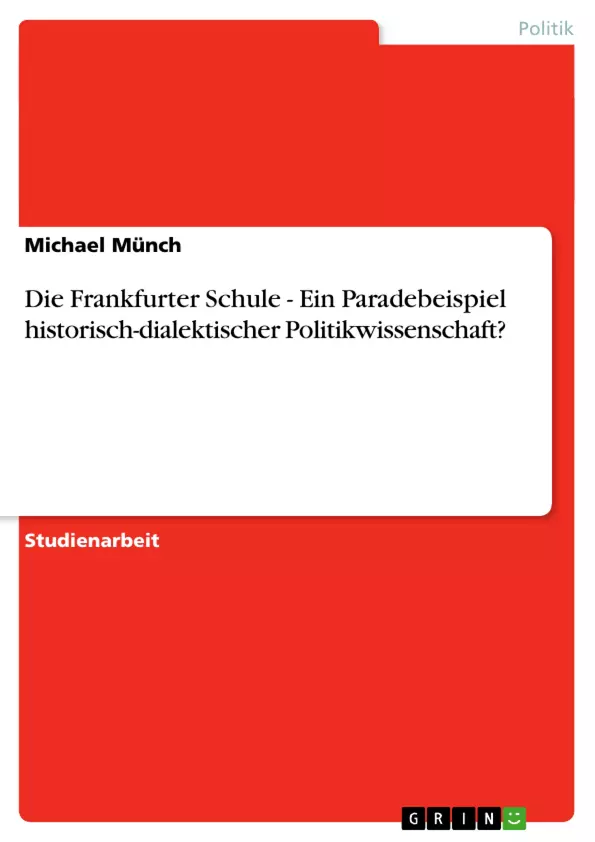Am 22. Juni 1924 wurde an der Universität in Frankfurt am Main feierlich das Institut für Sozialforschung eingeweiht. Zum ersten Direktor ernannte man den 1861 in Rumänien geborenen und marxistisch orientierten Juristen Carl Grünberg. Seine oberste Prämisse lautete den Marxismus nicht in parteipolitische Zusammenhänge zu bringen, sondern ihn unter rein (objektiven) wissenschaftlichen Gesichtspunkten zu behandeln . Nachdem Grünberg jedoch im Januar 1928 einen Schlaganfall erlitten hatte, musste er seine Arbeit am Institut für Sozialforschung aufgeben. Die Diskussion um einen politisch nicht vorbelasteten Nachfolger entbrannte und fand erst im Oktober 1930 mit der Berufung von Max Horkheimer als neuen Direktor ein für viele Beteiligte überraschendes Ende . Dieser wollte das Institut zu einer fachübergreifenden Einrichtung umbauen, die sich den sozialen, philosophischen, geschichtlichen und wirtschaftlichen Themen empirisch nähern sollte, um eine umfassende Gesellschaftstheorie zu entwickeln. Der wissenschaftliche Marxismus eines Max Horkheimers weckte bei dessen Universitätskollegen mehr Vetrauen und ließ eine scheinbare Verknüpfung mit den modernen bürgerlichen Wissenschaften zu .
Obwohl während der Zeit des US-Exils die Vetreter der Frankfurter Schule sich auch empirischen Studien widmeten, mussten die pragmatischen Methoden der amerikanischen Sozialwissenschaft mehr und mehr der Gesellschaftskritik weichen. So fehlte Horkheimer in den Arbeiten eines Paul Lazarsfeld schlichtweg die gesamtgesellschaftliche Einordnung der erzielten empirischen Ergebnisse . Bis in die 1960er Jahre spielte dieses Verständnis von Politikwissenschaft, welches als historisch-dialektischer oder auch kritisch-dialektischer Theorie-Ansatz bekannt wurde, keine maßgebliche Rolle. Erst als einige „jüngere Politologen ihr Fach grundsätzlicher Kritik zu unterziehen begannen“ , um es als vermeintliche Legitimationswissenschaft des kapitalistischen bundesrepublikanischen Systems zu entlarven, rückten die Schlagwörter der „Kritischen Theorie“ und „Frankfurter Schule“ in ein breites öffentliches Bewusstsein und wurden zum Paradebeispiel historisch-dialektischer Politikwissenschaft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Aufbau
- Forschungsstand
- Historisch-dialektische Politikwissenschaft
- Geschichtlichkeit
- Totalität
- Dialektik
- Die Kritische Theorie der Frankfurter Schule
- Naturzweck und Naturgeschichte
- Totalität versus Stückwerk
- Das Dialektik-Projekt
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der historisch-dialektischen Politikwissenschaft, insbesondere im Kontext der Frankfurter Schule. Sie untersucht, welche Elemente diesen Ansatz charakterisieren, auf welchen philosophischen Traditionen er basiert und wie er sich in der Politikwissenschaft der Frankfurter Schule manifestiert. Die Arbeit analysiert, ob die Frankfurter Schule tatsächlich als kritisch, historisch und dialektisch betrachtet werden kann.
- Die wesentlichen Elemente des historisch-dialektischen Theorie-Ansatzes
- Der Einfluss philosophischer Traditionen auf die Frankfurter Schule
- Die Ausprägung des historisch-dialektischen Ansatzes in der Politikwissenschaft der Frankfurter Schule
- Die Kritizität, Historizität und Dialektik der Frankfurter Schule
Zusammenfassung der Kapitel
Das zweite Kapitel erläutert die konstitutiven Bestandteile der historisch-dialektischen Politikwissenschaft. Es beleuchtet die Philosophien von Immanuel Kant, Friedrich Hegel, Karl Marx und Friedrich Engels und analysiert die Begriffe der Geschichtlichkeit, Totalität und Dialektik in ihren Werken. Dabei werden Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Fortentwicklungen im Begriffsverständnis herausgearbeitet.
Kapitel drei widmet sich der Analyse der historisch-dialektischen Elemente in der Frankfurter Schule. Es konzentriert sich auf die Arbeitsgemeinschaft von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno als zentrale Vertreter. Der Fokus liegt dabei auf der „Dialektik der Aufklärung“ und der „Negativen Dialektik“, um die eingangs gestellten Fragen zu beantworten.
Schlüsselwörter
Historisch-dialektische Politikwissenschaft, Kritische Theorie, Frankfurter Schule, Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung, Negative Dialektik, Geschichtlichkeit, Totalität.
- Arbeit zitieren
- Michael Münch (Autor:in), 2005, Die Frankfurter Schule - Ein Paradebeispiel historisch-dialektischer Politikwissenschaft?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/40290