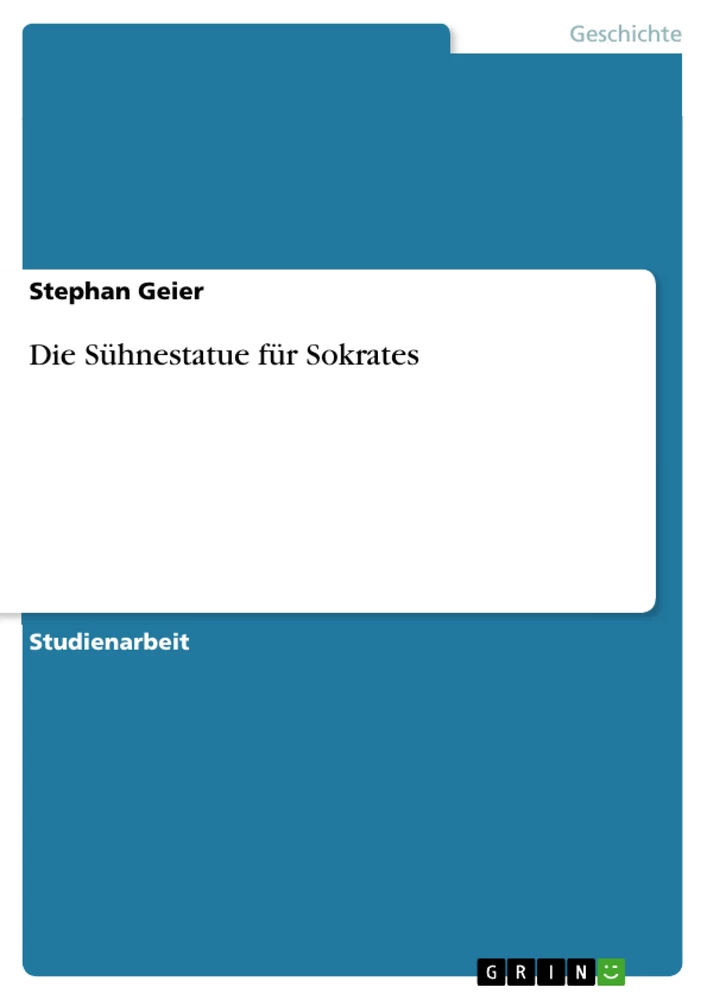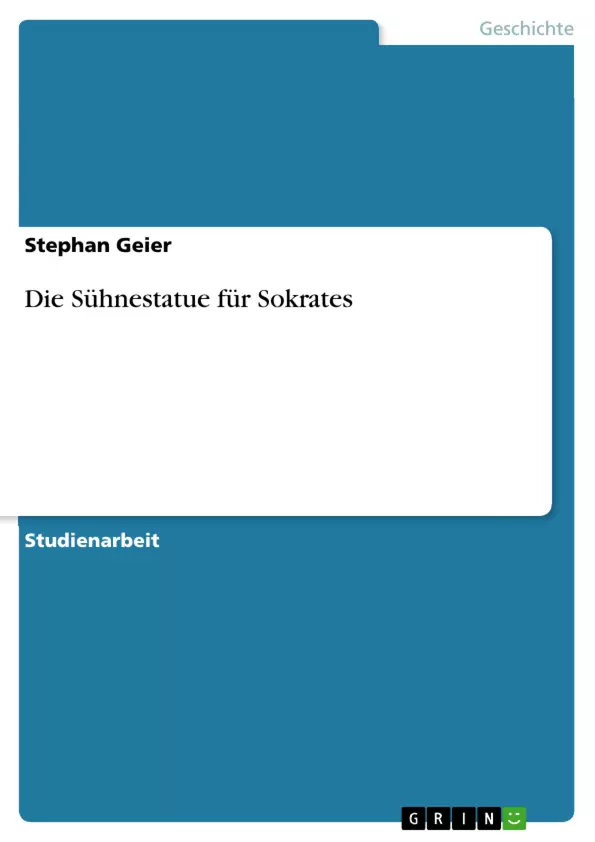Das Griechenland des 4. Jahrhunderts vor Christus gilt allgemein als Geburtsstätte dessen, was man heute unter dem Begriff Philosophie versteht. Weniger die Auseinandersetzung mit den
Naturerscheinungen, die schon viel früher in Mesopotamien, Ägypten und dem ägäischem Raum Thema menschlicher Betrachtung waren, als vielmehr die Hinwendung zum Menschen selbst. Die ethischen und moralischen Ansätze und Fragen, wie auch Theorie und Methodik
der griechischen Philosophenschulen sind zu den großen geistigen Errungenschaften der Menschheitsgeschichte zu zählen. Den antiken Quellen nach begann dieser Siegeszug um 400 v. Chr., als ein Mann durch die Straßen von Athen wanderte und es wagte, daß
Selbstverständnis des guten Bürgers öffentlich in Frage zu stellen, die alten Normen und Sitten zu hinterfragen und eine wachsende Zahl von Anhängern um sich zu scharen. Dieser Mann trug den Namen Sokrates und gilt seit der Antike als der große Begründer der Philosophie.
Von seinen einflußreichen Schülern später zur Lichtgestalt verklärt und als herausragender Sohn der athenischen Bürgerschaft gepriesen, war er zu Lebzeiten alles andere als ein Lieblingskind der Athener. Gottlosigkeit und verderblicher Einfluß auf die Jugend wurden ihm
vorgeworfen, die Verurteilung folgte und kostete ihn das Leben. Doch bald schon sollte der Demos seinen Fehler bereuen und so heißt es bei Diogenes Laertios II, 431, daß ihm zu Ehren eine Bronzestatue im Pompeion errichtet wurde, um die Schuld, die sich die Athener mit seiner Hinrichtung aufgeladen hatten, zu sühnen.
Dieser Statue des Sokrates widmet sich nun die folgende Seminararbeit. Ganz im Stile des Proseminars „Die griechische Ehrenstatue” im Wintersemester 1999/2000 wird hierbei auf die
Person des Dargestellten in seiner Zeit, die relevanten Bildnisse und römischen Repliken und die Rekonstruktion der Originalstatue eingegangen. Das besondere Augenmerk liegt dabei auf
dem Aspekt der Sühnestatue. Es wird auf Aufstellungsort, Datierung und Bedeutung dieses Werkes näher eingegangen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Person des Sokrates
- Die frühen Bildnisse des Sokrates
- Inhalt
- Die Originalstatue
- Epilog: Der Reiz der Andersartigkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Sühnestatue des Sokrates, die nach Diogenes Laertios im Pompeion errichtet wurde. Die Arbeit analysiert die Person Sokrates im Kontext seiner Zeit, die vorhandenen Bildnisse und römischen Repliken, und rekonstruiert die Originalstatue. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Aspekt der Sühnestatue – Aufstellungsort, Datierung und Bedeutung.
- Sokrates' Leben und Wirken im Kontext des antiken Athen
- Analyse der erhaltenen Bildnisse und Repliken der Sokrates-Statue
- Rekonstruktion der Original-Sühnestatue
- Der Aspekt der Sühnestatue als Ausdruck athenischer Schuld und Reue
- Sokrates' Abweichung vom Ideal des athenischen Bürgers
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Seminararbeit ein, indem sie die Bedeutung Sokrates für die Philosophie und die Entstehung der Sühnestatue im Kontext des antiken Athen beleuchtet. Sie beschreibt den Fokus der Arbeit auf die Person Sokrates, die relevanten Bildnisse und die Rekonstruktion der Originalstatue, mit besonderem Augenmerk auf den Aspekt der Sühnestatue.
Zur Person des Sokrates: Dieses Kapitel skizziert das Leben und Wirken Sokrates. Es beleuchtet seine Herkunft, seinen Beruf, seine philosophische Tätigkeit, die Methode der Maieutik und seine Auseinandersetzung mit den Sophisten. Der Prozess und die Verurteilung Sokrates werden detailliert geschildert, ebenso die unterschiedlichen Quellen über sein Leben und Wirken, wie Platon und Xenophon, und die Schwierigkeiten bei der Rekonstruktion seines Aussehens. Das Kapitel betont die Diskrepanz zwischen Sokrates' Leben und dem Idealbild des athenischen Bürgers.
Die frühen Bildnisse des Sokrates: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Analyse der erhaltenen Bildnisse und Repliken der Sokrates-Statue, insbesondere auf die von Richter als Typ A und Typ B klassifizierten Porträttypen. Es beschreibt die charakteristischen Merkmale der jeweiligen Typen und diskutiert deren Entstehungszeit und mögliche Künstler. Die unterschiedlichen Darstellungen werden detailliert verglichen, und die Schwierigkeiten bei der Rekonstruktion der Originalstatue aufgrund des Mangels an direkten Quellen werden erörtert. Die Beschreibungen beziehen sich auf spezifische Exponate in verschiedenen Museen, wobei die Ähnlichkeit zu den Silen-Darstellungen hervorgehoben wird. Der Bezug zu Sokrates' Abweichung vom Ideal der Kalokagathia wird thematisiert.
Schlüsselwörter
Sokrates, Sühnestatue, Pompeion, Athen, Philosophie, Bildnisse, Repliken, Silanion, Kalokagathia, Maieutik, Sophisten, Antike, Porträttypen, Rekonstruktion.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Die Sühnestatue des Sokrates
Was ist das Thema der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die im Pompeion errichtete Sühnestatue des Sokrates. Sie analysiert Sokrates' Leben und Wirken, die vorhandenen Bildnisse und römischen Repliken, und rekonstruiert die Originalstatue. Ein besonderer Fokus liegt auf der Sühnestatue selbst – ihrem Aufstellungsort, ihrer Datierung und Bedeutung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel: Einleitung, Zur Person des Sokrates, Die frühen Bildnisse des Sokrates, Inhalt (welches genauer im Text nicht spezifiziert ist), Die Originalstatue, und Epilog: Der Reiz der Andersartigkeit. Die Zusammenfassung der Kapitel bietet detaillierte Einblicke in den jeweiligen Inhalt.
Was sind die Zielsetzung und Themenschwerpunkte?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Sühnestatue des Sokrates zu untersuchen. Wichtige Themen sind Sokrates' Leben im Kontext des antiken Athen, die Analyse erhaltener Bildnisse und Repliken, die Rekonstruktion der Originalstatue und die Bedeutung der Sühnestatue als Ausdruck athenischer Schuld und Reue. Die Abweichung Sokrates' vom Ideal des athenischen Bürgers wird ebenfalls thematisiert.
Welche Aspekte von Sokrates' Leben werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet Sokrates' Herkunft, Beruf, philosophische Tätigkeit (Maieutik), Auseinandersetzung mit den Sophisten, seinen Prozess und seine Verurteilung. Sie berücksichtigt unterschiedliche Quellen (Platon, Xenophon) und die Schwierigkeiten bei der Rekonstruktion seines Aussehens und betont die Diskrepanz zwischen Sokrates' Leben und dem Idealbild des athenischen Bürgers.
Wie werden die Bildnisse des Sokrates analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf erhaltene Bildnisse und Repliken, insbesondere die von Richter als Typ A und Typ B klassifizierten Porträttypen. Es werden charakteristische Merkmale, Entstehungszeit, mögliche Künstler und der Vergleich der verschiedenen Darstellungen diskutiert. Die Schwierigkeiten der Rekonstruktion aufgrund fehlender direkter Quellen und die Ähnlichkeit zu Silen-Darstellungen werden ebenfalls erörtert. Der Bezug zu Sokrates' Abweichung vom Ideal der Kalokagathia wird hergestellt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Sokrates, Sühnestatue, Pompeion, Athen, Philosophie, Bildnisse, Repliken, Silanion, Kalokagathia, Maieutik, Sophisten, Antike, Porträttypen, Rekonstruktion.
Welche Bedeutung hat die Sühnestatue?
Die Sühnestatue wird als Ausdruck athenischer Schuld und Reue im Zusammenhang mit der Verurteilung Sokrates interpretiert. Ihr Aufstellungsort, ihre Datierung und ihre Bedeutung im Kontext des antiken Athen bilden einen zentralen Forschungsschwerpunkt der Arbeit.
- Quote paper
- Stephan Geier (Author), 1999, Die Sühnestatue für Sokrates, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/3900