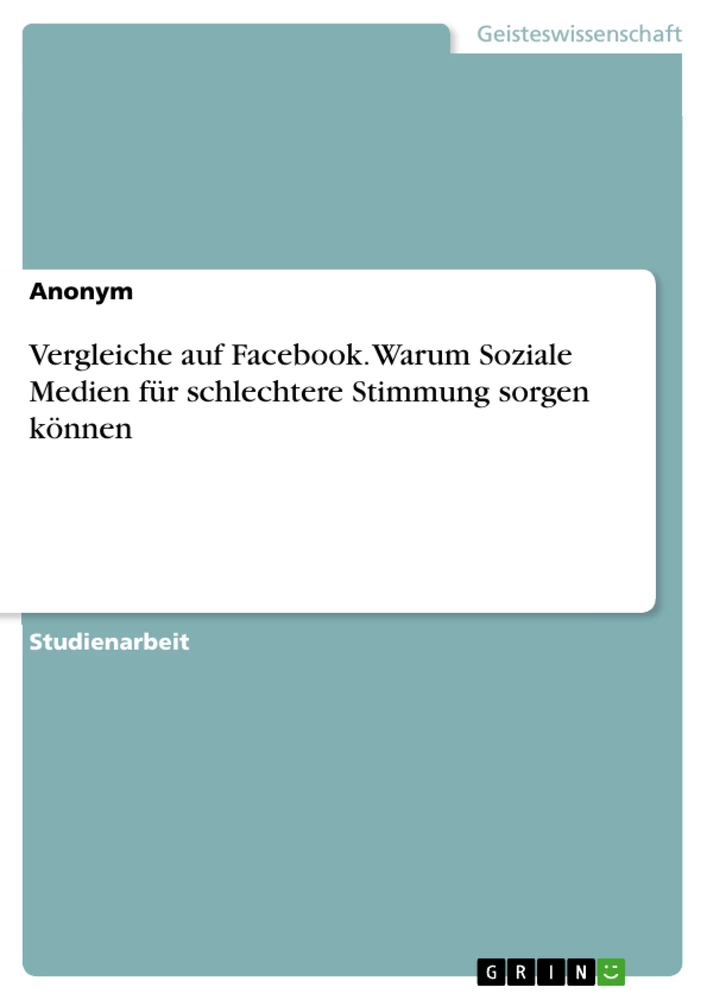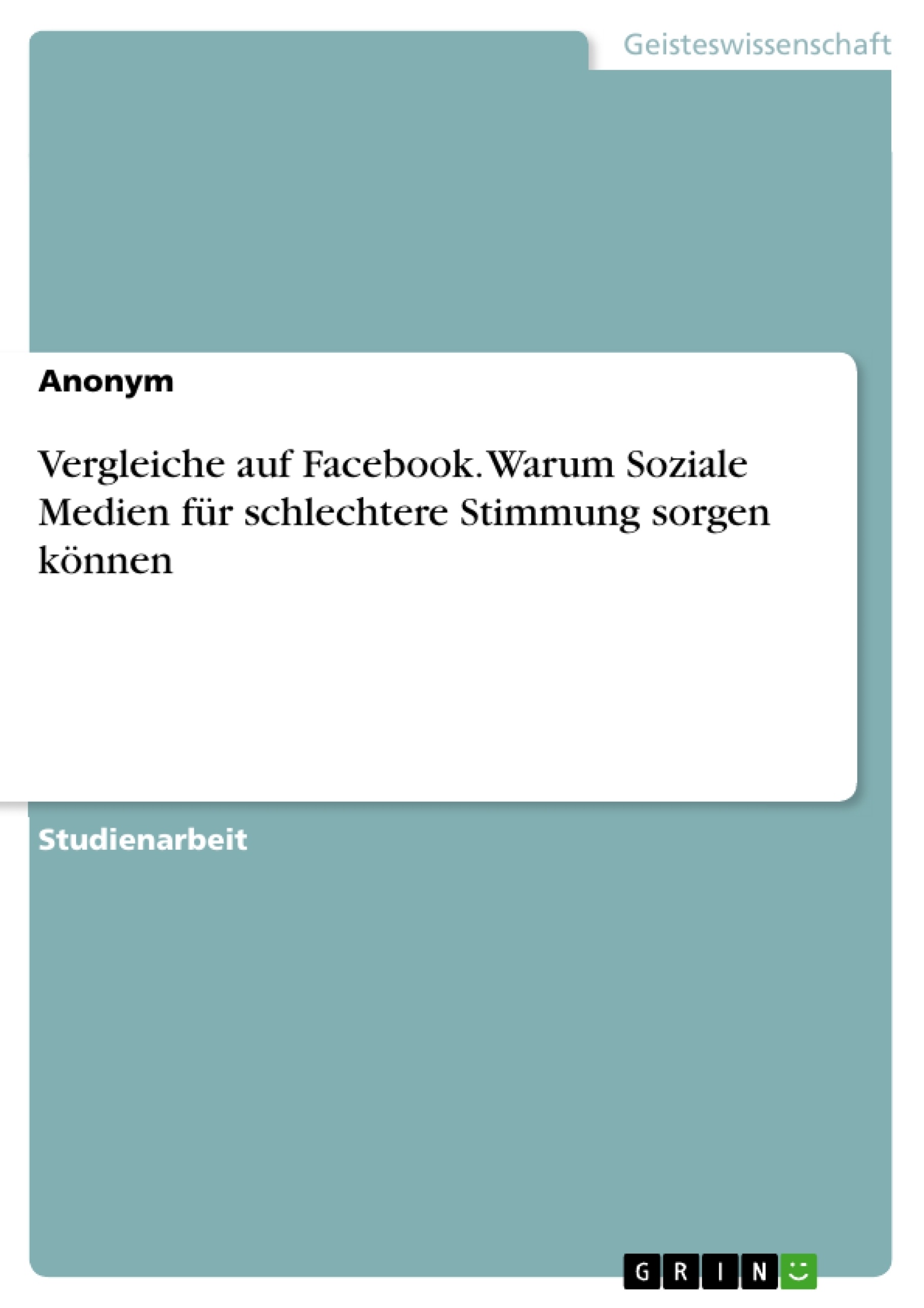Das soziale Netzwerk Facebook gewinnt in der modernen Welt zunehmend an Bedeutung. So konzentrieren sich viele Forschungsstudien auf die daraus entstehenden Online Beziehungen und das Posting-Verhalten der Nutzer. Ein Prozess, der aus der Vielzahl an dadurch verfügbaren Informationen zwangsläufig entsteht, ist der des sozialen Vergleiches. Menschen vergleichen ihre eigenen Eigenschaften und Erfolge, wie Aussehen, Karriere oder Lebensstandard mit denen ihrer Facebook Freunde. Die Studien von Chou und Edge, Haferkamp und Krämer sowie Sagioglou und Greitemeyer zeigen, dass ebendiese Vergleichsprozesse zu einem negativen Stimmungsabfall und einer Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben bei den Vergleichsdurchführenden führt. Eine Erklärung dafür kann der so genannte Attributionsfehler sein. Hierbei handelt es sich um einen menschlichen Wahrnehmungsfehler, der zur Vernachlässigung situationsbezogener Informationen führt und stattdessen den Verhaltensgrund auf die Persönlichkeitseigenschaften des Handelnden zurückführt.
Menschen nehmen aus den unterschiedlichsten Gründen in verschiedenen Situationen soziale Vergleichsprozesse vor. Motivationale Gründe hierfür sind das Bedürfnis nach einer korrekten Selbsteinschätzung, eine Selbstwerterhöhung und eine tatsächliche Selbstverbesserung. Soziale Vergleiche fungieren zudem im Alltag als mentale Abkürzungen, um zu einer möglichst präzisen und schnellen Einschätzung von sich selbst, anderen Personen und Gruppen zu gelangen. Diese Prozesse können dabei zwischen Gruppen, aber auch zwischen Individuen stattfinden. Mit Vergleichen mit und zwischen Gruppen beschäftigen sich die Theorie relativer Deprivation und die Bezugsgruppentheorie. Die moderne Forschung zu sozialen Vergleichsprozessen hingegen befasst sich mit Vergleichen zwischen Individuen und dem Selbst, wobei das Selbst die Zielperson darstellt und die anderen Individuen als Standard bezeichnet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Theorie der sozialen Vergleiche
- Festingers Theorie der sozialen Vergleichsprozesse
- Das Motiv des positiven Selbstbildes und der Selbstverbesserung
- Auf- und abwärtsgerichtete Vergleiche
- Assimilations- und Kontrasteffekte
- Soziale Vergleiche auf Facebook
- Empirische Untersuchungen
- Studie 1
- Methode
- Ergebnisse
- Diskussion
- Studie 2
- Ergebnisse
- Diskussion
- Studie 3
- Methode
- Ergebnisse
- Diskussion
- Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen sozialer Vergleiche auf Online-Plattformen, insbesondere Facebook, auf das Wohlbefinden der Nutzer. Sie analysiert, wie die Fülle an Informationen auf solchen Plattformen zu Vergleichen des eigenen Lebens mit dem der Freunde führt und welche Konsequenzen dies hat.
- Die Theorie der sozialen Vergleiche nach Festinger
- Die Rolle von Facebook als Plattform für soziale Vergleiche
- Negative Auswirkungen sozialer Vergleiche auf die Stimmung und das Selbstwertgefühl
- Empirische Studien zu den Auswirkungen von Facebook auf das Wohlbefinden
- Mögliche Erklärungen für negative Effekte sozialer Vergleiche
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema soziale Vergleiche auf Facebook ein und erläutert die wachsende Bedeutung von sozialen Netzwerken wie Facebook und deren Einfluss auf das menschliche Verhalten. Sie hebt die Relevanz der Forschung zu sozialen Vergleichen im Kontext von Online-Plattformen hervor und beschreibt die zentrale Fragestellung der Arbeit: Wie beeinflusst Facebook die Stimmung und das Selbstwertgefühl der Nutzer durch soziale Vergleiche?
Die Theorie der sozialen Vergleiche: Dieses Kapitel präsentiert die theoretischen Grundlagen der sozialen Vergleichsprozesse, beginnend mit Festingers Theorie und seinen zentralen Annahmen zum menschlichen Bedürfnis nach Selbsteinschätzung durch Vergleich mit anderen. Es werden verschiedene Arten von Vergleichen (aufwärtsgerichtet, abwärtsgerichtet), sowie Assimilations- und Kontrasteffekte diskutiert, und der Fokus wird auf die Anwendung dieser Theorie im Kontext von Facebook gelegt. Der Abschnitt zeigt auf, wie das ständige Verfügbarsein von Informationen über die Lebensumstände anderer zu einem erhöhten Auftreten von sozialen Vergleichen führt.
Schlüsselwörter
Soziale Vergleiche, Facebook, Online-Plattformen, Selbstwertgefühl, Stimmung, Wohlbefinden, Festinger, Attribution, Neid, Missgunst, Selbstbild.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Auswirkungen sozialer Vergleiche auf Facebook
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen sozialer Vergleiche auf Online-Plattformen, insbesondere Facebook, auf das Wohlbefinden der Nutzer. Sie analysiert, wie die Fülle an Informationen auf Facebook zu Vergleichen des eigenen Lebens mit dem der Freunde führt und welche Konsequenzen dies hat.
Welche Theorien werden behandelt?
Die zentrale Theorie ist Festingers Theorie der sozialen Vergleichsprozesse. Die Arbeit beschreibt verschiedene Aspekte dieser Theorie, darunter aufwärts- und abwärtsgerichtete Vergleiche, Assimilations- und Kontrasteffekte und deren Anwendung im Kontext von Facebook.
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Arbeit beschreibt mehrere empirische Studien (Studie 1, Studie 2, Studie 3) mit detaillierten Angaben zu Methode und Ergebnissen. Die genauen Methoden der einzelnen Studien werden jedoch im gegebenen HTML-Fragment nicht explizit genannt, sondern nur in der Inhaltsangabe aufgeführt.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die konkreten Ergebnisse der empirischen Studien sind im gegebenen HTML-Fragment nicht detailliert aufgeführt. Die Zusammenfassung beschränkt sich auf die Hinweise, dass die Studien die Auswirkungen von Facebook auf Stimmung und Selbstwertgefühl untersucht haben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Soziale Vergleiche, Facebook, Online-Plattformen, Selbstwertgefühl, Stimmung, Wohlbefinden, Festinger, Attribution, Neid, Missgunst, Selbstbild.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Theorie der sozialen Vergleiche, ein Kapitel mit den empirischen Untersuchungen (inklusive mehrerer Einzelstudien) und eine abschließende Diskussion. Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Forschungsfrage. Das Kapitel zu den sozialen Vergleichen stellt die theoretischen Grundlagen dar. Die empirischen Untersuchungen präsentieren die Ergebnisse der Studien. Die Diskussion fasst die Ergebnisse zusammen und diskutiert ihre Bedeutung.
Wie wird Facebook in der Arbeit betrachtet?
Facebook wird als Plattform betrachtet, die durch die Fülle an Informationen über das Leben anderer Nutzer ein ideales Umfeld für soziale Vergleiche bietet. Die Arbeit untersucht, wie diese Vergleiche das Wohlbefinden der Nutzer beeinflussen.
Welche negativen Auswirkungen werden untersucht?
Die Arbeit analysiert negative Auswirkungen sozialer Vergleiche auf Facebook auf die Stimmung und das Selbstwertgefühl der Nutzer. Mögliche Erklärungen für diese negativen Effekte werden ebenfalls diskutiert.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Vergleiche auf Facebook. Warum Soziale Medien für schlechtere Stimmung sorgen können, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/387537