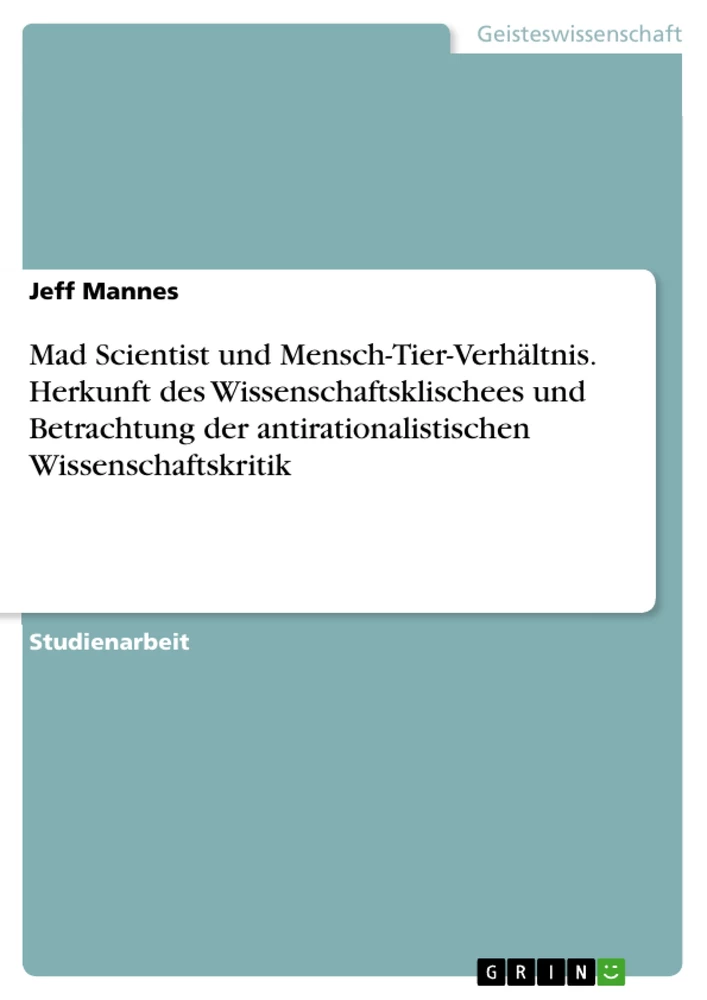Spätestens seit Goethes Faust werden Wissenschaftler in westlichen Medien, sei es Literatur, Serie oder Film, oftmals sehr klischeehaft dargestellt. Sie zeichnen sich durch einen Verfall zur triebhaften, ungesunden und vernunftlosen Suche nach verbotenem oder zuviel Wissen aus, das sehr oft zur Katastrophe führt. Dr. Frankenstein, Dr. Strangelove oder Dr. Jekyll sind nur einige Beispiele hierfür.
Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung der Herkunft dieses Bildes. Als Basis dienen dabei zwei Herangehensweisen: Die eine ist die Annahme, dass dieses Klischee seinen Ursprung in Konflikten zwischen Religion und Wissenschaft hat, und dass die moderne Wissenschaft die alten, religiösen Grenzen der Wissensaneignung zu gefährden droht. Der „mad scientist“ wäre also eine religiös motivierte Warnung vor einer vermeintlich zu starker Wissensaneignung als Reaktion auf schwankende religiös-gesellschaftliche Macht. Die andere Herangehensweise ist die Annahme, dass der „mad scientist“ seinen Ursprung in der Dualismen-Bildung und des „Othering“, der Veranderung, hat.
Konkret geht es dabei um den gesellschaftlichen Aufbau von Eigen- und Fremdgruppe, mit dem Ziel der Abwertung des Fremden und der gleichzeitigen Aufwertung des Eigenen. Wir werden sehen, dass dieses Phänomen weitreichende Wurzeln in der westlichen Ideengeschichte hat und auf den beiden Urdualismen Mensch-Tier, sowie Kultur-Natur beruht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Über die Herkunft des mad scientist
- 2. Der mad scientist als Resultat einer antirationalistischen Wissenschaftskritik
- 3. Der mad scientist als Resultat des Mensch-Tier-Verhältnis
- 3.1. „Das Tier“ im wissenschaftlichen Diskurs
- 3.2. Tierdefinitionen: Der Aufbau vom Dualismus
- 3.3. Menschen und nichtmenschliche Tiere in der westlichen Ideengeschichte
- 3.4. Benutzung der Tiermetapher zur Etikettierung von Menschengruppen
- 3.5. Mad scientist und der Mensch-Tier-Dualismus
- 4. Synthese: Eine ganzheitliche Sicht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Herkunft des Klischees vom „mad scientist“ in westlichen Medien. Es werden zwei Hauptansätze verfolgt: Erstens, die These, dass das Klischee aus Konflikten zwischen Religion und Wissenschaft resultiert, wobei der „mad scientist“ eine Warnung vor zu großer Wissensaneignung darstellt. Zweitens, die These, dass das Klischee auf dem gesellschaftlichen Aufbau von Eigen- und Fremdgruppe und der damit verbundenen Abwertung des „Anderen“ basiert, mit Wurzeln im Mensch-Tier- und Kultur-Natur-Dualismus.
- Die Entstehung des „mad scientist“-Klischees in Literatur und Film
- Der Konflikt zwischen Religion und Wissenschaft als Ursprung des Klischees
- Der Einfluss des Mensch-Tier-Dualismus auf die Konstruktion des Klischees
- Die Rolle des „Othering“ und der Abwertung des Fremden
- Eine ganzheitliche Betrachtung des Klischees
Zusammenfassung der Kapitel
1. Über die Herkunft des mad scientist: Dieses Kapitel führt in das Thema ein und stellt die zwei zentralen Forschungsansätze vor: den Konflikt zwischen Religion und Wissenschaft und den Einfluss des „Othering“ und des Dualismus. Es werden bekannte Beispiele des „mad scientist“-Klischees genannt und die Forschungsziele der Arbeit umrissen. Die Arbeit betont die Komplexität des Themas und den Anspruch auf eine ganzheitliche Betrachtungsweise.
2. Der mad scientist als Resultat einer antirationalistischen Wissenschaftskritik: Dieses Kapitel untersucht den „mad scientist“ als Produkt einer antirationalistischen Wissenschaftskritik, die in einem tief verwurzelten Konflikt zwischen Religion und Wissenschaft wurzelt. Es wird argumentiert, dass die Wissenschaft, indem sie religiöse Dogmen herausforderte (z.B. die Erschaffung von Leben), als Bedrohung für etablierte Machtstrukturen wahrgenommen wurde. Der „mad scientist“ fungiert als Metapher für diese Kritik und verkörpert die Angst vor dem Missbrauch wissenschaftlicher Erkenntnisse. Beispiele wie Dr. Frankenstein veranschaulichen die Überschreitung religiöser Grenzen und die damit verbundenen Konsequenzen.
3. Der mad scientist als Resultat des Mensch-Tier-Verhältnis: Dieses Kapitel erforscht den Zusammenhang zwischen dem „mad scientist“-Klischee und dem Mensch-Tier-Dualismus. Es analysiert die Darstellung von Tieren im wissenschaftlichen Diskurs, verschiedene Tierdefinitionen und den historischen Kontext des Mensch-Tier-Verhältnisses in der westlichen Ideengeschichte. Der Fokus liegt auf der Benutzung von Tiermetaphern zur Abwertung bestimmter Menschengruppen und wie dieser Mechanismus zum Verständnis des „mad scientist“ beiträgt. Das Kapitel untersucht, wie der Dualismus zur Konstruktion des „mad scientist“ und seiner negativen Konnotation beiträgt.
4. Synthese: Eine ganzheitliche Sicht: (Dieses Kapitel wird nicht zusammengefasst, da es sich um den Schlussteil handelt und damit Spoilergefahr besteht.)
Schlüsselwörter
Mad scientist, Wissenschaftskritik, Antirationalismus, Mensch-Tier-Verhältnis, Dualismus, Othering, Religion, Wissenschaft, Klischee, Stereotyp, westliche Ideengeschichte, Tiermetapher.
Häufig gestellte Fragen (FAQ): Die Herkunft des "Mad Scientist" Klischees
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Ursprünge des Klischees vom „verrückten Wissenschaftler“ („mad scientist“) in westlichen Medien. Sie analysiert die Entstehung dieses Stereotyps und beleuchtet die dahinterliegenden gesellschaftlichen und ideologischen Faktoren.
Welche Hauptansätze werden verfolgt?
Die Arbeit verfolgt zwei zentrale Forschungsansätze: Erstens, die These, dass das Klischee aus Konflikten zwischen Religion und Wissenschaft resultiert, wobei der „mad scientist“ eine Warnung vor zu großer Wissensaneignung darstellt. Zweitens, die These, dass das Klischee auf dem gesellschaftlichen Aufbau von Eigen- und Fremdgruppe und der damit verbundenen Abwertung des „Anderen“ basiert, mit Wurzeln im Mensch-Tier- und Kultur-Natur-Dualismus.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 führt in das Thema ein und stellt die Forschungsansätze vor. Kapitel 2 untersucht den „mad scientist“ als Produkt einer antirationalistischen Wissenschaftskritik im Kontext des Konflikts zwischen Religion und Wissenschaft. Kapitel 3 erforscht den Zusammenhang zwischen dem Klischee und dem Mensch-Tier-Dualismus. Kapitel 4 bietet eine Synthese der Ergebnisse.
Wie wird der "mad scientist" im Kontext des Religion-Wissenschaft-Konflikts dargestellt?
Kapitel 2 argumentiert, dass der „mad scientist“ als Metapher für die Angst vor dem Missbrauch wissenschaftlicher Erkenntnisse dient. Die Wissenschaft, die religiöse Dogmen herausforderte, wurde als Bedrohung wahrgenommen, und der „mad scientist“ verkörpert diese Angst vor der Überschreitung ethischer und religiöser Grenzen.
Welche Rolle spielt der Mensch-Tier-Dualismus?
Kapitel 3 analysiert den Einfluss des Mensch-Tier-Dualismus auf die Konstruktion des „mad scientist“-Klischees. Es untersucht die Verwendung von Tiermetaphern zur Abwertung bestimmter Menschengruppen und wie dieser Mechanismus zum Verständnis des „mad scientist“ beiträgt. Der Dualismus wird als ein wichtiger Faktor für die negative Konnotation des Klischees gesehen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Zu den Schlüsselwörtern gehören: Mad scientist, Wissenschaftskritik, Antirationalismus, Mensch-Tier-Verhältnis, Dualismus, Othering, Religion, Wissenschaft, Klischee, Stereotyp, westliche Ideengeschichte, Tiermetapher.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der Ursprünge des „mad scientist“-Klischees zu liefern und die komplexen Faktoren zu analysieren, die zu seiner Entstehung und Persistenz beigetragen haben. Sie strebt nach einer ganzheitlichen Betrachtungsweise.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält Zusammenfassungen der Kapitel 1, 2 und 3. Kapitel 4 (Synthese) wird nicht zusammengefasst, um Spoiler zu vermeiden.
- Quote paper
- Jeff Mannes (Author), 2012, Mad Scientist und Mensch-Tier-Verhältnis. Herkunft des Wissenschaftsklischees und Betrachtung der antirationalistischen Wissenschaftskritik, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/387088