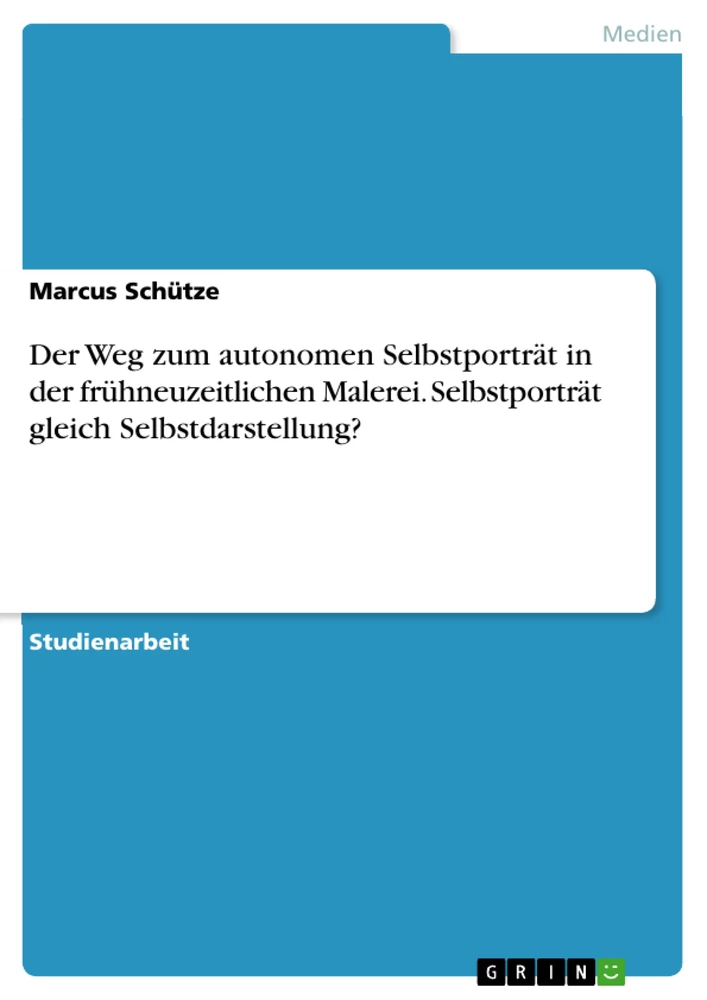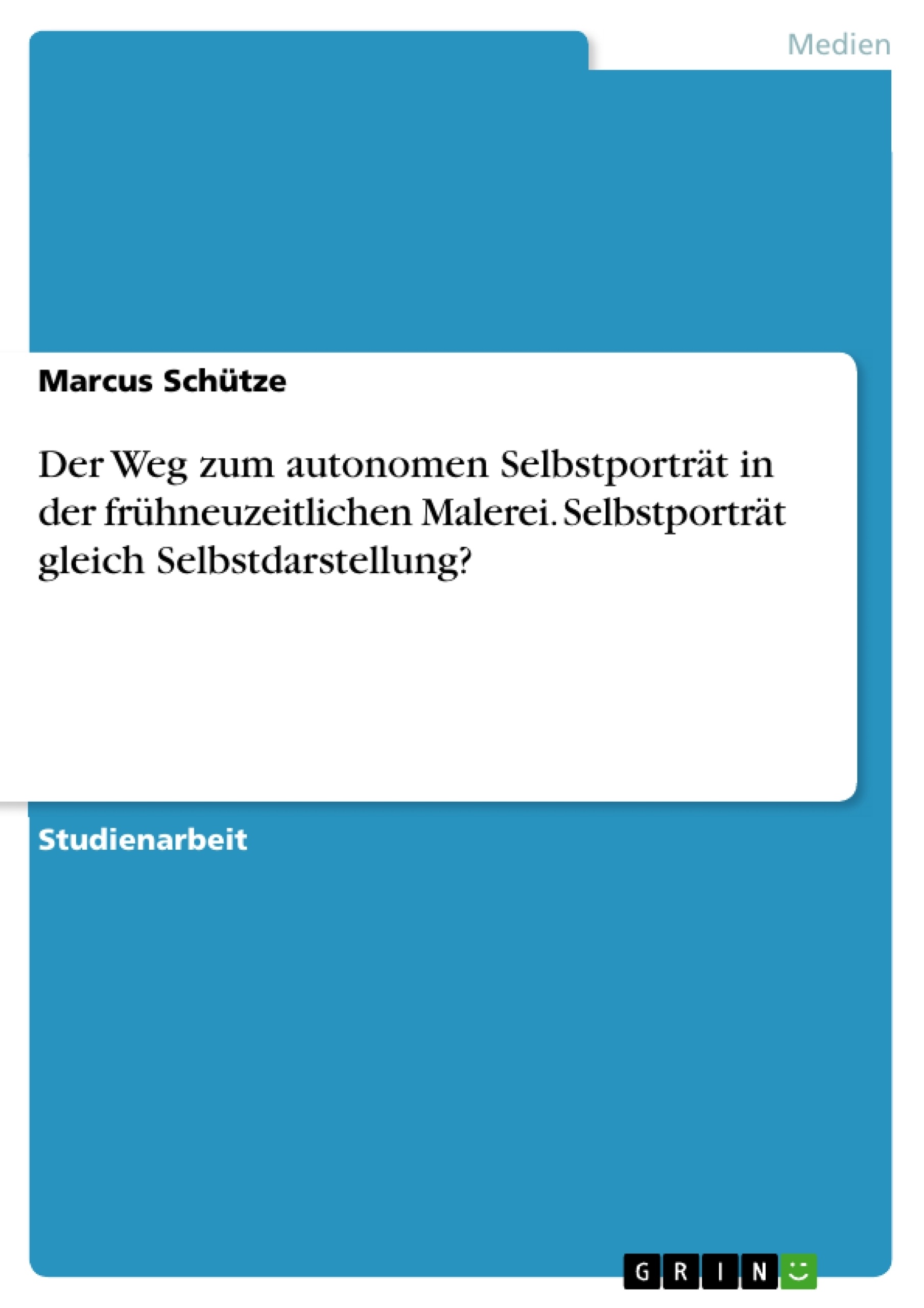In jeder aufkommenden Tendenz, nicht nur den künstlerischen, liegt eine ihr eigens motivierte Bestrebung zugrunde, die sie Souveränität erlangen lassen soll. Das Erreichen dieser Etappe im Prozess des Werdens markiert einen Status der Autonomie, unabhängig von ihrer erhaltenden Dauer. Mit der Renaissance begab sich die Malerei aus den Kirchen in die Paläste, öffentlichen Hallen und Museen, dem Handwerk wurde eine neue Auffassung — eine neues Denken zuteil und das Selbstporträt entwirft die Philosophie des Malers. Doch wie dienlich ist die Verbindung von Philosophie und Kunst um noch von Autonomie zu sprechen? Welchen Platz nimmt das schaffende Individuum in dieser Synthese ein, wenn es doch nur wieder Restriktionen erliegt.
Es ist die Absicht dieser Arbeit herauszustellen, unter welchen Bedingungen sich ein autonomes Selbstporträt bildete. Welche instinktiven und willentlichen Versuche gemacht wurden und welche Schwierigkeiten sich dem entgegenstellten. Dafür soll ein überschaubarer Bilderkatalog genutzt werden der sich über einen Zeitraum von der Spätrenaissance bis in den Realismus des 19. Jahrhunderts erstreckt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Mehr als nur ein Anflug von Selbstbewusstsein
- Ein zurückhaltendes Selbstbewusstsein
- Ein wahres Selbstbewusstsein
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung des autonomen Selbstporträts in der frühneuzeitlichen Malerei. Sie analysiert die Bedingungen, unter denen sich ein solches Selbstporträt bildete, die Versuche der Künstler und die damit verbundenen Schwierigkeiten. Der Fokus liegt auf der Entwicklung vom indirekten, assistenzbildartigen Selbstporträt hin zu einem Ausdruck von individueller Selbstfindung.
- Die Entwicklung des Selbstporträts von der Spät-Renaissance bis zum Realismus.
- Der Einfluss von Philosophie und Kunst auf die Auffassung des Selbstporträts.
- Die Rolle von Selbstbeobachtung, Selbstreflexion und dem Ausdruck des psychischen Zustands.
- Die Bedeutung der Individualisierung im Selbstporträt.
- Die Unterscheidung zwischen autonomen und nicht-autonomen Selbstporträts.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des autonomen Selbstporträts ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Bedingungen seiner Entstehung. Sie beleuchtet den Wandel der Malerei von der Antike bis zur Aufklärung, den Einfluss des Denkens der Mimesis und die Herausforderungen des individuellen künstlerischen Ausdrucks. Das Selbstporträt wird als ein Akt des "In-Szene-Setzens" beschrieben, der Selbstbeobachtung, Selbstbefragung und die Offenlegung psychischer Zustände beinhaltet. Die Arbeit skizziert ihr Ziel: die Untersuchung der Entstehung des autonomen Selbstporträts anhand eines ausgewählten Bilderkatalogs von der Spät-Renaissance bis zum Realismus.
Mehr als nur ein Anflug von Selbstbewusstsein: Dieses Kapitel beginnt mit der Unterscheidung zwischen autonomen und nicht-autonomen Selbstporträts anhand der Thesen von Gottfried Boehm. Es betont die Indirektheit des Prozesses der Selbstporträtmalerei, die Herausforderungen, die sich dem Künstler durch den Zwang zur Selbstbetrachtung und -interpretation stellen. Der Spiegel wird als Hilfsmittel genannt, aber auch seine Grenzen im Bezug auf die vollständige Wiedergabe der "singulären Erfahrung des Sich-Betrachtens" werden herausgestellt. Der Autor argumentiert, dass eine reine Abbildung des Äußeren nicht genügt, sondern die Individualisierung des Dargestellten im Vordergrund steht. Assistenzbilder und Fremdporträts werden als nicht autonom eingestuft.
Schlüsselwörter
Selbstporträt, Frühneuzeitliche Malerei, Autonomie, Selbstbewusstsein, Individualisierung, Indirektheit, Selbstreflexion, Spät-Renaissance, Realismus, Gottfried Boehm, Mimesis.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Autonomes Selbstporträt in der frühneuzeitlichen Malerei
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text befasst sich mit der Entstehung des autonomen Selbstporträts in der frühneuzeitlichen Malerei. Er analysiert die Bedingungen, unter denen sich ein solches Selbstporträt bildete, die Versuche der Künstler und die damit verbundenen Schwierigkeiten. Der Fokus liegt auf der Entwicklung vom indirekten, assistenzbildartigen Selbstporträt hin zu einem Ausdruck von individueller Selbstfindung.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Die zentralen Themen sind die Entwicklung des Selbstporträts von der Spät-Renaissance bis zum Realismus, der Einfluss von Philosophie und Kunst auf die Auffassung des Selbstporträts, die Rolle von Selbstbeobachtung und Selbstreflexion, die Bedeutung der Individualisierung im Selbstporträt und die Unterscheidung zwischen autonomen und nicht-autonomen Selbstporträts.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es in ihnen?
Der Text beinhaltet eine Einleitung, die die Thematik einführt und die Forschungsfrage formuliert. Das Kapitel "Mehr als nur ein Anflug von Selbstbewusstsein" unterscheidet zwischen autonomen und nicht-autonomen Selbstporträts und analysiert die Herausforderungen der Selbstporträtmalerei. Weitere Kapitel behandeln den Weg zum wahren Selbstbewusstsein im Selbstporträt (genaue Titel sind im Inhaltsverzeichnis ersichtlich).
Welche Rolle spielt Gottfried Boehm in diesem Text?
Die Thesen von Gottfried Boehm dienen als Grundlage für die Unterscheidung zwischen autonomen und nicht-autonomen Selbstporträts. Seine Überlegungen zur Indirektheit des Prozesses der Selbstporträtmalerei und den Herausforderungen der Selbstbetrachtung werden ausführlich diskutiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis des Textes wichtig?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Selbstporträt, Frühneuzeitliche Malerei, Autonomie, Selbstbewusstsein, Individualisierung, Indirektheit, Selbstreflexion, Spät-Renaissance, Realismus, Gottfried Boehm und Mimesis.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt des Textes?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Unter welchen Bedingungen entstand das autonome Selbstporträt in der frühneuzeitlichen Malerei?
Wie wird das autonome Selbstporträt im Text definiert?
Der Text definiert das autonome Selbstporträt im Gegensatz zum nicht-autonomen Selbstporträt (z.B. Assistenzbilder). Es zeichnet sich durch eine Individualisierung des Dargestellten aus, die über die reine Abbildung des Äußeren hinausgeht und Selbstbeobachtung, Selbstreflexion und den Ausdruck des psychischen Zustands beinhaltet.
- Quote paper
- Marcus Schütze (Author), 2014, Der Weg zum autonomen Selbstporträt in der frühneuzeitlichen Malerei. Selbstporträt gleich Selbstdarstellung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/385618