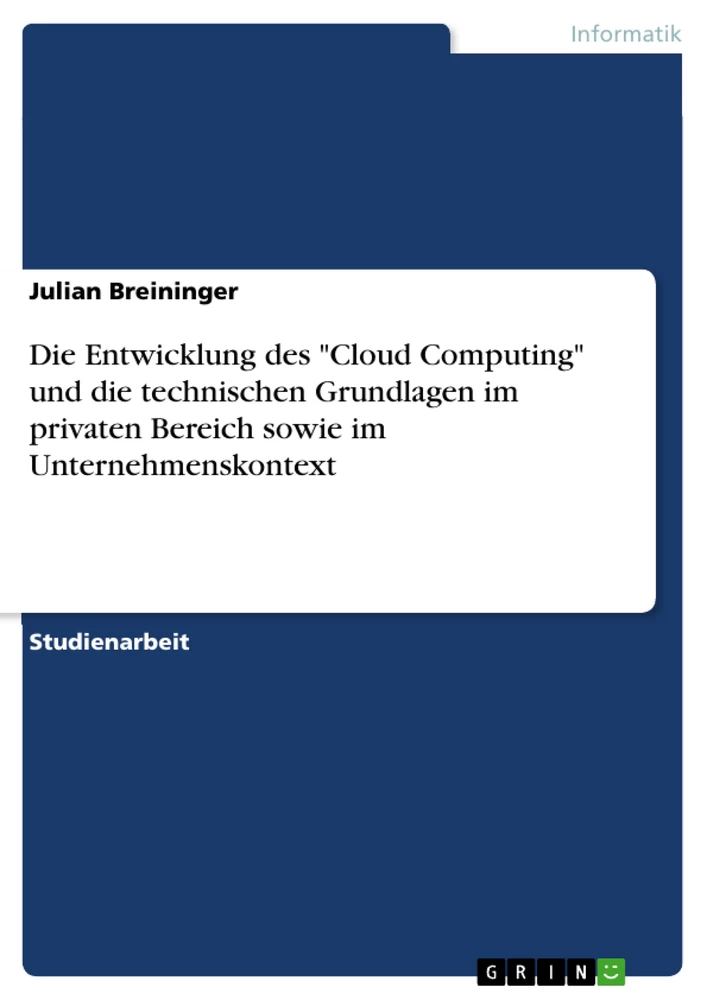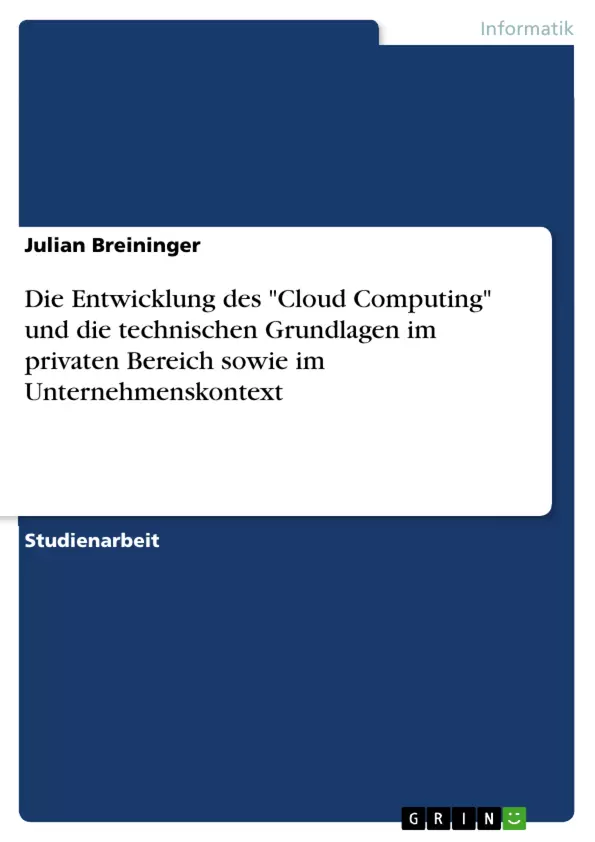Cloud Computing stellt einen momentanen Trend in der IT-Branche dar. Der Begriff Cloud Computing bezeichnet die Verlagerung von Speicherplatz, Rechenkapazität oder Softwareanwendungen in die sogenannte Cloud. Hier stehen Rechnersysteme bereit auf die jederzeit ortsunabhängig zugegriffen werden kann. Daher kommt auch der Name "Cloud" (Wolke), der die Charakteristika der Cloud, als örtlich nicht fixiertes Medium deutlich macht.
Im privaten Bereich hat sich die Cloud schon längst durchgesetzt. Auslagerung von Dokumenten, Bildern und Videos in die Wolke wird von vielen Anwendern bereits vorgenommen. Ein Beispiel hierfür ist z.B. der Anbieter Dropbox. Dieser ermöglicht oben genannte Fähigkeiten und bietet zudem die Möglichkeit, seine Dateien mit Freunden und Bekannten zu teilen. Ein weiteres Beispiel des Nutzens von Cloud-Computing-Konzepten im
Alltag bieten die sog. VoD-Anbieter. Als Beispiel sind hier Netflix und Amazon Instant Video zu nennen.
Diese bieten ihren Kunden den Zugriff auf eine umfassende Palette von Filmen und Serien, die über die Internetverbindung von großen Rechnernetzwerken geliefert wird. Auch im Unternehmensbereich sind mittlerweile verschiedene Cloudkonzepte zu finden. So ist es möglich komplette Programme auf externe Server auszulagern. Mit Azure4 bietet beispielsweise Microsoft eine Möglichkeit das unternehmenseigene ERP-System vollständig auszulagern. Aktuell nutzen etwa 44% der Unternehmen Cloudlösungen, was einen Anstieg von 4% im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.
Wie sich an den genannten Beispielen erkennen lässt wird Cloud Computing sowohl im privaten Bereich, als auch im Unternehmensumfeld bereits genutzt und die Nutzerzahlen steigen stetig an. Das Ziel der Studienarbeit ist es einen Überblick über die Entwicklungen und die technologischen Grundlagen in diesem Bereich zu verschaffen. Außerdem werden die Vorteile, die durch Nutzung dieser Technik entstehen erörtert. Neben positiven Aspekten sollten die Gefahren, die diese Technologie mit sich bringt nicht unterschätzt und eine kritische Betrachtung durchgeführt werden. Abschließend soll eine Bewertung über den Einsatz von Cloudservices sowohl im privaten Bereich, als auch im Unternehmenskontext vorgenommen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition
- Servicemodelle
- IaaS Infrastructure as a Service
- PaaS Platform as a Service
- SaaS Software as a Service
- Bereitstellungsmodelle
- Private Cloud
- Public Cloud
- Community Cloud
- Hybrid Cloud
- Charakteristiken
- Entwicklung
- Internet und Internettechnologien
- Fortschritte in der Informationstechnik
- Industrialisierung in der Informationstechnik
- Verhalten der Nutzer
- Risiken
- Datensicherheit und Datenschutz
- Abhängigkeit vom Anbieter
- Internetverbindung
- Angriffsszenarien
- Chancen
- Ortsunabhängiger Zugriff
- Flexibilität und hohe Skalierbarkeit
- Kostenvorteile
- Schutz vor Angriffen
- Geringerer Wartungsbedarf
- Geringere Softwarekosten
- Plattformunabhängigkeit
- Hohe Rechenleistung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Studienarbeit befasst sich mit dem Phänomen Cloud Computing. Ziel ist es, einen Überblick über die Entwicklungen und technologischen Grundlagen in diesem Bereich zu liefern, die Vorteile der Nutzung dieser Technik zu erörtern sowie die damit verbundenen Risiken kritisch zu betrachten. Abschließend soll eine Bewertung des Einsatzes von Cloud-Diensten im privaten Bereich sowie im Unternehmenskontext erfolgen.
- Definition und Entwicklung von Cloud Computing
- Servicemodelle und Bereitstellungsmodelle
- Vorteile und Risiken der Cloud-Nutzung
- Einsatz von Cloud-Diensten im privaten und im Unternehmenskontext
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Cloud Computing ein und erläutert die aktuelle Relevanz des Themas in der IT-Branche. Es werden Beispiele für die Anwendung von Cloud-Diensten sowohl im privaten als auch im Unternehmensbereich gegeben, und die Zielsetzung der Studienarbeit wird klar formuliert.
- Definition: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit verschiedenen Definitionen von Cloud Computing und analysiert die Bedeutung des Begriffs. Es werden die drei Servicemodelle (IaaS, PaaS, SaaS) sowie die vier Bereitstellungsmodelle (Private Cloud, Public Cloud, Community Cloud, Hybrid Cloud) erläutert.
- Entwicklung: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung von Cloud Computing und beleuchtet die dahinterstehenden treibenden Kräfte. Es geht auf die Rolle des Internets und der Internettechnologien ein, beschreibt Fortschritte in der Informationstechnik und die Industrialisierung in diesem Bereich sowie die Veränderungen im Nutzerverhalten.
- Risiken: Hier werden die potentiellen Risiken der Cloud-Nutzung beleuchtet. Themen wie Datensicherheit und Datenschutz, Abhängigkeit vom Anbieter, Internetverbindung sowie Angriffsszenarien werden aufgezeigt.
- Chancen: Dieses Kapitel befasst sich mit den Vorteilen und Chancen der Cloud-Nutzung. Themen wie ortsunabhängiger Zugriff, Flexibilität und Skalierbarkeit, Kostenvorteile, Schutz vor Angriffen, geringerer Wartungsbedarf, geringere Softwarekosten, Plattformunabhängigkeit und hohe Rechenleistung werden beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themenfelder der vorliegenden Studienarbeit sind Cloud Computing, Servicemodelle (IaaS, PaaS, SaaS), Bereitstellungsmodelle (Private Cloud, Public Cloud, Community Cloud, Hybrid Cloud), Datensicherheit, Datenschutz, Internetverbindung, Angriffsszenarien, ortsunabhängiger Zugriff, Flexibilität, Skalierbarkeit, Kostenvorteile und Rechenleistung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Cloud Computing?
Cloud Computing bezeichnet die Verlagerung von IT-Ressourcen wie Speicherplatz, Rechenkapazität oder Software auf externe Server, auf die jederzeit ortsunabhängig über das Internet zugegriffen werden kann.
Was sind die drei wichtigsten Servicemodelle der Cloud?
Man unterscheidet IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) und SaaS (Software as a Service).
Welche Bereitstellungsmodelle gibt es?
Es gibt die Private Cloud (exklusiv für ein Unternehmen), die Public Cloud (für die Öffentlichkeit), die Community Cloud (für spezifische Gruppen) und die Hybrid Cloud (Mischform).
Welche Vorteile bietet Cloud Computing für Unternehmen?
Zu den Chancen zählen hohe Skalierbarkeit, Kostenvorteile durch geringere Hardware-Investitionen, ortsunabhängiger Zugriff und eine hohe Rechenleistung.
Welche Risiken sind mit der Cloud-Nutzung verbunden?
Zentrale Risiken sind der Datenschutz, die Datensicherheit, die Abhängigkeit von einer stabilen Internetverbindung sowie die Gefahr eines "Vendor Lock-in" (Abhängigkeit vom Anbieter).
Wie verbreitet ist Cloud Computing in der Wirtschaft?
Der Trend ist steigend; laut der Untersuchung nutzen bereits etwa 44 % der Unternehmen Cloud-Lösungen.
- Quote paper
- Julian Breininger (Author), 2016, Die Entwicklung des "Cloud Computing" und die technischen Grundlagen im privaten Bereich sowie im Unternehmenskontext, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/384576