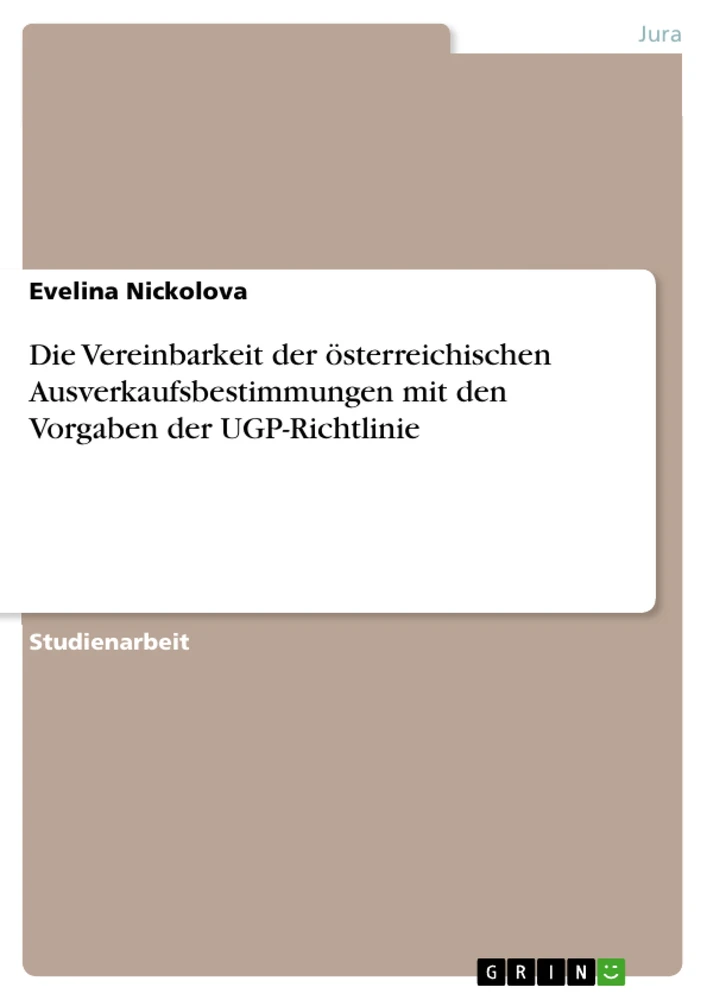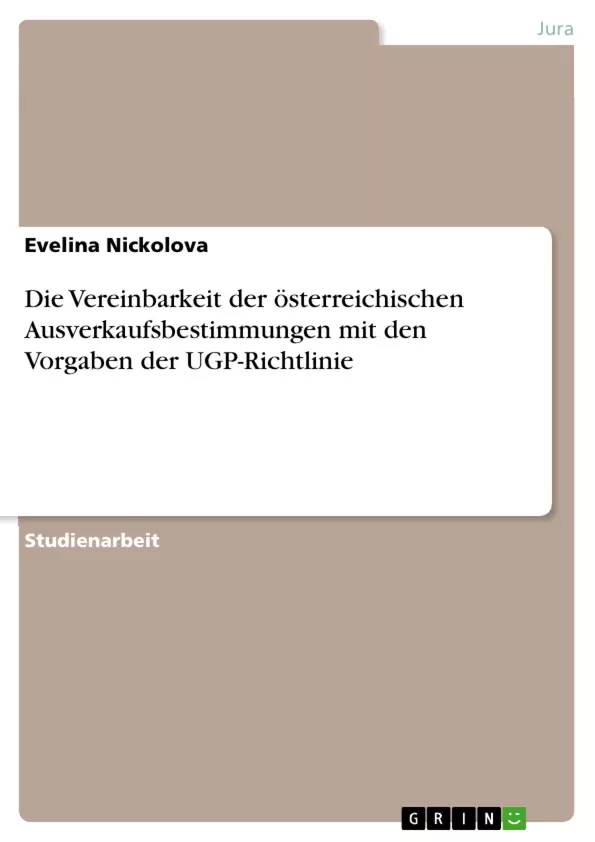Das Problem der Schutzbedürftigkeit der am Leistungsaustausch beteiligten Personen findet seine Wurzeln bereits in der griechischen und römischen Mythologie, wo die Götter Hermes und Merkur die damaligen Kaufleute schutzten, wie die GA Trstenjak einführend in ihren Schlussanträgen anmerkt. Schwerpunkt der gegenständlichen Untersuchung ist jedoch nicht die Auslegung von göttlichen Gesetzen, sondern die Vereinbarung der österreichischen Ausverkaufsbestimmungen des UWG mit der vom Unionsgesetzgeber erlassenen UGP-RL.
Es ist dabei bemerkenswert, dass die verwaltungsrechtlichen Bestimmungen des UWG fast 30 Jahre älter als dieses Bundesgesetz selbst sind. Jetzt stehen sie aber kurz vor ihrem Ende, da EuGH nach einer Vorlagefrage vom österreichischen Höchstgericht ihre mangelnde Konformität mit der UGP-RL erkannt hat. Nach dem also § 9a UWG schon für totes Recht erklärt wurde , würden bald auch die § 33a ff UWG das selbe Schicksal teilen. Durch seine Rechtsprechung „erschießt“ also der EuGH eine nach der anderen die innerstaatlichen österreichischen Bestimmungen, insbesondere im Bereich des Wettbewerbrechts.
Das bestätigt weiterhin nun die Lehrmeinungen, dass beim Erlass der UGP-RL den Mitgliedstaaten nicht völlig klar gewesen sein dürfte, was für einen erheblichen Einfluss die ausgewählte Regelungsstruktur in Verbindung mit der als Liberalisierungsansatz auszulegende Vollharmonisierung auf ihr jeweiliges nationales Recht haben würde.
Inhaltsverzeichnis
- I. Themeneinführung und Problemstellung
- II. Sachverhalt und Ausgangslage
- III. Anwendbarkeit der UGP-RL
- 1. Sachlicher Anwendungsbereich
- 2. Persönlicher Anwendungsbereich
- 3. Ausnahmetatbestand
- IV. Verfahrensrechtliche Problematik
- 1. Überprüfungskompetenz nationaler Verwaltungsbehörden
- 2. Zulässigkeit zur Vornahme einer ex-ante-Prüfung
- 3. Vereinbarkeit eines strafbewehrtes gesetzlichen Verbots mit Erlaubnisvorbehalt mit der UGP-RL
- 4. Zulässigkeit bzw. Notwendigkeit einer gerichtlichen Kontrolle behördlicher Entscheidungen
- 5. Die Pflicht zur Vornahme einer lauterkreisrechtlichen Einzelfallsbeurteilung
- 6. Zwischenergebnis
- V. Materiell-rechtliche Problematik
- 1. Vereinbarung der Regelungsstrukturen beider Regelungswerke
- 2. Verpflichtung zur Angabe von Gründen
- 2.1. Anknüpfungspunkte mit Z 15
- 2.2. Anknüpfungspunkte mit Z 7
- 2.3. Anknüpfungspunkte mit Z 4
- 3. Bewilligungslos vorgenommene Ausverkaufsankündigung als aggressive, irreführende oder sonst unlautere Geschäftspraktik
- 3.1. Aggressive Geschäftspraktik iSv § 1a UWG ?
- 3.2. Irreführende Geschäftspraktik iSv § 2 UWG ?
- 3.3. Sonst unlautere Geschäftspraktik ?
- VI. Exkurs: Verfassungsrechtliche Bedenken
- VII. Weitere Entwicklung nach dem Köck-Urteil des EuGH
- Die OGH - Entscheidung 4 Ob 15/13d
- Die VwGH-Entscheidung 2011/04/0045
- UWG-Novelle 2013
- VIII. Ökonomische Analyse von §§ 33a ff UWG
- IX. Vergleich mit Deutschland
- X. Zusammenfassung
- XI. Persönlicher Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Vereinbarkeit österreichischer Ausverkaufsbestimmungen im UWG mit der UGP-RL. Dabei steht die Frage im Zentrum, ob die UGP-RL eine strikte Anwendung des österreichischen § 33a ff UWG im Hinblick auf die Bewilligungspflicht für Ausverkäufe zulässt oder ob die UGP-RL eine stärkere Berücksichtigung von Verbraucherinteressen erfordert.
- Harmonisierung von nationalem Recht und EU-Recht
- Auslegung der UGP-RL und deren Anwendbarkeit
- Schutz von Verbrauchern und Wettbewerb
- Verfahrensrechtliche Problematik und Kompetenzverteilung
- Materiell-rechtliche Analyse der Ausverkaufsbestimmungen im UWG
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Problematik des Verbraucherschutzes und der Vereinbarkeit von nationalem Recht mit EU-Recht. Dabei wird die Bedeutung der UGP-RL für die Harmonisierung von Wettbewerbsrecht in Europa hervorgehoben. In Kapitel II wird der Sachverhalt des Köck-Falls dargestellt, der die Vorlagefrage an den EuGH ausgelöst hat. Kapitel III untersucht die Anwendbarkeit der UGP-RL im vorliegenden Fall, wobei der sachliche und der persönliche Anwendungsbereich der Richtlinie sowie mögliche Ausnahmetatbestände analysiert werden. Kapitel IV befasst sich mit verfahrensrechtlichen Aspekten der Streitfrage, insbesondere mit der Kompetenzverteilung zwischen nationalen Verwaltungsbehörden und Gerichten sowie der Frage der Einzelfallprüfung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Verbraucherschutz, Wettbewerbsrecht, UGP-RL, § 33a ff UWG, Ausverkaufsbestimmungen, Harmonisierung, EU-Recht, nationaler Recht, Verfahren, Kompetenzverteilung, Einzelfallprüfung.
- Quote paper
- Evelina Nickolova (Author), 2013, Die Vereinbarkeit der österreichischen Ausverkaufsbestimmungen mit den Vorgaben der UGP-Richtlinie, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/384567