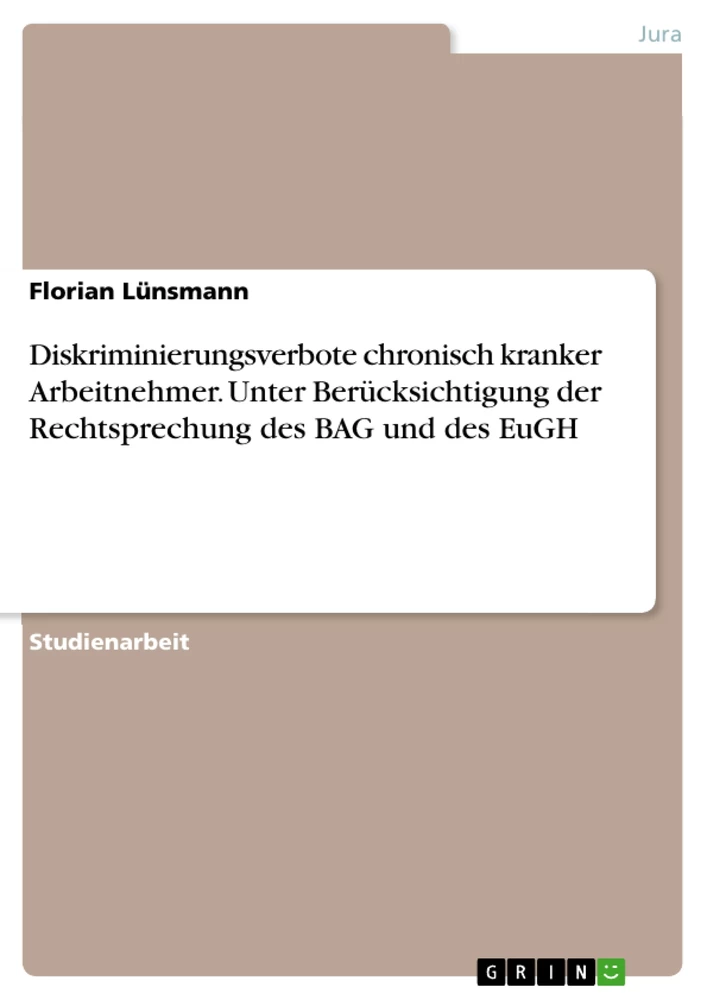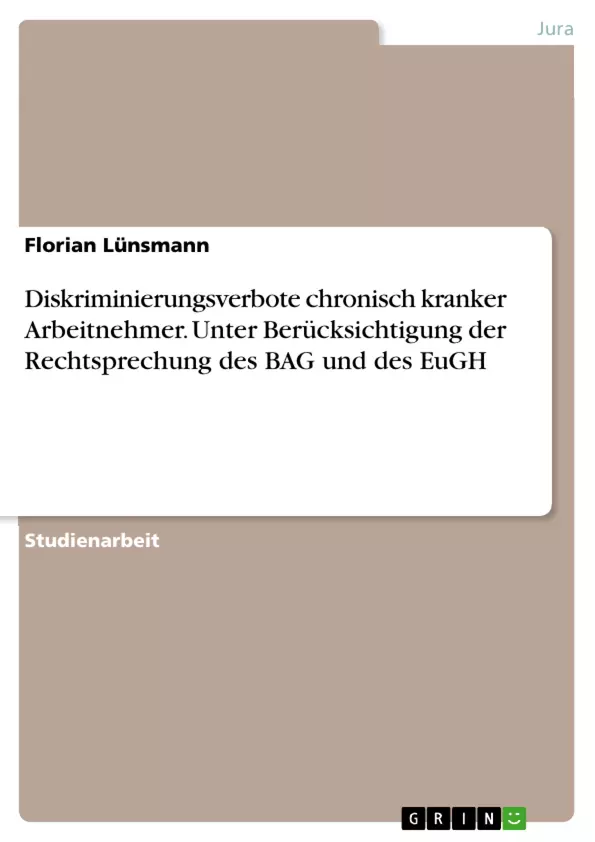Mit dieser Arbeit soll herausgearbeitet werden, unter welchen Voraussetzungen chronische Erkrankung unter das auslegungsbedürftige Merkmal der Behinderung fallen und somit die betroffenen Arbeitnehmer durch das für Deutschland geltende Antidiskriminierungsrecht geschützt sind. Dafür werden aus dem Völkerrecht die UNO-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), das Unionsrechts, und auf nationaler Ebene das AGG unter Berücksichtigung der Rechtsprechungen des EuGH und des BAG untersucht.
Laut einer Studie des Robert Koch-Instituts haben rund 40 % der deutschen Bevölkerung nach eigenen Angaben eine oder mehrere chronische Erkrankungen. Am 07.06.2013 wurde ein Antrag der Fraktion „DIE LINKE“, einen Diskriminierungsschutz für chronisch erkrankte Menschen ins Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) aufzunehmen, abgelehnt. Zurzeit liegt den Ausschüssen des deutschen Bundestags ein Gesetzesentwurf ähnlich lautenden Inhalts vor.
Bisher enthalten weder die europäischen noch die nationalen Vorschriften ausdrückliche Diskriminierungsverbote zugunsten chronischer Krankheiten. Die Rechtsprechung des EuGH und des BAG hat aber deutlich gemacht, dass die betroffenen Personen unter Umständen unter den arbeitsrechtlichen Schutz der Behinderung fallen. Die betroffenen Arbeitnehmer können somit, wenn sie als behindert gelten, bereits von den bisher geltenden Diskriminierungsverboten nutznießen. Was bedeutet das für Arbeitnehmer, die beispielsweise an Diabetes, Asthma, Rheuma, Depressionen, Neurodermitis oder Alkoholsucht erkrankt sind?
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Begriff der ,,chronischen Krankheit“
- C. Diskriminierungen aufgrund chronischer Krankheit
- D. Rechtsgrundlagen für einen Diskriminierungsschutz für chronisch erkrankte Arbeitnehmer
- I. UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK)
- II. Unionsrecht
- E. Auslegung des Merkmals „Behinderung“
- I. Unionsrechtlicher Behinderungsbegriff
- II. Nationaler Behinderungsbegriff
- 1. Vergleich der Behinderungsbegriffe des SGB IX und der UN-BRK
- 2. Auslegung des Behinderungsbegriffs durch das BAG
- III. Vergleich der Behinderungsbegriffe des EuGH und des BAG
- F. Beispielhafte chronische Erkrankungen und ihr Verhältnis zum Behinderungsbegriff
- I. Aids/HIV-Infektion
- II. Adipositas
- III. Drogensucht/Alkoholismus
- IV. Diabetes mellitus
- XIII. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, die rechtlichen Voraussetzungen für den Schutz chronisch kranker Arbeitnehmer vor Diskriminierung im Arbeitsleben herauszuarbeiten. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, unter welchen Bedingungen chronische Erkrankungen unter den Begriff der Behinderung fallen und somit Schutz durch das deutsche Antidiskriminierungsrecht gewährleistet ist.
- Diskriminierungsverbote für chronisch kranke Arbeitnehmer
- Rechtliche Rahmenbedingungen im Völkerrecht, Unionsrecht und nationalem Recht
- Auslegung des Behinderungsbegriffs durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) und das Bundesarbeitsgericht (BAG)
- Beispiele chronischer Erkrankungen und deren Verhältnis zum Behinderungsbegriff
- Rechtliche und gesellschaftliche Herausforderungen im Kontext chronischer Erkrankungen
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung
Die Einleitung führt in die Problematik der Diskriminierung chronisch kranker Arbeitnehmer im Arbeitsleben ein. Sie beleuchtet die hohe Prävalenz chronischer Krankheiten in Deutschland und die fehlenden expliziten Diskriminierungsverbote für diese Personengruppe im geltenden Recht. Des Weiteren werden die rechtlichen Grundlagen des Diskriminierungsschutzes für Menschen mit Behinderungen dargestellt und die Zielsetzung der Arbeit erläutert.
B. Begriff der „chronischen Krankheit“
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Begriff der „chronischen Krankheit“ und deren Definition im Kontext des Antidiskriminierungsrechts. Es werden verschiedene Kriterien für die Einordnung einer Krankheit als chronisch erläutert und die Bedeutung für die Anwendung des Diskriminierungsschutzes hervorgehoben.
C. Diskriminierungen aufgrund chronischer Krankheit
Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Formen der Diskriminierung im Arbeitsleben, die chronisch kranke Menschen erfahren können. Es werden Beispiele für Benachteiligungen in verschiedenen Phasen des Arbeitsverhältnisses (z.B. Bewerbung, Einstellung, Entlassung) genannt und die Ursachen für diese Diskriminierungen analysiert.
D. Rechtsgrundlagen für einen Diskriminierungsschutz für chronisch erkrankte Arbeitnehmer
Dieses Kapitel analysiert die relevanten Rechtsgrundlagen für den Diskriminierungsschutz chronisch kranker Arbeitnehmer. Hierbei wird auf die UN-Behindertenrechtskonvention und das Unionsrecht eingegangen und deren Bedeutung für die Thematik aufgezeigt.
E. Auslegung des Merkmals „Behinderung“
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Auslegung des Merkmals „Behinderung“ im Kontext des Diskriminierungsschutzes. Es werden die unionsrechtlichen und nationalen Behinderungsbegriffe analysiert und verglichen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Auslegung durch das BAG und dem EuGH.
F. Beispielhafte chronische Erkrankungen und ihr Verhältnis zum Behinderungsbegriff
Dieses Kapitel beleuchtet beispielhafte chronische Erkrankungen und analysiert deren Verhältnis zum Behinderungsbegriff. Dabei werden verschiedene Krankheitsbilder betrachtet und die Frage untersucht, ob und unter welchen Voraussetzungen diese als Behinderung gelten können.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema Diskriminierungsschutz für chronisch kranke Arbeitnehmer, wobei die zentralen Begriffe "chronische Krankheit", "Behinderung", "Antidiskriminierungsrecht", "UN-Behindertenrechtskonvention", "Unionsrecht", "AGG", "EuGH" und "BAG" im Mittelpunkt stehen. Die Arbeit analysiert die Rechtsprechung des EuGH und des BAG im Zusammenhang mit der Auslegung des Behinderungsbegriffs und untersucht die Auswirkungen auf den Schutz chronisch kranker Arbeitnehmer vor Diskriminierung im Arbeitsleben.
- Quote paper
- Florian Lünsmann (Author), 2015, Diskriminierungsverbote chronisch kranker Arbeitnehmer. Unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des BAG und des EuGH, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/383234