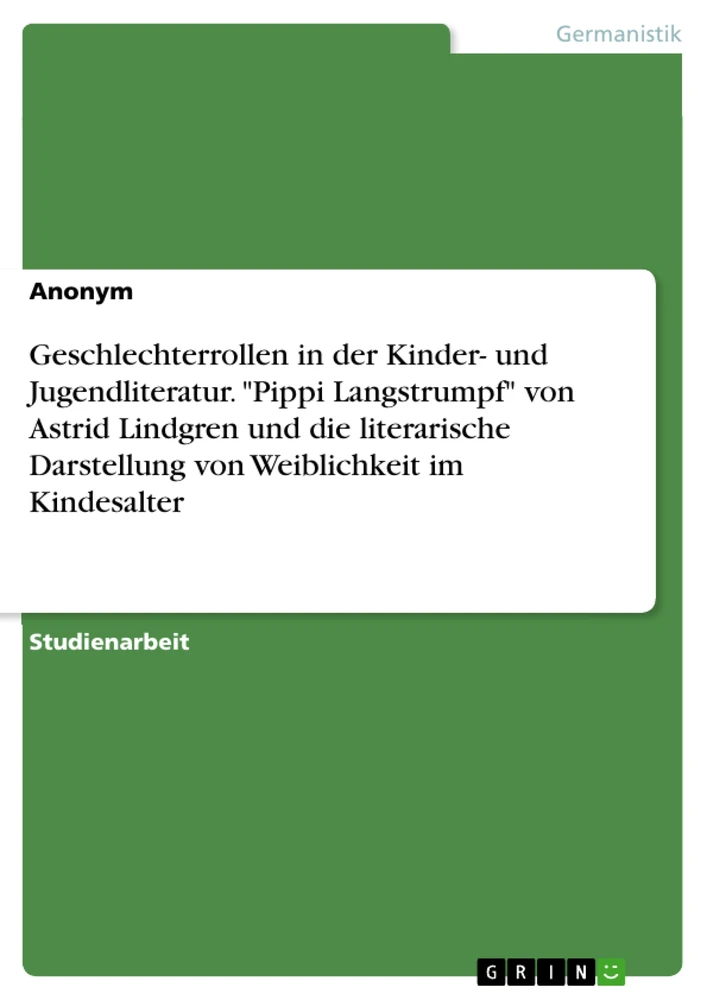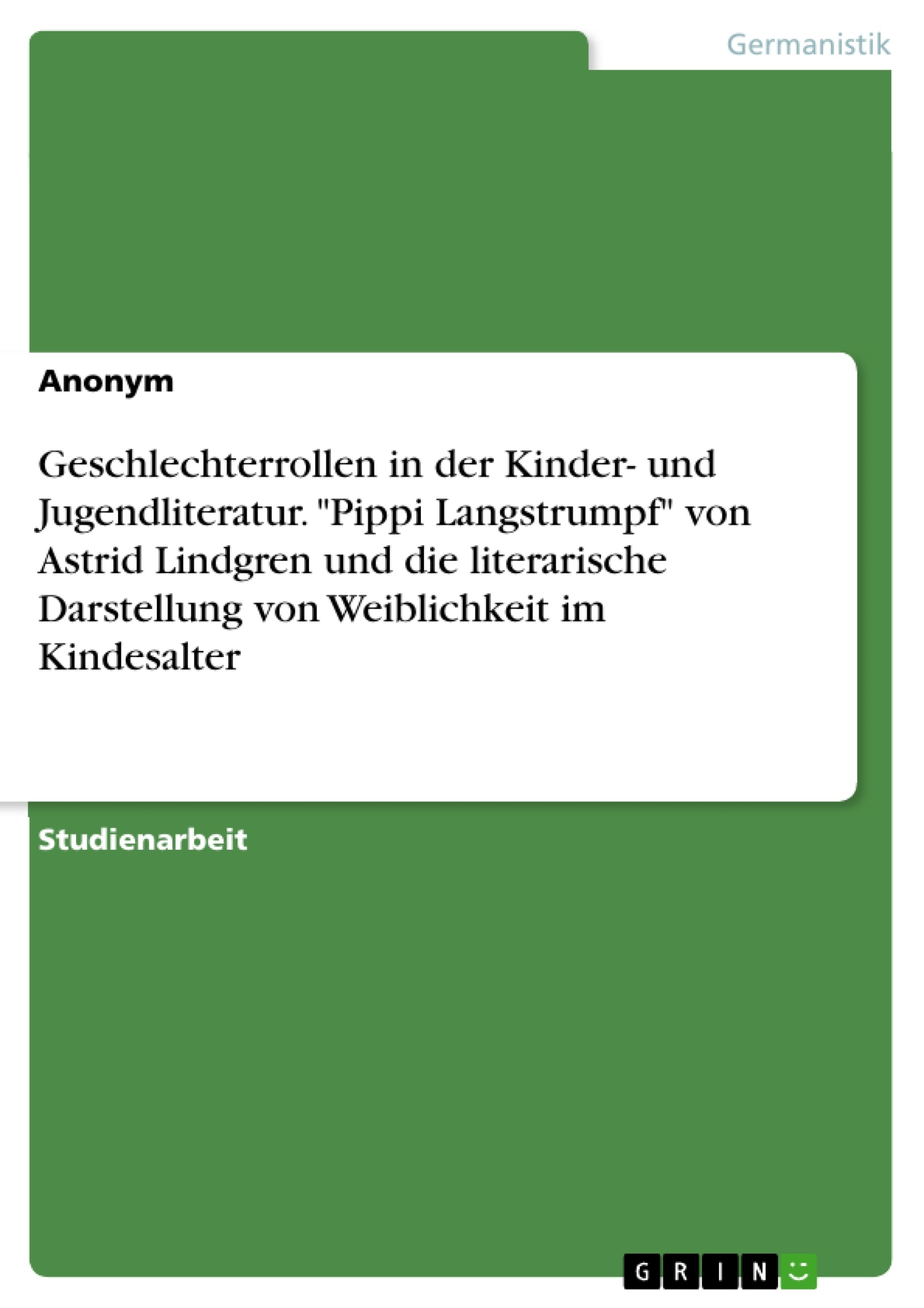Wer erinnert sich nicht, wenn auch vage und verblasst, an die berühmte und preisgekrönte Kindheitslektüre Astrid Lindgrens? Was meistens in Erinnerung geblieben ist, ist das starke, eigensinnige Mädchen, das sich in der Erwachsenenwelt zu behaupten weiß und diese Welt voller Normen und Regeln auf den Kopf stellt. Die Rede ist von Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminza Efraimstochter Langstrumpf, dem stärksten Mädchen der Welt.
Doch was macht diese extraordinäre Kinderfigur von Astrid Lindgren neben ihren physischen Kräften so besonders, wenn man bedenkt, dass ihre Mutter gestorben ist, ihr Vater selten Zuhause ist und sie sich elementar von anderen Kindern ihres Alters unterscheidet? Das Mädchen ist die Protagonistin der Trilogie "Pippi Langstrumpf", "Pippi Langstrumpf geht an Bord" und "Pippi in Taka-Tuka-Land", die trotz riskanter Abenteuer widerstandsfähige Eigenschaften aufweist und so den entwicklungsgefährdenden Lebenslagen trotzt.
Anhand von Textbeispielen wird die Problematik der Lektüre beleuchtet. Es wird aber auch aufgezeigt, wie sich Astrid Lindgren nicht nur als Autorin, sondern auch als Person des öffentlichen Lebens engagiert hat und wie die Standpunkte, die in ihrem eigenen Leben eine Rolle gespielt haben, in ihren Büchern konsequent vertreten werden. Ein Fokus liegt auf der literarischen Darstellung von Weiblichkeit und Kindern, deren Verhaltensweisen und deren Umgang mit anderen untersucht werden, die nicht dem stereotypen Frauenbild entsprechen.
Zu Beginn befinden sich ein Lebenslauf Lindgrens und die zeitgeschichtliche Einordnung der Bücher, die einen Überblick über die Entstehungsgeschichte und Hintergründe der Pippi-Trilogie geben sollen. Um die Charakterisierung und Gegenüberstellung von Pippi und Annika zu veranschaulichen, wird Bezug zu den Büchern genommen. Nach einer Darstellung der wichtigsten Eigenschaften von Pippi und Annika, folgt ein Vergleich der von ihnen repräsentierten Frauenbilder, um dann auf die Problematik der Trilogie einzugehen. Das Fazit fasst kritisch die wichtigsten Aspekte zusammen und beinhaltet einen Ausblick bezüglich der Thematik der Geschlechterrollen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Astrid Lindgren
- 3. Zeitgeschichtliche Einordnung
- 4. Charakterisierungen
- 4.1 Pippi Langstrumpf
- 4.2 Annika
- 4.3 Vergleich der repräsentierten Frauenbilder
- 5. Problematik in „Pippi Langstrumpf“
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die literarische Darstellung von Weiblichkeit im Kindesalter am Beispiel von Astrid Lindgrens „Pippi Langstrumpf“. Ziel ist es, die Figur Pippi Langstrumpf im Kontext von Astrid Lindgrens Leben und der zeitgeschichtlichen Einordnung zu analysieren und die Problematik der Darstellung von Geschlechterrollen zu beleuchten.
- Astrid Lindgrens Biografie und deren Einfluss auf ihr Werk
- Die zeitgeschichtliche Einordnung der Pippi-Trilogie
- Charakterisierung von Pippi Langstrumpf und Annika
- Vergleich der von Pippi und Annika repräsentierten Frauenbilder
- Problematik der Geschlechterrollen in „Pippi Langstrumpf“
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Hauptfrage nach der Besonderheit der Figur Pippi Langstrumpf. Sie kündigt die methodische Vorgehensweise an, die die Analyse der Pippi-Trilogie anhand von Textbeispielen beinhaltet, und verbindet diese Analyse mit Astrid Lindgrens Engagement im öffentlichen Leben. Der Fokus liegt auf der Darstellung von Weiblichkeit und Kindern, die sich von stereotypen Frauenbildern abheben. Die Arbeit verspricht eine Auseinandersetzung mit Verhaltensweisen, die Konflikte austragen, Durchsetzungsvermögen zeigen und eigene Interessen verfolgen.
2. Astrid Lindgren: Dieses Kapitel skizziert den Lebenslauf Astrid Lindgrens, beginnend mit ihrer Kindheit auf einem Pfarrbauernhof in Schweden, geprägt von ländlicher Arbeitsmoral und einem gesellschaftlichen Umfeld, das von strengen Normen und der Kirche beeinflusst war. Es wird hervorgehoben, wie Lindgren frühzeitig gegen die ihr zugeschriebenen Geschlechterrollen rebellierte, ihren unverheirateten Status und ihre Schwangerschaft nicht verheimlichte und beruflich ihren Weg in einer für Frauen damals ungewöhnlichen Weise ging. Die Entstehung der Pippi Langstrumpf-Geschichten wird im Zusammenhang mit ihrer Tochter Karin und einer Erkrankung beschrieben. Der Abschnitt betont Lindgrens kritische Auseinandersetzung mit den Erziehungsmethoden ihrer Zeit und ihr humanistisches Engagement für die "Majestät des Kindes".
3. Zeitgeschichtliche Einordnung: (Leider ist dieser Kapitelzusammenfassung basierend auf dem gegebenen Text nicht möglich. Der gegebene Text enthält keine Informationen zu diesem Kapitel.)
4. Charakterisierungen: Dieses Kapitel analysiert die Charaktere Pippi Langstrumpf und Annika, um die von ihnen repräsentierten Frauenbilder zu vergleichen. Es wird erwartet, dass dieses Kapitel die jeweils spezifischen Eigenschaften der beiden Figuren detailliert beschreibt und diese dann im Hinblick auf ihre Übereinstimmungen und Unterschiede hinsichtlich der Darstellung von Weiblichkeit kontrastiert. Der Vergleich soll Aufschluss darüber geben, wie Lindgren unterschiedliche weibliche Rollenbilder in ihrem Werk präsentiert.
5. Problematik in „Pippi Langstrumpf“: (Leider ist dieser Kapitelzusammenfassung basierend auf dem gegebenen Text nicht möglich. Der gegebene Text enthält keine Informationen zu diesem Kapitel.)
Schlüsselwörter
Pippi Langstrumpf, Astrid Lindgren, Geschlechterrollen, Weiblichkeit, Kinderliteratur, Frauenbilder, Zeitgeschichte, Charakterisierung, Problematik, Erziehung, Autorität, Schweden.
Häufig gestellte Fragen zu "Pippi Langstrumpf": Eine Analyse der Weiblichkeitsdarstellung
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert die literarische Darstellung von Weiblichkeit im Kindesalter anhand von Astrid Lindgrens "Pippi Langstrumpf". Sie untersucht Pippi Langstrumpf im Kontext von Astrid Lindgrens Leben und der zeitgeschichtlichen Einordnung, um die Problematik der Darstellung von Geschlechterrollen zu beleuchten. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zu Astrid Lindgren, der zeitgeschichtlichen Einordnung, Charakterisierungen von Pippi und Annika, einer Auseinandersetzung mit der Problematik in "Pippi Langstrumpf" und einem Fazit. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der von Pippi und Annika repräsentierten Frauenbilder.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Astrid Lindgrens Biografie und deren Einfluss auf ihr Werk; die zeitgeschichtliche Einordnung der Pippi-Trilogie; Charakterisierung von Pippi Langstrumpf und Annika; Vergleich der von Pippi und Annika repräsentierten Frauenbilder; und die Problematik der Geschlechterrollen in "Pippi Langstrumpf". Es wird untersucht, wie Lindgren unterschiedliche weibliche Rollenbilder in ihrem Werk präsentiert und wie sich Pippi von stereotypen Frauenbildern abhebt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Eine Einleitung, ein Kapitel über Astrid Lindgren, ein Kapitel zur zeitgeschichtlichen Einordnung, ein Kapitel mit Charakterisierungen von Pippi Langstrumpf und Annika (inklusive Vergleich der Frauenbilder), ein Kapitel zur Problematik in "Pippi Langstrumpf" und ein Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind ebenfalls enthalten.
Was wird in Kapitel 2 über Astrid Lindgren behandelt?
Kapitel 2 skizziert Astrid Lindgrens Lebenslauf, ihre Kindheit auf einem schwedischen Bauernhof, ihre Rebellion gegen gesellschaftliche Geschlechterrollen, ihren unverheirateten Status und ihre Schwangerschaft, ihren beruflichen Werdegang und die Entstehung der Pippi Langstrumpf-Geschichten im Zusammenhang mit ihrer Tochter und einer Erkrankung. Es wird Lindgrens kritische Auseinandersetzung mit den Erziehungsmethoden ihrer Zeit und ihr humanistisches Engagement für Kinder hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die Schlüsselwörter der Arbeit sind: Pippi Langstrumpf, Astrid Lindgren, Geschlechterrollen, Weiblichkeit, Kinderliteratur, Frauenbilder, Zeitgeschichte, Charakterisierung, Problematik, Erziehung, Autorität, Schweden.
Welche Methode wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit analysiert die Pippi-Trilogie anhand von Textbeispielen und verbindet diese Analyse mit Astrid Lindgrens Engagement im öffentlichen Leben. Der Fokus liegt auf der Darstellung von Weiblichkeit und Kindern, die sich von stereotypen Frauenbildern abheben. Die Arbeit untersucht Verhaltensweisen, die Konflikte austragen, Durchsetzungsvermögen zeigen und eigene Interessen verfolgen.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Figur Pippi Langstrumpf im Kontext von Astrid Lindgrens Leben und der zeitgeschichtlichen Einordnung zu analysieren und die Problematik der Darstellung von Geschlechterrollen zu beleuchten. Es geht darum, die Besonderheit der Figur Pippi Langstrumpf zu untersuchen und die von ihr und Annika repräsentierten Frauenbilder zu vergleichen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2017, Geschlechterrollen in der Kinder- und Jugendliteratur. "Pippi Langstrumpf" von Astrid Lindgren und die literarische Darstellung von Weiblichkeit im Kindesalter, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/380627