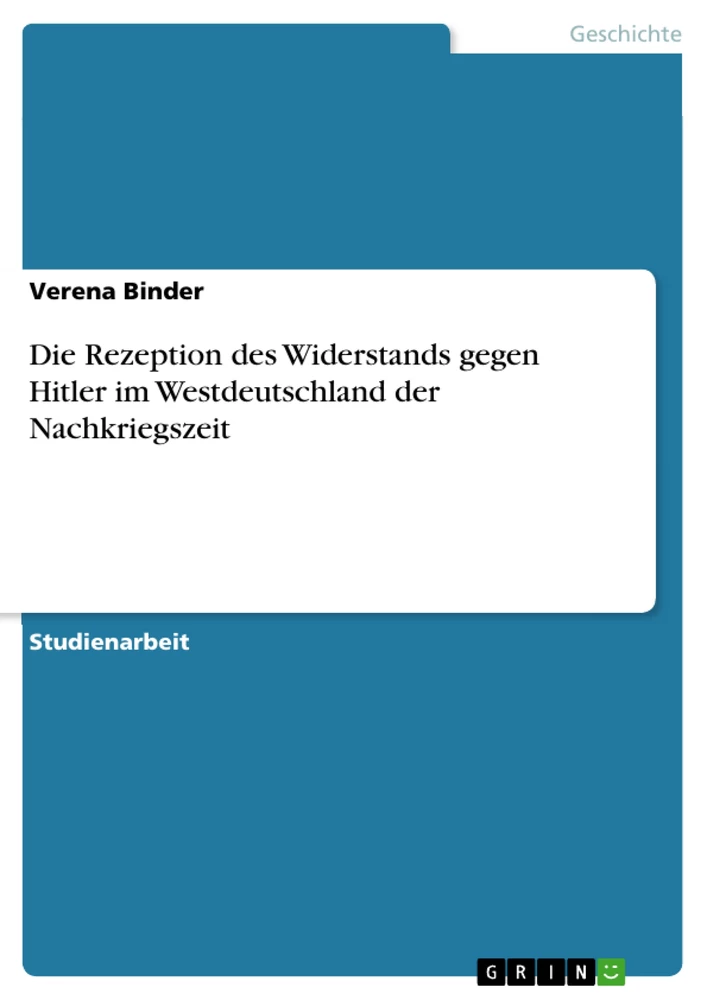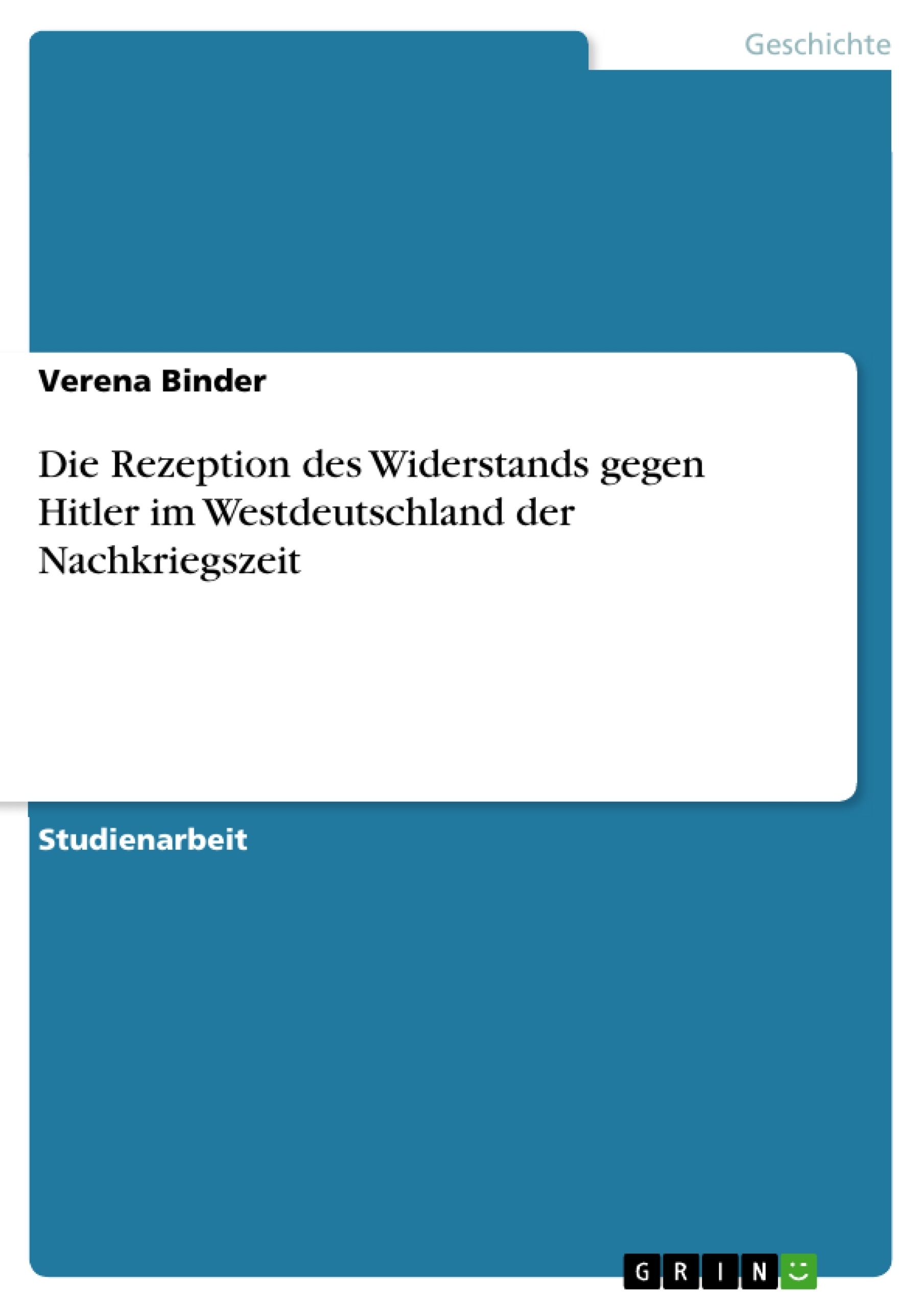Das Ziel der vorliegenden Arbeit soll die Beantwortung der Frage sein: Wie wurde der Widerstand gegen Adolf Hitler in der frühen Nachkriegszeit rezipiert, als die Gegenwart von Kriegszerstörungen, dem politischen Umbruch auf dem Weg zur Demokratie und dem verbleibenden Einfluss des Nationalsozialismus geprägt war?
Die Arbeit beschränkt sich auf die Rezeption in der Bundesrepublik beziehungsweise in den entsprechenden Besatzungszonen. Die Erinnerung an den Widerstand in der DDR bleibt ebenso außen vor wie Ansichten des Auslands. Der zeitliche Rahmen „frühe Nachkriegszeit“ meint die Vierzigerjahre ab der Kapitulation Deutschlands im zweiten Weltkrieg und die kompletten Fünfzigerjahre.
Diese Arbeit befasst sich zunächst mit der Rezeption des Widerstands gegen Hitler im Allgemeinen und behandelt im Anschluss die Erinnerung an das Attentat vom 20. Juli 1944 und an die Studentengruppe Weiße Rose. Diese beiden Formen des Widerstands wurden deshalb ausgewählt, weil sie sich während der Recherche als diejenigen herausgestellt haben, die in der frühen Nachkriegszeit am breitesten rezipiert wurden. Das jeweils erste Unterkapitel stellt die Rezeption in der Politik dar. Die restlichen drei Unterkapitel beinhalten die Darstellung des Widerstandes in verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens, zum Beispiel in Büchern, Zeitschriften und im Schulunterricht.
Für den Teil dieser Arbeit, der sich mit der Erinnerung an den 20. Juli 1944 befasst, ist "Das ungeliebte Erbe. Ein Vergleich der zivilen und militärischen Rezeption des 20. Juli 1944 im Westdeutschland der Nachkriegszeit" von Tobias Baur der wichtigste Literaturtitel. Für das Kapitel über die Rezeption der Weißen Rose ist Simone Königs Buch "Die Gedenkveranstaltungen zur Erinnerung an den Widerstand der Weißen Rose an der Ludwig-Maximilian-Universität München von 1945-1968" besonders relevant.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Rezeption des Widerstands gegen Hitler im Westdeutschland der Vierziger- und Fünfzigerjahre
- Die Rezeption des Widerstands im Allgemeinen
- In der Politik
- In Gesetzgebung und Rechtsprechung
- In geschichtswissenschaftlicher und populärer Literatur
- Im Schulunterricht
- Die Rezeption des Attentats vom 20. Juli 1944
- In der Politik
- In der öffentlichen Meinung und auf Gedenkveranstaltungen
- In den Medien
- In Büchern
- Die Rezeption der Widerstandsgruppe Weiße Rose
- In der Politik
- In der öffentlichen Meinung und auf Gedenkveranstaltungen
- In Zeitungen
- In Büchern
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, wie der Widerstand gegen Adolf Hitler in der frühen Nachkriegszeit in Westdeutschland rezipiert wurde. Sie konzentriert sich auf die Vierziger- und Fünfzigerjahre und betrachtet dabei die Rezeption des Widerstands im Allgemeinen, die Erinnerung an das Attentat vom 20. Juli 1944 und die Studentengruppe Weiße Rose.
- Die Selektivität der Rezeption des Widerstands im Kontext der politischen und gesellschaftlichen Umbrüche der Nachkriegszeit
- Die Rolle des Widerstands in der Legitimierung der Bundesrepublik Deutschland als demokratische Nation
- Die Etablierung eines kollektiven Gedächtnisses des Widerstands und dessen Bedeutung für die Vergangenheitsbewältigung
- Die Unterschiede in der Rezeption verschiedener Formen des Widerstands, wie z.B. militärischer Widerstand, ziviler Widerstand und Studentenbewegung
- Die Beeinflussung der Rezeption durch die politische Situation, insbesondere den Kalten Krieg und die Auseinandersetzung mit dem Kommunismus
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Rezeption des Widerstands gegen Hitler im Allgemeinen, wobei die Politik, die Gesetzgebung, die geschichtswissenschaftliche und populäre Literatur sowie der Schulunterricht als zentrale Bereiche betrachtet werden. In den folgenden Kapiteln wird die Erinnerung an das Attentat vom 20. Juli 1944 und die Studentengruppe Weiße Rose beleuchtet, wobei jeweils die Rezeption in der Politik, in der öffentlichen Meinung, in den Medien und in Büchern thematisiert wird.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Widerstand gegen Hitler in Westdeutschland, der frühen Nachkriegszeit, der Rezeption des Widerstands, der politischen Kultur, der Gedenkkultur, dem 20. Juli 1944, der Weißen Rose, der Bundesrepublik Deutschland, der Vergangenheitsbewältigung und der Legitimierung der Demokratie.
- Arbeit zitieren
- Verena Binder (Autor:in), 2017, Die Rezeption des Widerstands gegen Hitler im Westdeutschland der Nachkriegszeit, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/380392