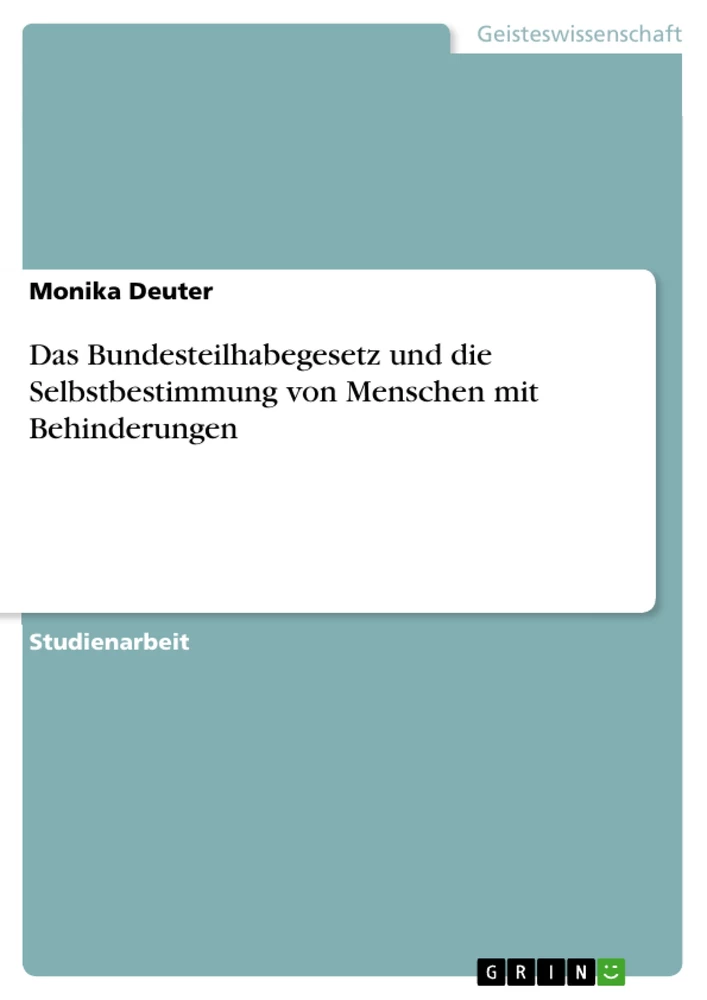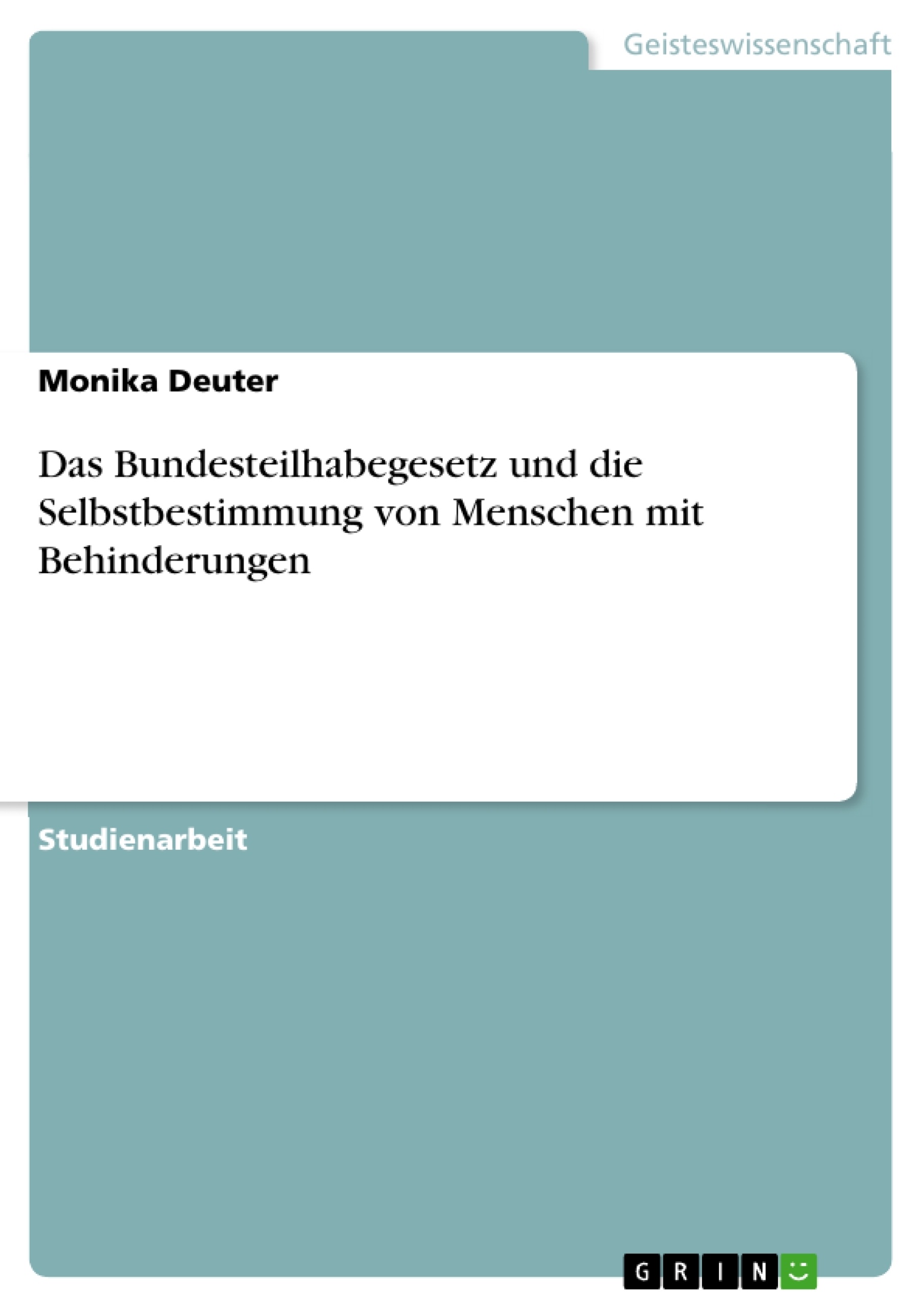„Unantastbar ist die Menschenwürde! Echte Teilhabe für uns ist ohne Hürde!“ (Protestsong von F. Beddermann - Stiftung Leben und Arbeiten)
So steht es auch im Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Menschenwürde für alle Bürger*innen der Bundesrepublik Deutschland wird als unantastbar bezeichnet (vgl. Art 1 GG - Einzelnorm 2017). Dennoch müssen in Deutschland viele Menschen mit Behinderungen mit Hürden kämpfen, die ihnen echte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erschweren. Dies betrifft einen großen Personenkreis. Laut den Angaben des Statistischen Bundesamtes von 2013 leben in Deutschland über 10 Millionen Menschen mit einer Behinderung. Im Durchschnitt hat somit jeder achte Einwohner eine Behinderung. Ca. 7,5 Millionen Menschen werden als schwerbehindert bezeichnet. Die Zahl von Menschen mit Behinderungen ist seit 2009 um 7% gestiegen.
Die UN – Behindertenrechtskonvention (UN – BRK) machte jedoch Hoffnung, dass Teilhabe ohne Hürden möglich ist. Diese wurde in Deutschland am 26. März 2009 ratifiziert und trat damit in Kraft.
Im Fokus der UN - BRK steht der Auftrag an die Gesellschaft Inklusion zu ermöglichen. Dieser Prozess soll aber nicht ohne Einbeziehung der Betroffenen stattfinden. So lautet das Motto der Konvention: „Nicht ohne uns, über uns“.
2015 wurde Deutschland, nach einer Überprüfung durch die Vereinten Nationen, stark für die unzulängliche Umsetzung der UN - BRK kritisiert. Die Bundesregierung geriet in Zugzwang eine Neugestaltung zur Förderung der Inklusion zu erarbeiten. So entstand das Bundesteilhabegesetzt (BTHG), das mit dem 01.Januar 2017 in Kraft trat.
Es sollte ein Gesetz entstehen, dass dazu beiträgt, die Rechte von Menschen mit Behinderungen umzusetzen. Das Ministerium für Arbeit und Soziales proklamiert das BTHG als: „[…] eine der großen sozialpolitischen Reformen […]. Das Gesetz schafft mehr Möglichkeiten und mehr Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderungen“ (Matthias Stockkamp 2017). Doch sieht man sich die Reaktionen von Menschen mit Behinderungen, Behindertenorganisationen und Verbänden an, ist es fraglich, ob dieses Ziel erreicht wurde. Bereits vor Inkrafttreten dieses Gesetzes gab es viele Proteste unter dem Motto: “Nicht ohne uns, über uns!“ Schlagzeilen wie „Alle sind für Selbstbestimmung – nur kosten darf es nichts." (Zeit online) oder „Willkür statt Selbstbestimmung“ (Grosch 2017) ...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff Behinderung
- Definition von Behinderung nach §2 SGB IX.
- Defintition nach der WHO
- Definition nach der UNO
- Begriffsbestimmung im BTHG
- Der Begriff Selbstbestimmung
- Die UN-Behindertenrechtskonvention als Grundlage für BTHG.
- Artikel 12
- Artikel 14
- Artikel 15
- Artikel 19
- Veränderung der bisherigen Eingliederungshilfe
- Ziele des BTHG
- Umsetzung der UN - BRK im BTHG
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert das Bundesteilhabegesetz (BTHG) im Hinblick auf die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen. Sie untersucht, inwiefern das BTHG die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) fördert und welche Auswirkungen es auf die Lebensrealität von Menschen mit Behinderungen hat.
- Definition von Behinderung und Selbstbestimmung
- Relevanz der UN-BRK für die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen
- Analyse der wichtigsten Artikel der UN-BRK im Kontext des BTHG
- Ziele und Auswirkungen des BTHG auf die Eingliederungshilfe
- Bewertung des BTHG hinsichtlich der Förderung der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Thematik der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen im Kontext des BTHG vor. Sie beleuchtet die rechtliche Grundlage der UN-BRK und zeigt die Bedeutung des Themas für die Gesellschaft auf. Die Einleitung führt außerdem die Forschungsfrage der Arbeit ein und skizziert die Vorgehensweise.
Der Begriff Behinderung
Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Definitionen des Begriffs Behinderung. Es werden die Definitionen aus dem §2 SGB IX, der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der UN-BRK betrachtet und analysiert. Der Fokus liegt auf der Frage, inwiefern die verschiedenen Definitionen den Begriff Behinderung beeinflussen und welche Auswirkungen dies auf die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen hat.
Der Begriff Selbstbestimmung
Dieser Abschnitt beleuchtet den Begriff Selbstbestimmung und dessen Bedeutung im Kontext der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Es werden verschiedene Ansätze zur Definition des Begriffs vorgestellt und die Relevanz des Selbstbestimmungsrechts für die Lebensgestaltung von Menschen mit Behinderungen herausgestellt.
Die UN-Behindertenrechtskonvention als Grundlage für BTHG
Dieses Kapitel analysiert die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) als rechtliche Grundlage für das BTHG. Es werden wichtige Artikel der UN-BRK im Kontext der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen betrachtet. Der Fokus liegt auf den Artikeln 12, 14, 15 und 19, die maßgeblich für die Umsetzung des Selbstbestimmungsrechts von Menschen mit Behinderungen sind.
Veränderung der bisherigen Eingliederungshilfe
Dieses Kapitel beschreibt die bisherige Regelung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen und beleuchtet die Entstehung des BTHG. Es werden die Ziele des BTHG dargestellt und die Umsetzung der UN-BRK im BTHG analysiert. Der Fokus liegt auf der Frage, inwiefern das BTHG die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen stärken soll und welche Auswirkungen dies auf die Praxis der Eingliederungshilfe hat.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselbegriffe dieser Arbeit sind Selbstbestimmung, Behinderung, Teilhabe, Inklusion, UN-Behindertenrechtskonvention, Bundesteilhabegesetz, Eingliederungshilfe und Lebensqualität. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung dieser Konzepte im Kontext der Lebensrealität von Menschen mit Behinderungen und analysiert die Auswirkungen des BTHG auf diese Bereiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Bundesteilhabegesetzes (BTHG)?
Das BTHG soll die Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen stärken und die Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention in deutsches Recht umsetzen.
Wie wird Behinderung im BTHG definiert?
Die Definition orientiert sich an einem modernen Verständnis, das Behinderung als Wechselwirkung zwischen individuellen Beeinträchtigungen und gesellschaftlichen Barrieren sieht.
Welche Rolle spielt die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK)?
Die UN-BRK bildet die völkerrechtliche Grundlage für das BTHG und fordert volle Inklusion sowie das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben.
Warum gibt es Kritik am BTHG von Seiten der Betroffenen?
Viele Behindertenverbände kritisieren, dass wirtschaftliche Aspekte oft vor der tatsächlichen Selbstbestimmung stehen und neue bürokratische Hürden geschaffen wurden.
Was ändert sich bei der Eingliederungshilfe durch das BTHG?
Die Eingliederungshilfe wird aus dem System der Sozialhilfe herausgelöst und soll personenzentrierter gestaltet werden, um individuelle Bedarfe besser zu decken.
- Arbeit zitieren
- Monika Deuter (Autor:in), 2017, Das Bundesteilhabegesetz und die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/379580