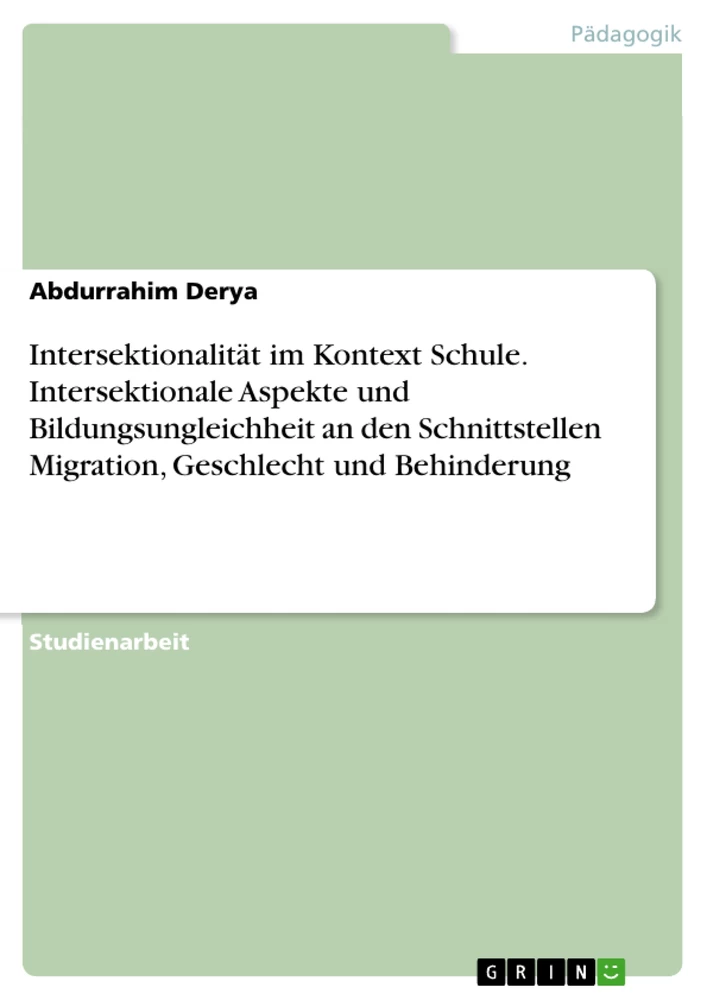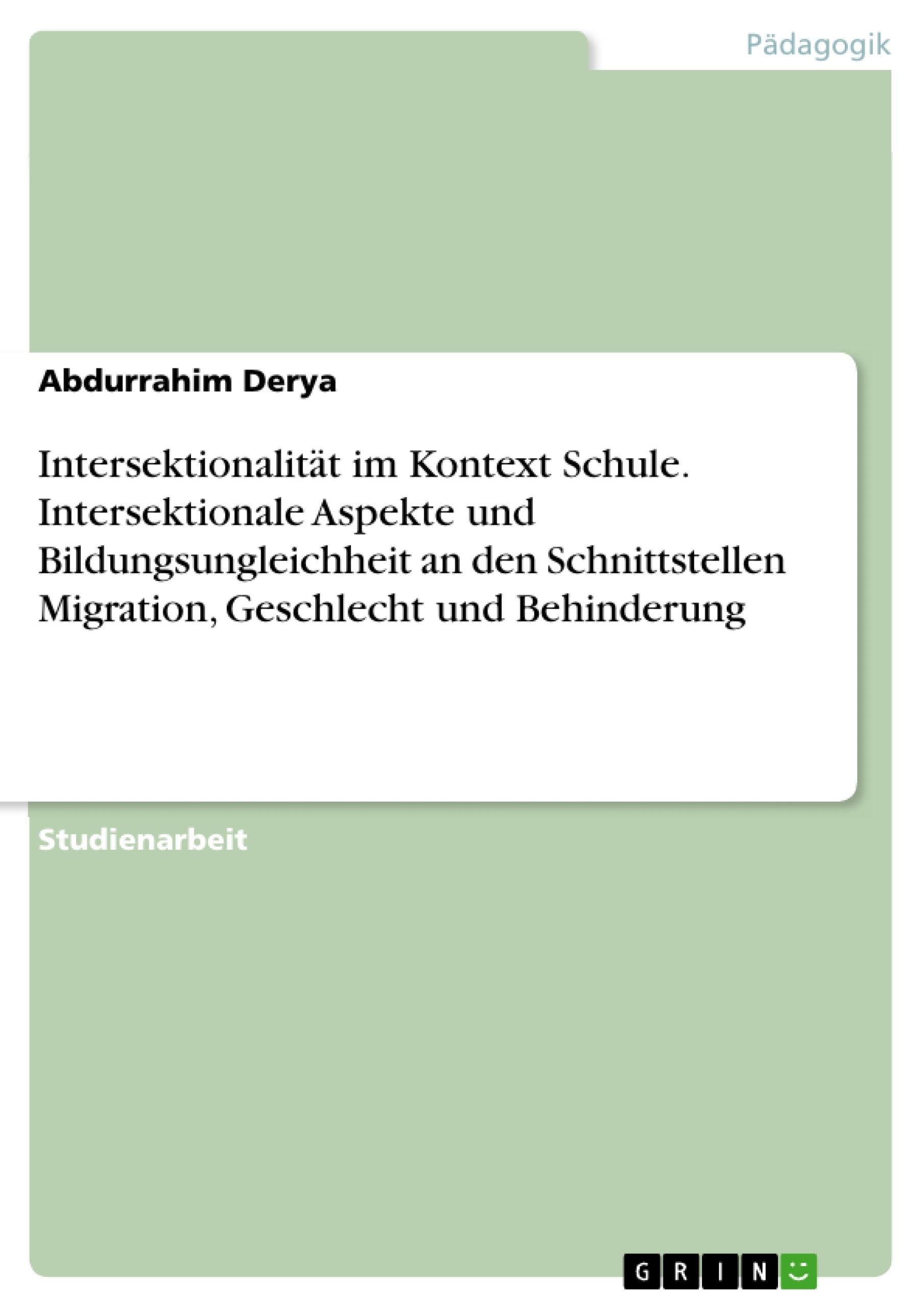Die Schule hat die Aufgabe, heranwachsende Schülerinnen sowie Schüler, um ihnen die Teilhabe sowie Chancengleichheit in der Gesellschaft zu ermöglichen, mit pädagogischen Maßnahmen und Wissensvermittlung zu sozialisieren. Sie bereitet dabei die Kinder auf das Erwachsenenleben vor. Dies erfordert eine Angleichung an die gesellschaftlichen Bedingungen und Gegebenheiten, welches zur Folge hat, dass die zu Erziehenden mit ihren Unterschiedlichkeiten einem Normalisierungsprozess unterzogenen werden müssen. Die Schule ist Erfüllungsort gesellschaftlicher Bedingungen und Erwartungen sowie Produktionsort späterer Teilnehmer für die Erwachsenenwelt. Sie muss dafür einheitliche gesellschaftszentrierte Inhalte vorlegen, in der das Versagen und der Erfolg Einzelner im gleichen Zug individualisiert wird. Die homogene Erwartungshaltung führt zur Benachteiligung und Diskriminierung einzelner Schüler. Im pädagogischen Raum wird Heterogenität zum Anspruch und Diversität zum Erschwernis.
Die vorliegende Arbeit bezieht sich auf die Schule als (Re-)Produktionsort von sozialen Ungleichheiten sowie Bildungsungleichheit. In diesem Kontext liegt der Fokus auf den aktuellen Intersektionalitätsdiskursen und auf dem Versuch die Effekte mehrdimensionaler Diskriminierungsformen anhand der Kategorien Behinderung, Geschlecht und Migration aufzuzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schule: Reproduktionsort sozialer Ungleichheiten
- Heterogenität und Vielfalt im Bildungssystem; Inklusiver Unterricht
- Intersektionalität: Schnittstellen Migration und Geschlecht/Behinderung
- Intersektionalitätsbegriff
- Migration, Behinderung und Geschlecht
- Intersektionalität im Bildungssystem
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Schule als Ort der (Re-)Produktion sozialer Ungleichheiten und Bildungsungleichheit. Im Fokus stehen aktuelle Intersektionalitätsdiskurse und deren Auswirkungen auf die Diskriminierungserfahrungen von Schülern anhand der Kategorien Behinderung, Geschlecht und Migration.
- Die Rolle der Schule als Sozialisations- und Selektionsinstanz
- Die Bedeutung von Heterogenität und Diversität im Bildungssystem
- Die Auswirkungen von Intersektionalität auf Bildungsungleichheit
- Die Bedeutung von inklusiven Unterrichtsformen
- Die Herausforderungen für die Lehrerschaft im Umgang mit Diversität
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Bildungsungleichheit ein und stellt die Schule als Reproduktionsort sozialer Ungleichheiten dar. Sie beleuchtet die Bedeutung von Heterogenität und Diversität im Bildungssystem und weist auf die Notwendigkeit einer mehrdimensionalen Betrachtung von Diskriminierung hin.
- Schule: Reproduktionsort sozialer Ungleichheiten: Dieses Kapitel analysiert die Schule als Institution, die soziale Ungleichheiten reproduziert. Es zeigt auf, wie das Bildungssystem durch seine Strukturen und Inhalte die Schülerinnen und Schüler auf die gesellschaftlichen Macht- und Herrschaftsverhältnisse vorbereitet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Bildungsungleichheit, Intersektionalität, Schule, Reproduktion sozialer Ungleichheiten, Heterogenität, Diversität, Inklusion, Migration, Geschlecht, Behinderung, Diskriminierung, Lehrerschaft, Pädagogik.
- Quote paper
- Abdurrahim Derya (Author), 2016, Intersektionalität im Kontext Schule. Intersektionale Aspekte und Bildungsungleichheit an den Schnittstellen Migration, Geschlecht und Behinderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/378848