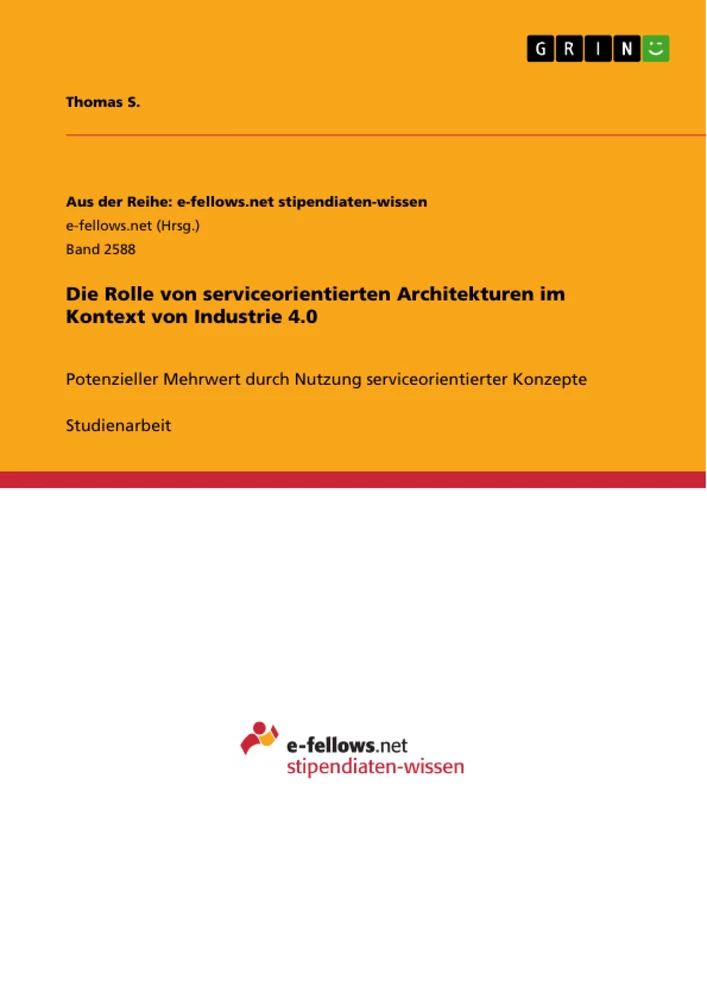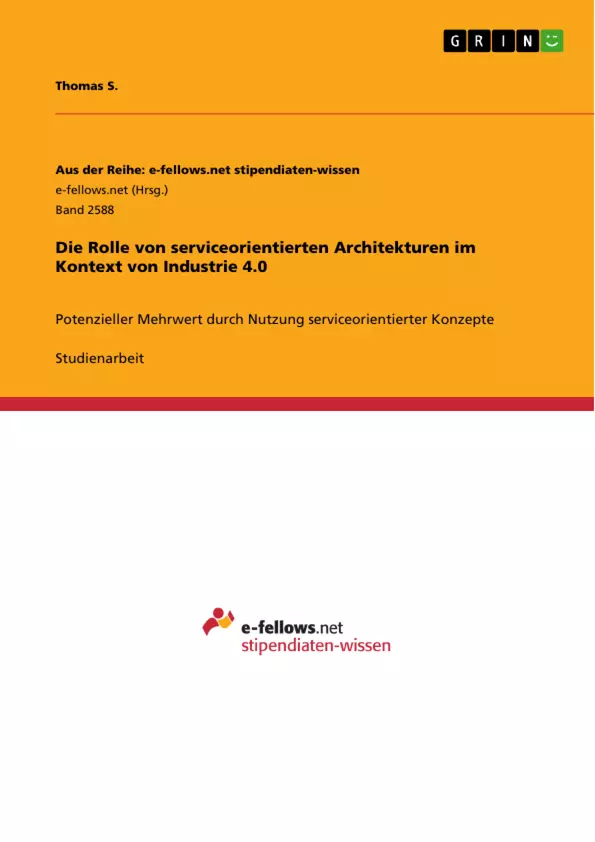Diese Ausarbeitung geht von der Annahme aus, dass Serviceorientierte Architektur (SOA) im Kontext von Industrie 4.0 eine Rolle spielen kann und soll aufgrund dessen einen Beitrag zur Klärung folgender Forschungsfrage liefern: Welche Rolle spielt SOA für Industrie 4.0? Für welche Bereiche im Kontext von Industrie 4.0 besitzt SOA eine Relevanz? Welchen Mehrwert bringt SOA für Industrie 4.0?
Ursachen, die das Entwickeln und Belegen einer allgemeingültigen und verbreiteten Aussage über die Rolle von SOA in Industrie 4.0 verhindern, finden sich überwiegend in zeitlichen Aspekten wieder. Der Prozess zur Erarbeitung wissenschaftlicher Arbeiten, insbesondere solcher, die durch weitere Experten begutachtet werden, ist sehr langwierig, so dass die themenrelevante Literatur in diesem neuen Forschungsgebiet gegenwärtig noch sehr gering ist. Jedoch ist eine ausreichende Basis an wissenschaftlichen Arbeiten notwendig, um die Rolle von SOA im Umfeld von Industrie 4.0 zu evaluieren und eine Aussage treffen zu können.
Eine Auseinandersetzung mit vorhandener Literatur zum Zusammenhang zwischen SOA und Industrie 4.0 kann eine Antwort auf die Rolle von SOA im Kontext von Industrie 4.0 liefern und einen Beitrag dazu leisten, die Kosten- und Zeitaufwände in zukünftigen Industrie 4.0 Architekturen zu reduzieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2. Begriffsdefinitionen
- 2.1 Industrie 4.0
- 2.2 Serviceorientierte Architektur
- 3. Systematische Literaturrecherche
- 3.1 Methodisches Vorgehen
- 3.2 Durchführung der Recherche
- 4. Auswertung der Literaturrecherche
- 4.1 SOA als Basis für das Konzept der Smart Factory
- 4.2 SOA als Basis für Smart Objects
- 4.3 SOA im Umfeld von Embedded Systems
- 5. Fazit und Disskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Rolle von serviceorientierten Architekturen (SOA) im Kontext von Industrie 4.0. Sie untersucht, welchen potenziellen Mehrwert die Nutzung serviceorientierter Konzepte in diesem Zusammenhang bietet.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs Industrie 4.0
- Erklärung und Funktionsweise von serviceorientierten Architekturen
- Analyse der Einsatzmöglichkeiten von SOA in Smart Factories
- Bewertung des Potenzials von SOA für Smart Objects
- Diskussion der Herausforderungen bei der Implementierung von SOA in Embedded Systems
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Problemstellung ein und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Kapitel 2 definiert die zentralen Begriffe Industrie 4.0 und serviceorientierte Architektur. Kapitel 3 beschreibt die methodische Vorgehensweise der durchgeführten Literaturrecherche. Kapitel 4 analysiert die Ergebnisse der Literaturrecherche und untersucht die Einsatzmöglichkeiten von SOA in verschiedenen Kontexten von Industrie 4.0. Schließlich werden im abschließenden Kapitel die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst und diskutiert.
Schlüsselwörter
Industrie 4.0, serviceorientierte Architektur (SOA), Smart Factory, Smart Objects, Embedded Systems, Cyber-physische Systeme (CPS), Internet der Dinge (IoT), Total Cost of Ownership (TCO)
- Quote paper
- Thomas S. (Author), 2017, Die Rolle von serviceorientierten Architekturen im Kontext von Industrie 4.0, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/374256