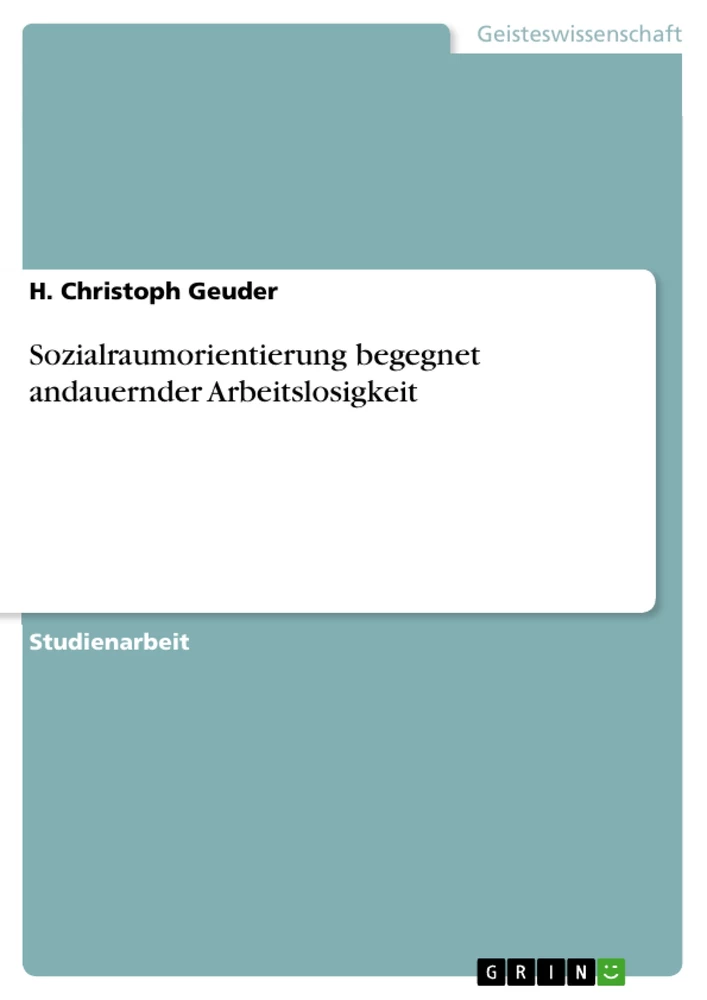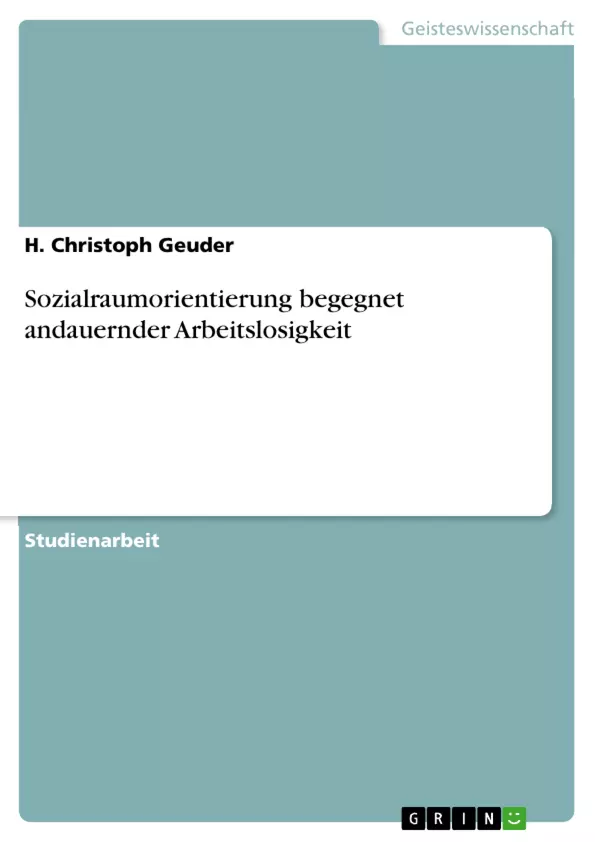Menschen werden arbeitslos. Das Problem, lange Zeit ohne Erwerbsarbeit zu sein, nimmt schicksalhaften Charakter an. Menschen verändern sich. Die vorliegende Erarbeitung folgt der Frage nach Veränderungsprozessen, die sich in der Lebenswelt eines Menschen vollziehen, wenn dieser langzeitarbeitslos wird?
Die Beispielgeschichte "Meister Eder" zeigt erst die Erfahrung auf, die immer wieder mit dem Abstieg in die Langzeitarbeitslosigkeit verbunden wird und bietet dann Lösungsvorschläge durch die Anwendung der fünf Prinzipien des Fachkonzeptes der Sozialraumorientierung (SRO) an. Dies geschieht ausgehend von Überlegungen, wie sich die Ansicht, dass Arbeitslosigkeit problematisch sei, entwickelt hat. Es werden zuerst die kulturgeschichtlichen Wurzeln seit der Industrialisierung schlaglichtartig skizziert. Ansatzpunkte, diese kulturellen Fragen zu lösen, bedürfen einer umfangreicheren Betrachtung als sie die vorliegende Arbeit leisten kann. Die Skizze des kulturellen Hintergrundes zeigt für den Zusammenhang der Erarbeitung den Problemhorizont auf. Dieser liegt als kulturelle Gemeinsamkeit der Lebenswelt aller in der Beispielgeschichte vorkommenden Akteuren zugrunde. Auch ich selbst, der ich diese Arbeit schreiben, bin durch eine solche Sichtweise geprägt. Ein gründliches Hinterfragen würde den Rahmen sprengen und findet an dieser Stelle nicht statt. Auf Langzeitarbeitslosigkeit zielt die vorliegende Erarbeitung in erster Linie deshalb, weil die Folgen von Negativentwicklungen erst bei lange andauernder Arbeitslosigkeit sichtbar werden. Grundsätzlich ist jedoch die Frage der Arbeitslosigkeit generell zu bearbeiten. Dazu leistet diese Erarbeitung einen sehr kleinen Beitrag.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Betrachtung von andauernder Arbeitslosigkeit
- Schlaglichtartige Problembeschreibung
- Meister Eder"
- Perspektive Sozialraumorientierung
- Orientierung an Interessen und am Willen
- Unterstützung von Eigeninitiative und Selbsthilfe
- Konzentration auf die Ressourcen
- Zielgruppen- und bereichsübergreifende Sichtweise
- Kooperation und Koordination
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen von andauernder Arbeitslosigkeit auf die Lebenswelt eines Menschen und zeigt, wie das Fachkonzept Sozialraumorientierung dabei helfen kann, die Situation zu verbessern. Die Arbeit befasst sich mit der kulturellen Norm, die Arbeitslosigkeit als problematisch darstellt, sowie mit den Folgen von Langzeitarbeitslosigkeit für die Betroffenen.
- Die kulturelle Norm der Erwerbsarbeit
- Die Folgen von Langzeitarbeitslosigkeit
- Das Fachkonzept Sozialraumorientierung
- Ressourcen und Eigeninitiative
- Kooperation und Koordination
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema Langzeitarbeitslosigkeit und die Frage nach Veränderungsprozessen in der Lebenswelt eines Menschen, der langzeitarbeitslos wird, vor. Sie skizziert den kulturellen Hintergrund und die Problematik von Langzeitarbeitslosigkeit, die in der Arbeit genauer betrachtet wird.
Betrachtung von andauernder Arbeitslosigkeit
Dieses Kapitel beleuchtet die Folgen von Langzeitarbeitslosigkeit für die Betroffenen. Es wird die tiefe Verwurzelung der kulturellen Norm dargestellt, die Arbeitslosigkeit als problematisch darstellt, und exemplarisch der „Abstieg“ des „Meister Eder“ gezeigt.
Perspektive Sozialraumorientierung
Dieses Kapitel widmet sich den fünf Prinzipien des Fachkonzeptes Sozialraumorientierung und zeigt auf, wie dieses Konzept bei der Bewältigung von Langzeitarbeitslosigkeit helfen kann.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit Themen wie Langzeitarbeitslosigkeit, Sozialraumorientierung, kulturelle Normen, Folgen von Arbeitslosigkeit, Ressourcen, Eigeninitiative, Kooperation, Koordination, und gesellschaftliche Teilhabe.
Häufig gestellte Fragen
Wie verändert Langzeitarbeitslosigkeit die Lebenswelt eines Menschen?
Langzeitarbeitslosigkeit hat oft schicksalhaften Charakter und führt zu tiefgreifenden negativen Veränderungen in der sozialen Teilhabe und dem Selbstbild der Betroffenen.
Was ist das Konzept der Sozialraumorientierung (SRO)?
SRO ist ein Fachkonzept, das sich an den Interessen und dem Willen der Menschen orientiert und deren Eigeninitiative sowie vorhandene Ressourcen im Lebensumfeld stärkt.
Welche fünf Prinzipien liegen der Sozialraumorientierung zugrunde?
Die Prinzipien sind: Interessenorientierung, Unterstützung von Eigeninitiative, Ressourcenkonzentration, zielgruppenübergreifende Sichtweise sowie Kooperation und Koordination.
Warum wird Arbeitslosigkeit in unserer Gesellschaft als so problematisch wahrgenommen?
Dies liegt an tief verwurzelten kulturgeschichtlichen Normen seit der Industrialisierung, die Erwerbsarbeit als zentralen Identitäts- und Wertfaktor definieren.
Wer ist "Meister Eder" in dieser Arbeit?
„Meister Eder“ dient als fiktive Beispielgeschichte, um den sozialen Abstieg in die Langzeitarbeitslosigkeit und mögliche Lösungswege durch SRO zu veranschaulichen.
- Quote paper
- H. Christoph Geuder (Author), 2017, Sozialraumorientierung begegnet andauernder Arbeitslosigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/372492