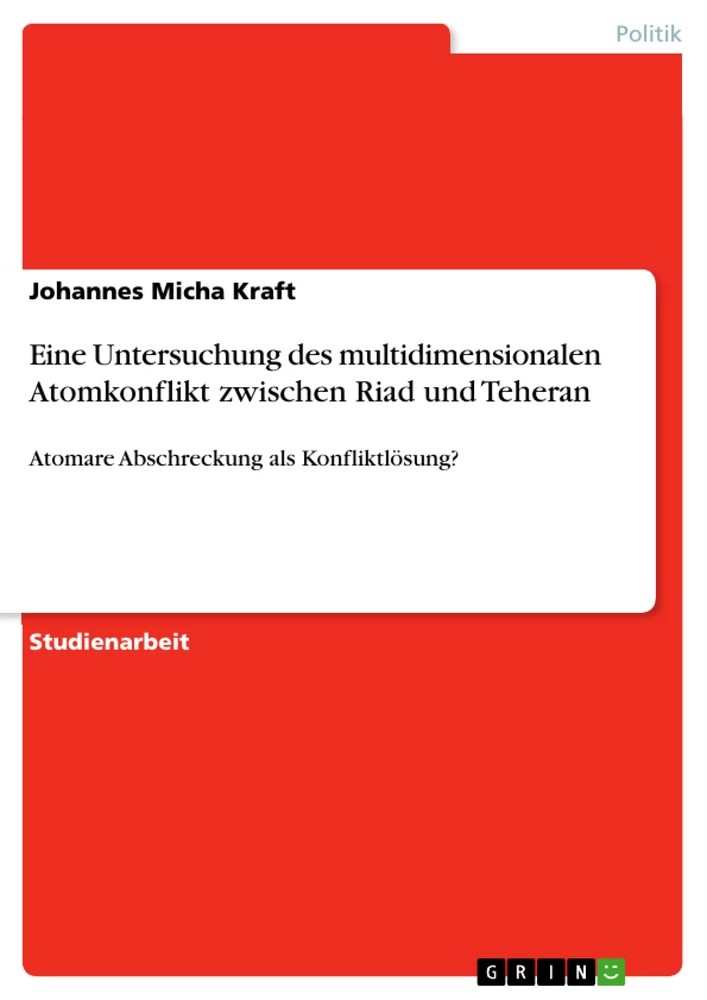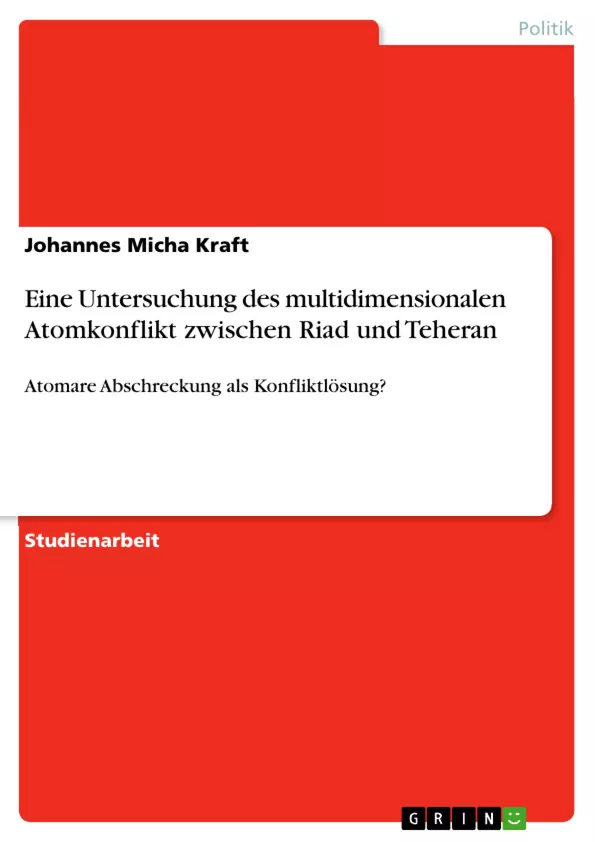Im Jahre 2007, lange Zeit nach dem kalten Krieg zwischen Washington und Moskau, plädierten vier US-Spitzenpolitiker für eine weltweite atomare Abrüstung: Henry Kissinger, George Shultz, William Perry und Sam Nunn. Auch der ehemalige US-Präsident Obama kündigte 'Global Zero' in einer Rede in Prag 2009, als wichtiges strategisches Ziel seiner Präsidentschaft an. 2012 veröffentlichte die Zeitschrift „Foreign Affairs“ einen Artikel von Kenneth N. Waltz mit dem Titel „Why Iran should get the bomb“, in welchen Waltz sich für eine atomare Bewaffnung Irans ausspricht. Dies würde seiner Meinung nach zu einer Stabilisierung der politischen Situation im mittleren Osten führen. Der aktuelle Präsident der USA Donald Trump, verglich im Jahr 2016 das Atomwaffenarsenal Russlands und das der USA und sagte: „Our nuclear is old and tired and his nuclear is tippy-top from what I hear. Better be careful, folks, okay? You better be careful.”
In dieser Arbeit wollen wir uns dem multidimensionalen Konflikt zwischen Iran und Saudi-Arabien, ferner Teheran und Riyad widmen. Es soll der Frage nachgegangen werden, ob eine atomare Ausrüstung Teherans und/oder Riyads eine stabilisierende Wirkung auf die politische Situation im mittleren Osten hätte. Ausgangsbasis ist hierfür ist der Text von Waltz „Why Iran should get the bomb“ und seiner Balance-of-power Theorie. Hierbei wird der multidimensionale Konflikt beider Länder analysiert und systematisch mit Theorien der (neo)realistischen Schule verglichen. Methodologisch wird per induktiver Methode vorgegangen, ferner von empirischen Erkenntnissen auf allgemeine theoretische Konzepte zu schließen. Zuerst soll im theoretischen Teil die Waltz´sche Theorie more may be better eruiert werden und im Anschluss werden die einzelnen Punkte mit der Waltz-Sagan Debatte (more may be better vs. more may be worse) näher beleuchtet. Nachfolgend werden die Balance-of-power und Balance-of-threat Theorien gegenübergestellt. Nach dem Umriss des Wissenschaftsdiskurses, sollen im empirischen Teil die multidimensionalen Ebenen des Konfliktes zwischen Riyad und Teheran analysiert werden. Die empirische Analyse wird mit der hermeneutischen Methode durchgeführt. Zudem werden relevante und valide Informationen aus verschiedenen Quellen herangezogen, um so die einzelnen Themenbereiche zu erschließen und zu analysieren. Die gewonnenen Erkenntnisse werden anschließend mit den theoretischen Überlegungen verglichen, um so die ausgehende Forschungsfrage zu beantworten
Inhaltsverzeichnis
- Exposé
- Literaturbericht
- Theoretischer Teil
- Waltz und die atomare Abschreckung
- Stabilität durch Atomwaffen? Waltz und Sagan in Uneinigkeit
- Balance-of-power vs. Balance-of-threat
- Waltz und die atomare Abschreckung
- Empirischer Teil
- Geostrategische Dimension
- Energiepolitische Dimension
- Religiös-Ideologische Dimension
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem multidimensionalen Konflikt zwischen Iran und Saudi-Arabien und untersucht, ob eine atomare Bewaffnung Teherans und/oder Riyads zu einer Stabilisierung der politischen Situation im mittleren Osten führen könnte. Die Arbeit bezieht sich dabei auf Kenneth Waltz' Theorie "Why Iran should get the bomb" und seine Balance-of-power Theorie.
- Analyse des multidimensionalen Konflikts zwischen Iran und Saudi-Arabien
- Bewertung der Auswirkungen einer atomaren Bewaffnung Teherans und/oder Riyads auf die regionale Sicherheit
- Vergleich der theoretischen Konzepte der neorealistischen Schule mit den empirischen Erkenntnissen des Konflikts
- Untersuchung der Waltz-Sagan Debatte über die Auswirkungen von Atomwaffen auf die internationale Stabilität
- Bewertung der Rolle von Atomwaffen in der regionalen Machtpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
- Exposé: Das Exposé führt in die Thematik der atomaren Abschreckung im Kontext des Konflikts zwischen Iran und Saudi-Arabien ein. Es beleuchtet die Debatte um Atomwaffen im 21. Jahrhundert und stellt die Forschungsfrage nach den Auswirkungen einer atomaren Ausrüstung Teherans und/oder Riyads auf die politische Situation im Mittleren Osten.
- Literaturbericht: Der Literaturbericht beschreibt die verwendeten Quellen und Quellenarten, die für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema relevant sind. Er erläutert die Auswahl der Quellen und gibt einen Überblick über die genutzten wissenschaftlichen Ansätze.
- Waltz und die atomare Abschreckung: In diesem Kapitel wird die Theorie von Kenneth Waltz "Why Iran should get the bomb" erläutert und im Kontext der Waltz-Sagan Debatte über die Auswirkungen von Atomwaffen auf die internationale Stabilität diskutiert. Die Balance-of-power und Balance-of-threat Theorien werden gegenübergestellt.
- Geostrategische Dimension: Das Kapitel behandelt die geostrategischen Dimensionen des Konflikts zwischen Iran und Saudi-Arabien. Es analysiert die jeweiligen geopolitischen Interessen und die Rolle von Atomwaffen in der regionalen Machtpolitik.
- Energiepolitische Dimension: Dieses Kapitel beleuchtet die energiepolitische Dimension des Konflikts. Es untersucht die Rolle von Öl und Gas in der Region und die Auswirkungen von Atomwaffen auf die Energiepolitik der beiden Länder.
- Religiös-Ideologische Dimension: Der Konflikt zwischen Iran und Saudi-Arabien hat auch eine religiös-ideologische Dimension. Dieses Kapitel analysiert die Rolle des Schiismus und des Sunnismus in der Region und die Auswirkungen von Atomwaffen auf die religiösen Konflikte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die folgenden Schlüsselwörter: atomare Abschreckung, Balance-of-power, Balance-of-threat, Iran, Saudi-Arabien, Mittlerer Osten, Atomwaffen, geostrategische Dimension, energiepolitische Dimension, religiös-ideologische Dimension, Waltz, Sagan, JCPOA.
- Quote paper
- Johannes Micha Kraft (Author), 2017, Eine Untersuchung des multidimensionalen Atomkonflikt zwischen Riad und Teheran, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/371537