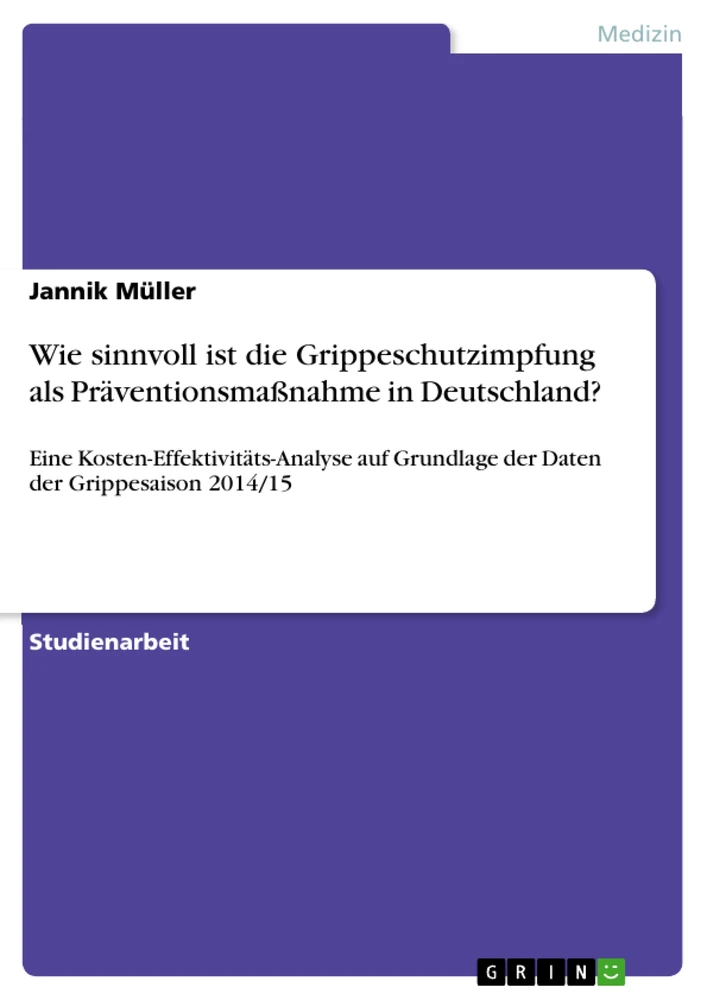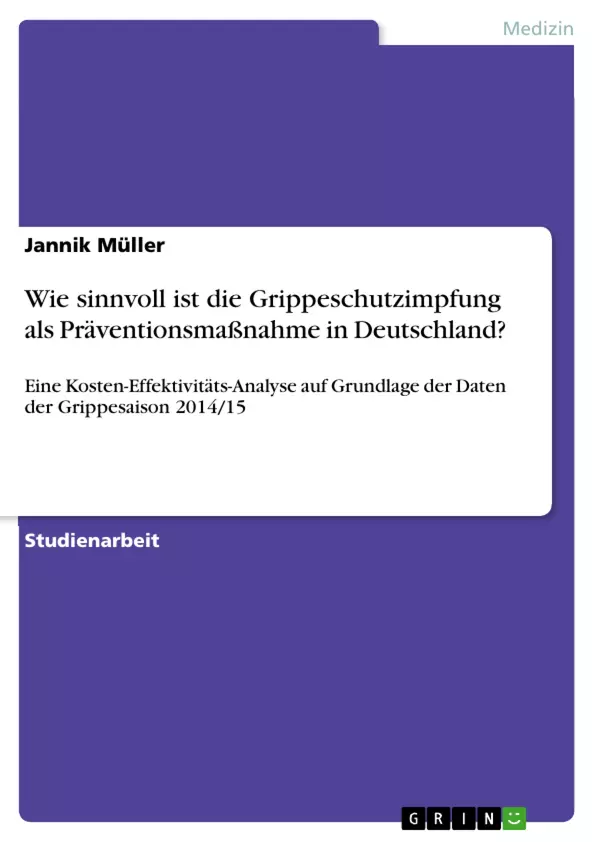In dieser Arbeit soll für die Grippeschutzimpfung eine Kosten-Effektivitätsanalyse auf Grundlage der Saison 2014/15 durchgeführt werden. Dabei sollen einerseits Kosten für die Impfung und entstehende Nebenwirkungen als auch andererseits Kosten für die ambulante und stationäre Behandlung sowie Influenza-assoziierte Arbeitsunfähigkeiten berücksichtigt werden.
Als Ergebnisgröße wurden die durch die Grippeschutzimpfung zusätzlich aufgewendeten oder eingesparten Kosten je verhinderter Influenza-Infektion gewählt. Dies wird zunächst für die tatsächlich verabreichten Impfungen in der Saison 2014/15 durchgeführt, bevor anschließend auf Grundlage dieser Daten das tatsächliche Effektivitätspotenzial der Grippeschutzimpfung in einer Muster-Kosten-Effektivitätsanalyse errechnet wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Gesundheitsökonomische Grundlagen.
- 3. Epidemiologie der Influenza in Deutschland.
- 3.1 Influenza-assoziierte Arztbesuche (Erkrankungen, ambulante Behandlungen).
- 3.2 Influenza-assoziierte Krankenhauseinweisungen (stationäre Behandlungen) ..
- 3.3 Influenza-assoziierte Arbeitsunfähigkeiten und Pflegebedürftigkeiten...........
- 4. Berechnung der durch Influenza verursachten Kosten......
- 4.1 Kosten für das Gesundheitswesen.
- 4.1.1 Kosten für ambulante Behandlungen (unkomplizierter Verlauf).
- 4.1.2 Kosten für stationäre Behandlungen (komplizierter Verlauf)
- 4.2 Indirekte Kosten für die Volkswirtschaft
- 5. Berechnung der durch die Grippeschutzimpfung anfallenden Kosten.
- 5.1 Grippeschutzimpfung in Deutschland.
- 5.1.1 Impfstoffe.......
- 5.1.2 Impfempfehlungen.
- 5.1.3 Impfquoten.
- 5.2 Kosten für die Grippeschutzimpfung
- 5.3 Kosten für Nebenwirkungen von Grippeschutzimpfungen .......
- 6. Berechnung der durch die Grippeschutzimpfung eingesparten Kosten
- 6.1 Eingesparte Kosten durch verhinderte ambulante Behandlungen ..
- 6.2 Eingesparte Kosten durch verhinderte stationäre Behandlungen
- 6.3 Eingesparte Kosten durch verhinderte Arbeitsunfähigkeiten ..........\li>
- 7. Kosten-Effektivitäts-Analyse für Deutschland (real) in der Saison 2014/15 (Zwischenfazit) 15
- 8. Kosten-Effektivitäts-Analyse für Deutschland (Muster) auf Grundlage der Saison 2014/15.
- 8.1 Altersgruppe der 0- bis 14-Jährigen
- 8.1.1 Kosten-Effektivitäts-Analyse
- 8.1.2 Kosten-Effektivität in Abhängigkeit von der Impfeffektivität .
- 8.1.3 Kosten-Effektivität in Abhängigkeit von den Impfkosten bei durchschnittlicher Impfeffektivität.….......
- 8.2 Altersgruppe der 15- bis 59-Jährigen
- 8.2.1 Kosten-Effektivitätsanalyse.........
- 8.2.2 Kosten-Effektivität in Abhängigkeit von der Impfeffektivität.
- 8.3. Altersgruppe ab 60 Jahren
- 8.3.1 Kosten-Effektivitätsanalyse für die Saison 2014/15
- 8.3.2 Kosten-Effektivität in Abhängigkeit von der Impfeffektivität.
- 8.3.3 Kosten-Effektivität in Abhängigkeit von den Impfkosten bei durchschnittlicher Impfeffektivität........
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Bewertung der Grippeschutzimpfung als Präventionsmaßnahme in Deutschland. Es wird eine Kosten-Effektivitäts-Analyse auf Grundlage der Daten der Grippesaison 2014/15 durchgeführt, um die Wirtschaftlichkeit der Impfung zu untersuchen.
- Bewertung der Grippeschutzimpfung als Präventionsmaßnahme in Deutschland
- Durchführung einer Kosten-Effektivitäts-Analyse auf Grundlage der Daten der Grippesaison 2014/15
- Analyse der Kosten für die Impfung und entstehende Nebenwirkungen
- Analyse der Kosten für die ambulante und stationäre Behandlung sowie Influenza-assoziierte Arbeitsunfähigkeiten
- Ermittlung der durch die Grippeschutzimpfung zusätzlich aufgewendeten oder eingesparten Kosten je verhinderter Influenza-Infektion
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung stellt die Influenza und ihre Übertragung sowie die Symptome vor. Sie erklärt die Notwendigkeit der Grippeschutzimpfung als Präventionsmaßnahme und die Forschungsfrage der Arbeit.
- Kapitel 2: Gesundheitsökonomische Grundlagen: Dieses Kapitel erläutert die gesundheitsökonomische Evaluation und verschiedene Analysemethoden. Es definiert Kosten und Effekte in der gesundheitsökonomischen Analyse und stellt die Kosten-Effektivitäts-Analyse als geeignete Methode für die Bewertung der Grippeschutzimpfung vor.
- Kapitel 3: Epidemiologie der Influenza in Deutschland: Dieses Kapitel untersucht die Verbreitung der Influenza in Deutschland und beleuchtet die Anzahl der influenza-assoziierten Arztbesuche, Krankenhauseinweisungen und Arbeitsunfähigkeiten.
- Kapitel 4: Berechnung der durch Influenza verursachten Kosten: Dieses Kapitel analysiert die direkten und indirekten Kosten, die durch Influenza-Erkrankungen entstehen. Die direkten Kosten beinhalten die Kosten für ambulante und stationäre Behandlungen. Indirekte Kosten umfassen die Kosten für Arbeitsunfähigkeiten und Pflegebedürftigkeit.
- Kapitel 5: Berechnung der durch die Grippeschutzimpfung anfallenden Kosten: Dieses Kapitel betrachtet die Kosten der Grippeschutzimpfung, einschließlich der Kosten für Impfstoffe, Nebenwirkungen und die Verabreichung der Impfung.
- Kapitel 6: Berechnung der durch die Grippeschutzimpfung eingesparten Kosten: Dieses Kapitel analysiert die durch die Grippeschutzimpfung eingesparten Kosten für ambulante und stationäre Behandlungen sowie Arbeitsunfähigkeiten.
- Kapitel 7: Kosten-Effektivitäts-Analyse für Deutschland (real) in der Saison 2014/15 (Zwischenfazit): Dieses Kapitel präsentiert eine erste Analyse der Kosten-Effektivität der Grippeschutzimpfung auf Grundlage der tatsächlich verabreichten Impfungen in der Saison 2014/15.
- Kapitel 8: Kosten-Effektivitäts-Analyse für Deutschland (Muster) auf Grundlage der Saison 2014/15: Dieses Kapitel führt eine Muster-Kosten-Effektivitäts-Analyse durch, um das tatsächliche Effektivitätspotenzial der Grippeschutzimpfung zu berechnen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit der Grippeschutzimpfung als Präventionsmaßnahme in Deutschland. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Influenza, Grippeschutzimpfung, Kosten-Effektivitäts-Analyse, Gesundheitsökonomie, Epidemiologie, Prävention, Impfeffektivität, Impfkosten, Saison 2014/15.
- Arbeit zitieren
- Jannik Müller (Autor:in), 2016, Wie sinnvoll ist die Grippeschutzimpfung als Präventionsmaßnahme in Deutschland?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/369675